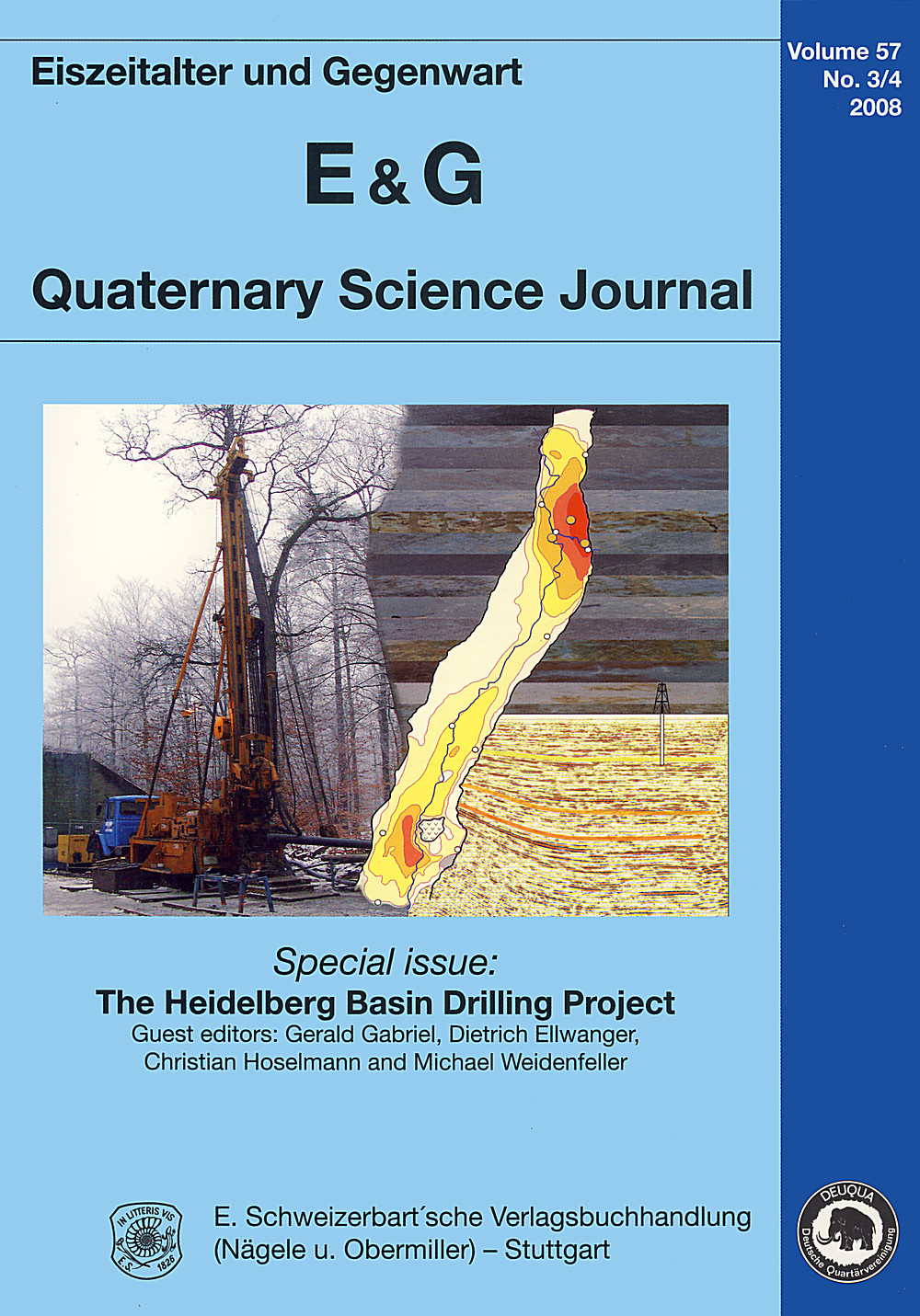Bespr.: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II Jg. 2010 Heft 1/2 top ↑
Der Oberrheingraben bildet de Hauptsedimentfalle des die Alpen mit der Nordsee verbindenden Rheins. Die andauernde Subsidenz des Oberrheingrabens bietet einmalige Bedingungen für die kontinuierliche Akkumulation von Sedimenten. Die beiden größten Sedimentfallen sind dabei das Geiswasser-Becken im Süden und das Heidelberger Becken im nordöstlichen Teil. Das Heidelberger Becken fungiert als distale Falle für alpine Sedimente im Oberrheingraben, die der Rhein Richtung Norden transportiert. Anders als im südlichen Teil des Rheingrabens ist hier die kontinuierliche Sedimentation weniger stark durch Diskontinuitäten gestört. Das Heidelberger Becken ist daher Schlüssel zum Verständnis der glazialen Entwicklung der Alpen seit dem späten Pliozän und für einen Vergleich mit der glazialen Entwicklung Nordeuropas. Es enthält eine der mächtigsten Abfolgen plio-/pleistozäner Sedimente im kontinentalen Mitteleuropa. Die Angaben zur Mächtigkeit des Quartärs variieren zwischen 382 und 650 m.
Das Bohrprojekt „Heidelberger Becken“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Leibniz- Instituts für Angewandte Geophysik und der drei geologischen Dienste von Baden- Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Es dient dem tieferen Verständnis der geologischen Entwicklung des Heidelberger Beckens, insbesondere der Steuerung durch Klimaveränderungen und Tektonik, sowie der Korrelation der alpinen und nordeuropäischen Vereisungsgeschichte. Die Untersuchungen basieren wesentlich auf neuen Kernbohrungen an drei verschiedenen Lokalitäten innerhalb des Heidelberger Beckens, die unterschiedliche Faziesräume abbilden. Die drei neuen Kernbohrungen liefern zusammen 1.450 m Kernmaterial, das Gegenstand eines detaillierten Untersuchungsprogramms ist. Das vorliegende Themenheft stellt in acht Artikeln die ersten Ergebnisse vor.
G. GABRIEL, D. ELLWANGER, C. HOSELMANN & M. WEIDENFELLER stellen in Preface: The Heidelberg Basin Drilling Project das Projekt und die Problematik vor und präsentieren eine Korrelationstabelle der verschiedenen lithostratigraphischen Einheiten, die die drei geologischen Dienste verwenden.
M. WEIDENFELLER & M. KNIPPING präsentieren in Correlation of Pleistocene sediments from boreholes in the Ludwigshafen area, western Heidelberg Basin sich ergänzende konsistente Datensätze von Schwermineralanalysen, Pollenanalysen und der Kernbeschreibung der beiden Bohrungen Ludwigshafen-Parkinsel P34 und P35. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ableitung der klimatischen und fl uviatilen Entwicklung einer Region aufgrund kleinmaßstäblicher tektonischer Ereignisse unsicher ist, wenn diese nur auf einer Bohrung beruht.
C. HOSELMANN untersucht in The Pliocene and Pleistocene fl uvial evolution in the northern Upper Rhine Graben based on results of the research borehole at Viernheim (Hessen, Germany) die Schwermineralien und Karbonatgehalte in der Bohrung Viernheim unter Berücksichtigung des bislang vorliegenden Datensatzes und sieht den Übergang Plio-/Pleistozän aufgrund des charakteristischen Fazieswechsels bei 225 m.
D. ELLWANGER, G. GABRIEL, T. SIMON, U. WIELAND-SCHUSTER, R.O. GREILING, E.-M. HAGEDORN, J. HAHNE & J. HEINZ beschreiben in Long sequence of Quaternary Rocks in the Heidelberg Basin Depocentre die neue Forschungsbohrung Heidelberg UniNord. Die dort angetroffene 500 m mächtige Quartärabfolge ist in erster Linine durch Tektonik kontrolliert. Die Autoren stellen eine auf Provenienz, Lithofazies und wechselnden Verhältnissen von Akkomodationsraum und Sedimentinput beruhende Quartärgliederung vor.
H. BUNESS, G. GABRIEL & D. ELLWANGER stellen in The Heidelberg Basin Drilling Project: Geophysical pre-site surveys die Ergebnisse geophysikalischer Vorerkundungen an den Bohrkernen Viernheim und Heidelberg UniNord und erstellen eine Bouguer-Schwerekarte des gesamten Oberrheingrabens und des Heidelberger Raums mit den drei Lokationen der Forschungsbohrungen Ludwigshafen-Parkinsel, Viernheim und Heidelberg, die sämtliche verfügbaren Daten von deutscher und französischer Seite berücksichtigt.
S. HUNZE & T. WONIK diskutieren in Sediment Input into the Heidelberg Basin as determined from Downhole Logs die physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Lithologien auf der Basis von Bohrlochmessungen und schlagen eine Korrelation zwischen verschiedenen Bohrpunkten im Heidelberger Becken vor. Eine Auswertung mittels Cluster-Analyse ermöglicht es, aus den Bohrlochmessungen Bereiche mit einheitlichen physikalischen Eigenschaften zu finden und damit die möglichen sedimentären Liefergebiete einzugrenzen.
J. WEDEL untersuchte in Pleistocene molluscs from research boreholes in the Heidelberg Basin die Bohrkerne von Viernheim und Ludwigshafen-Parkinsel P34 und P35 auf ihren fossilen Inhalt, insbesondere auf Molluskenreste. Zwei Molluskenarten und eine Nagerart wies man erstmalig aus dem Altbiharium (Altpleistozän) der Bohrung Viernheim für den nördlichen Oberrheingraben nach.
J. HAHNE, D. ELLWANGER & R. STRIZTKE diskutieren in Evidence for a Waalian thermomer pollen record from the research borehole Heidelberg UniNord, Upper Rhine Graben, Baden-Württemberg erste Pollenanalysen der Forschungsbohrung Heidelberg UniNord. Sie bestimmten mit der Wal-Warmzeit einen biostratigraphischen Marker von überregionaler Bedeutung. Basierend auf diesen ersten Ergebnissen postulieren die Autoren eine einheitliche Bewaldung Mitteleuropas im frühen Pleistozän, entsprechend einem Klima, das nicht wärmer war als das heutige.
M. FRECHEN, D. ELLWANGER, D. RIMKUS & A. TECHMER zeigen in Timing of Medieval Fluvial Aggradation at Bremgarten in the Southern Upper Rhine Graben – a Test for Luminescence Dating an fl uviatilen Sedimenten des Profi ls Bremgarten aus dem südlichen Teil des Oberrheingrabens die Eignung von OSL-Techniken für die Datierung fl uviatiler Sedimente großer Flusssysteme. Sie identifi zierten einen kurzen Abschnitt starker Erosion und Resedimentation fluviatiler Sedimente des Tiefgestades von 500 bis 600 Jahren. Dieser Abschnitt repräsentiert ein Ereignis, das mit dem Beginn der kleinen Vereisung etwa 1450 AD korreliert.
Dieses Themenheft über das Heidelberger Becken erschien zu einem frühen Zeitpunkt eines gerade beginnenden Forschungsvorhabens, das Aspekte verschiedener geowissenschaftlicher Disziplinen vereint. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend. Es sind noch weitere, interessante Datierungsergebnisse zu erwarten. Bleibt zu hoffen, dass man im Laufe der Auswertung auch zu einer einheitlichen Vorstellung über Basis des Quartärs kommt.
Das Themenheft ist mit zahlreichen Abbildungen in hervorragender Qualität ausgestattet und für Quartärgeologen und -paläontologen relevant, für den Laien ist es jedoch zu fachspezifisch.
R. ZIEGLER
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II Jg. 2010 Heft 1/2