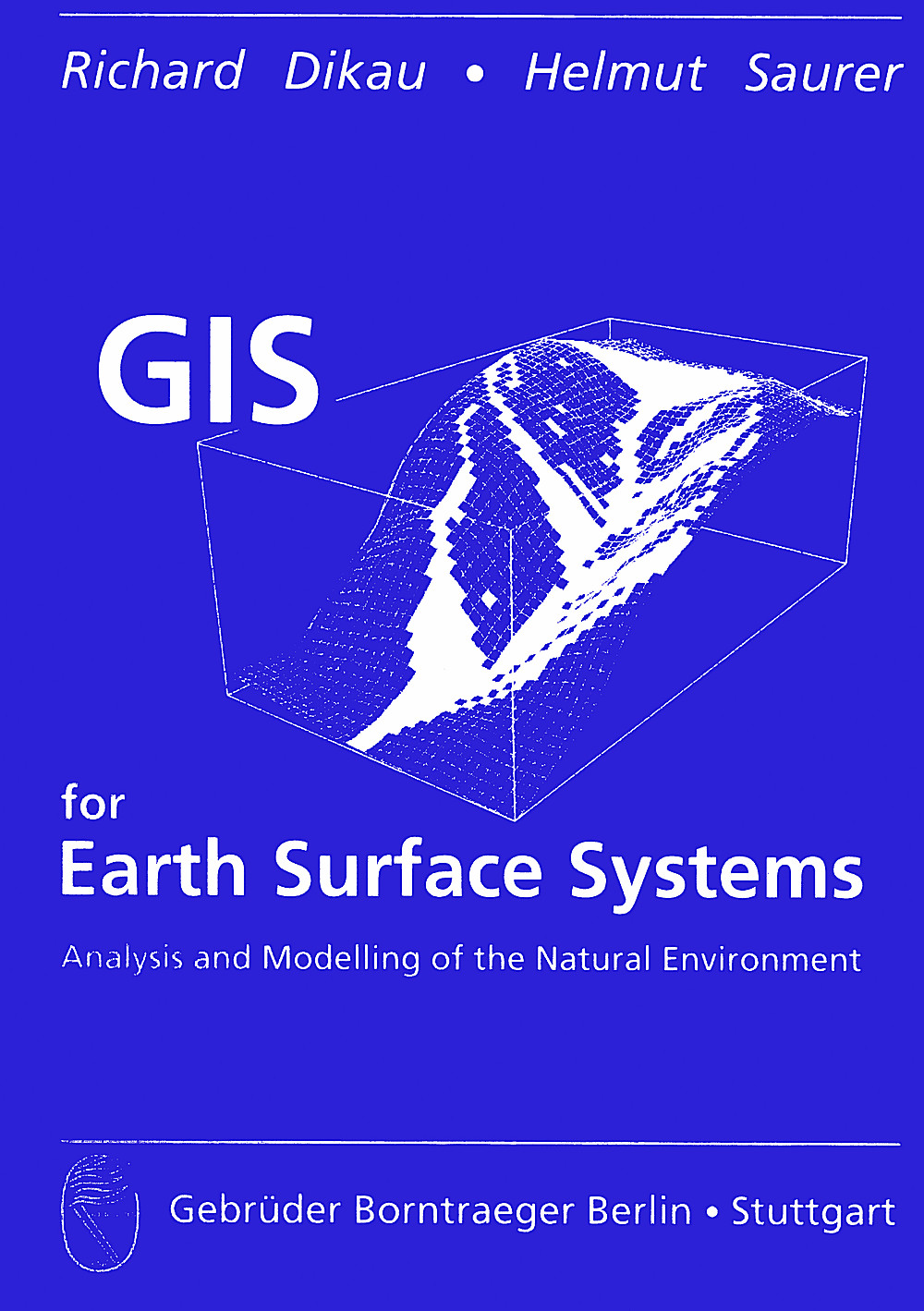Es ist keine leichte Kost, die es hier zu besprechen gilt Dieser
Forschungsbericht ist entstanden unter Beteiligung des Arbeitskreises
GIS der Deutschen Gesellschaft für Geographie, einzelne Beiträge haben
eine Förderung der DFG erhalten. Einem neueren Trend in der deutschen
Wissenschaft folgend, sind alle Beiträge in englischer Sprache
geschrieben, damit sie - wie die Herausgeber betonen - auch von der
internationalen Fachöffentlichkeit zur Kenntnis genommen werden. Ob
dies auch einer Verbreitung im deutschsprachigen Raum verhilft, ist
nicht ganz sicher. Auch darf bezweifelt werden, ob sich das Buch zum
Bestseller eignet. Denn die Beiträge bewegen sich an der
Forschungsfront und dürften die überwiegende Zahl der KN-Leser eher
überfordern. Selbst für GIS-Experten unter ihnen werden einige
Beiträge nur mit einiger Mühe zugänglich sein, was wiederum nicht ihre
Qualität schmälert. Es sind deren neun mit ganz unterschiedlichen
Schwerpunkten, denen eines gemeinsam ist. Sie loten aus, inwieweit
Forschungsansätze für Anwendungen in der physischen Geographie mit der
verfügbaren GIS-Technologie umsetzbar sind. (Es überrascht dabei
kaum, dass dabei die Systembezeichnung Arc-Info häufig auftaucht). Der
Rezensent unterliegt nicht der Versuchung, die einzelnen Beiträge zu
kommentieren, sondern zählt sie nur auf, um den interessierten Leser
neugierig zu machen. Dabei wird konsequent auf den englischen Titel
verzichtet und der Versuch einer inhaltlichen Kurzbeschreibung
gemacht.
Im ersten Beitrag von J. Albrecht und A. (er geht es um die
Hierarchietheorie und ihre Anwendbarkeit in der Landschaftsökologie,
und zwar ausgehend von der Feststellung, dass bisherige Arbeiten sich
stets auf eine ganz bestimmte Maßstabsebene beschränken. Mathematische
Simulationsmodelle kommen zur Anwendung.
Im zweiten Beitrag stellen L. Bernhard und R. weibel ein Modell für
die Vorhersage der räumlichen und zeitlichen Variation der Schneedecke
über alpinem Permafrost während der Schneeschmelze vor. Experimentelle
Messungen und Modellannahmen werden dabei gegenübergestellt.
Gegenstand des nächsten Beitrages von K. Braun und H. Saurer ist die
Regionalisierung von Niederschlagsdaten. Im Vorgergrund steht dabei
die Verknüpfung von Statonswerten des Niederschlages mit
meteorologischen Größen wie sie mit mesoskalischen Strömungsmodellen
gewonnen werden und weiteren Flächendatensätzen mit Hilfe eines
GIS. Grundidee ist dabei, daß die räumliche Verteilung des
Niederschlages eine satarke Abhängigkeit von den Faktoren Luftströmung
und Relief aufweist.
M. Breuning gibt einen straffen Einblick in das Problem der
Entwicklung eines 3D-GIS, dessen Reasisierung dringend gefordert
wird. Er zeigt die Arbeiten auf, die im SFB 350 der DFG durchgeführt
werden, wobei die objektiv-orientierte Datenmodellierung und
entsprechende Datenbanken im Vordergrund stehen.
Sehr stark anwendungsbezogen auf einkonkretes Fallbeispiel der
Landschaftsplanung zeigt sich das Vorhaben von R. Grabaum und
B. C. Meyer, die multikriterielle Bewertungsverfahren einsetzen, um
bei der Optimierung der oftmals entgegenwierkenden Faktoren eine
harmonische Landnutzung vorzuschlagen.
Die Anwendung digitaler Geländemodelle stehen im Mittelpunkt der
Betrachtungen von S. Roessner, der sich mit Denudationsraten hoher
räumlicher Auflösung befasst. Aus dem heutigen Oberflächenmodell und
den bekannten landschaftsbildenden Faktoren wird eine intertiale
Oberfläche generiert. Die Differenz beider soll die Denudatiosraten
liefern.
V. Roth und B. Cyffka beschreiben, wie anhand von empirischen Daten
zur Gewässergüte eines Sees versucht wurde, signifikante räumliche und
zeitliche Zusammenhänge verschiedner hydrologischer Parameter zu
ermitteln.
Inwieweit die Reliefanalyse und Geomorphometrie durch die
GIS-basierten Technken neu orientiert werden können, untersuchen
J. Schmidt und R. Dikau. Die Anwendung dieser Werkzeuge für die
numerische Klassifizierung, Parametrisierung und Analyse
topographischer Form und der dabei entstehenden Probleme werden in
diesem Beitrag diskutiert.
Der letzte Beitrag von B. Triebfürst und H. Saurer befasst sich mit
dem Problem der Datenkompression beim Einsatz von Fernerkundungsdaten,
die mit einer höheren Auflösung ein enormes Datenvolumen erzeugen,
dessen Verarbeitung und Speicherung trotz immer größerer
Speichermedien dennoch zum Problem wird. Die bekannten
Datenkompressionsverfahren sind meist mit nicht unerheblichen
Detailverlusten verbunden. Wie diese dennoch gering gehalten werden
können, steht im Mittelpunkt der Betrachtungen für die Anwendung bei
Raster-GIS.
Resümierend kann der Rezensent feststellen, daß es sich um engagiert
zusammengestellte Beiträge aus der geographischen Forschung handelt,
die zum Teil ein nicht unbeträchtliches Vorwissen verlangen, das bei
manchem Leser dieser Zeitschrift nicht erwartet werden
kann. Andererseits wird der Horizont von "GIS-Erfahrenen" in nicht
unbeträchtlichem Umfang erweitert, sodaß dem Band eine weite
Verbreitung zu wünschen ist.
H. Junius, Dortmund
Kartographische Nachrichten, H. 5/01, S. 263