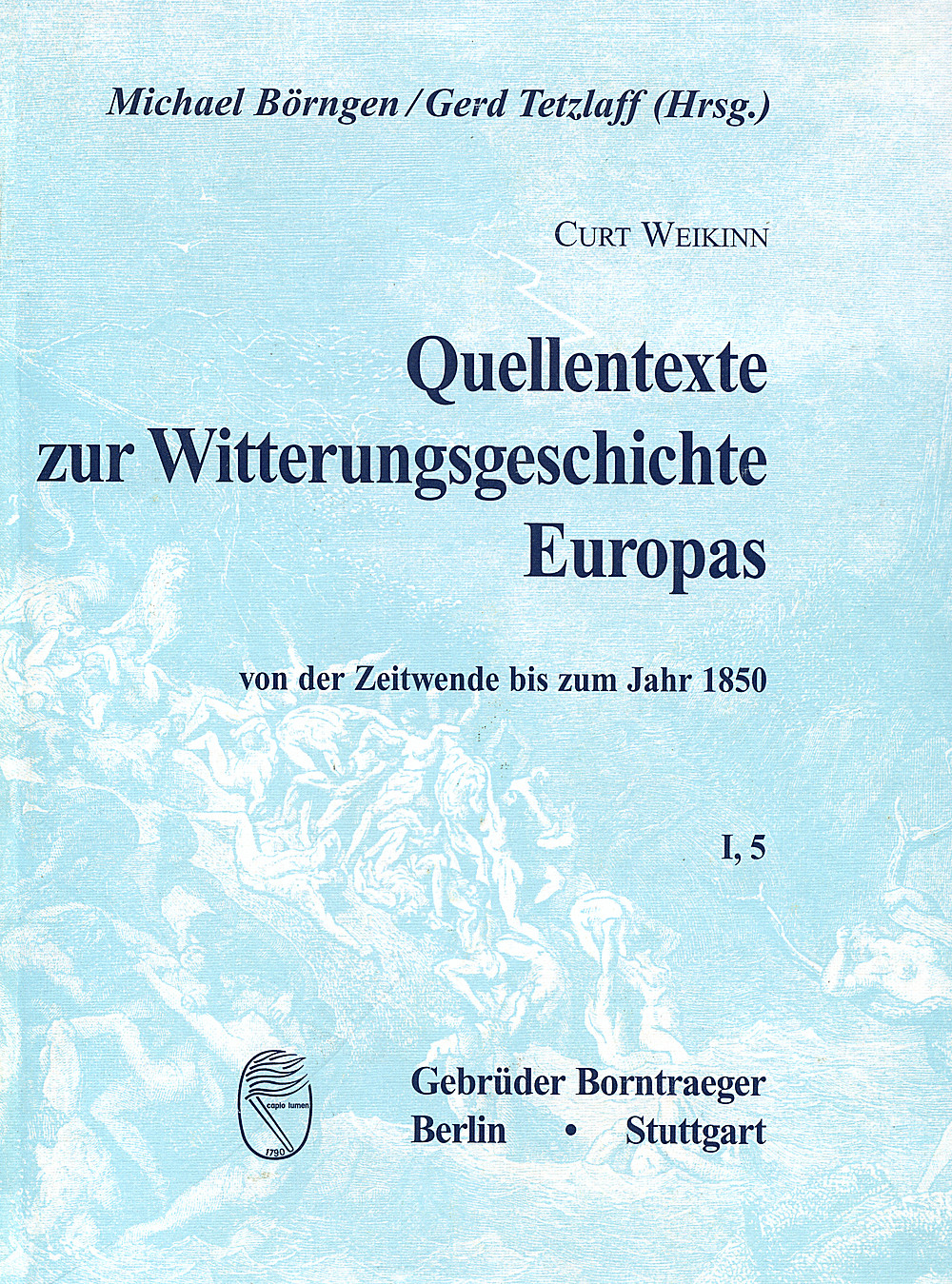Die Weikinn'sche "Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie"
ist eine Zusammenstellung der schriftlichen Überlieferungen über
anomale Naturerscheinungen wie Überschwemmungen, Dürren und strenge
Winter. Curt Weikinn (1888-1966) betrieb vorerst die Sammlung in der
Freizeit - er war im Hauptberuf Bankbeamter. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde er von Hans Ertel, dem Direktor des früheren Instituts
für Physikalische Hydrographie der Deutschen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, finanziell und organisatorisch
unterstützt. Das Gesamtwerk Weitkinn's gliedert sich in
hydrographische Texte (Band I) und meteorologische Texte (Band
II). Vier Teile des Bandes I sind zu Weikinn's Lebzeiten erschienen
(Zeitenwende-1750), der Teil 5 (1751-1800) und der sechste und letzte
Teil (1801-1850) wurden von Michael Börngen und Gerd Tetzlaff auf
Basis eines weitgehend fertigen Manuskriptes herausgegeben.
Der vorliegende sechste Teil der hydrographischen Texte umfasst
insgesamt 5450 Einträge. Jeder Eintrag besteht aus Datum, örtlichem
Bezug, Art des Ereignisses, und in den meisten Fällen ist ein Zitat
aus dem Originaltext ohne Interpretation angegeben. Sämtliche Einträge
sind mit einer genauen Quellenangabe versehen. Die Einträge sind
Chroniken, Zeitschriften und Berichten entnommen. Es ist anzunehmen,
dass heute nicht mehr alle dieser Originalquellen vorhanden sind. Die
Einträge umfassen vor allem Überschwemmungen und Hochwässer. Oft sind
Angaben über Wasserstände angeführt, manchmal sind auch die Ursachen
wie z.B. Eisstoß oder Schneeschmelze beschrieben. Ein kleiner Teil der
Einträge bezieht sich auf Niederwasser, Hagel, Beginn oder Ende einer
Eisdecke und Sturmfluten.
Die regionale Verteilung der Einträge dürfte zum Teil die Herrn
Weikinn zugänglichen Quellen widerspiegeln. Gewässer mit mehr als
hundert Einträgen sind in absteigender Reihenfolge der Anzahl der
Einträge: Elbe, Seine, Rhein, Rhône, Öresund, Donau, Loire,
großer/kleiner Belt, Oder, Garonne, Maas, Saale. Das heißt, dass das
Schwergewicht vor allem auf Deutschland und dabei besonders auf dem
Elbe Gebiet liegt, sowie auf der Tschechische Republik, Frankreich und
Südskandinavien. Auch die Schweiz und Österreich sind, allerdings in
geringerem Umfang, abgedeckt.
Das in den letzten Jahren vermehrte Interesse an Klimaschwankungen
gibt der Weikinn'schen Quellensammlung zusätzliche Bedeutung,
insbesondere für die Beurteilung von Extremereignissen. Während
Berechnungen auf Basis von numerischen Modellen sicherlich wertvolle
Einblicke in mögliche Trends und deren Ursachen liefern, besteht nach
wie vor enorme Unsicherheit bei den Modellannahmen. Ein sorgfältige
Analyse der tatsächlichen über die letzten Jahrhunderte aufgetretenen
Ereignisse, wie dies auf Basis der vorliegenden Sammlung für viele
Gebiete möglich wird, ist deshalb eine überaus wertvolle
Ergänzung. Die in mühevoller Kleinarbeit geschaffene Datenbasis ist
eine enorme Bereicherung für die Hydrologie. Es ist zu wünschen, dass
diese Informationen auch in konkrete Studien, etwa bei der Abschätzung
von Bemessungshochwässern oder von wahrscheinlich größten Hochwässern
Eingang finden. Es ist auch zu hoffen, dass eine Aufarbeitung und
Herausgabe der meteorologischen Texte des Bandes II der Weikinn'schen
Sammlung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten möglich wird.
G. Blöschl, Wien
Hydrologie und Wassertbewirtschaftung Heft 4/2004, S. 210