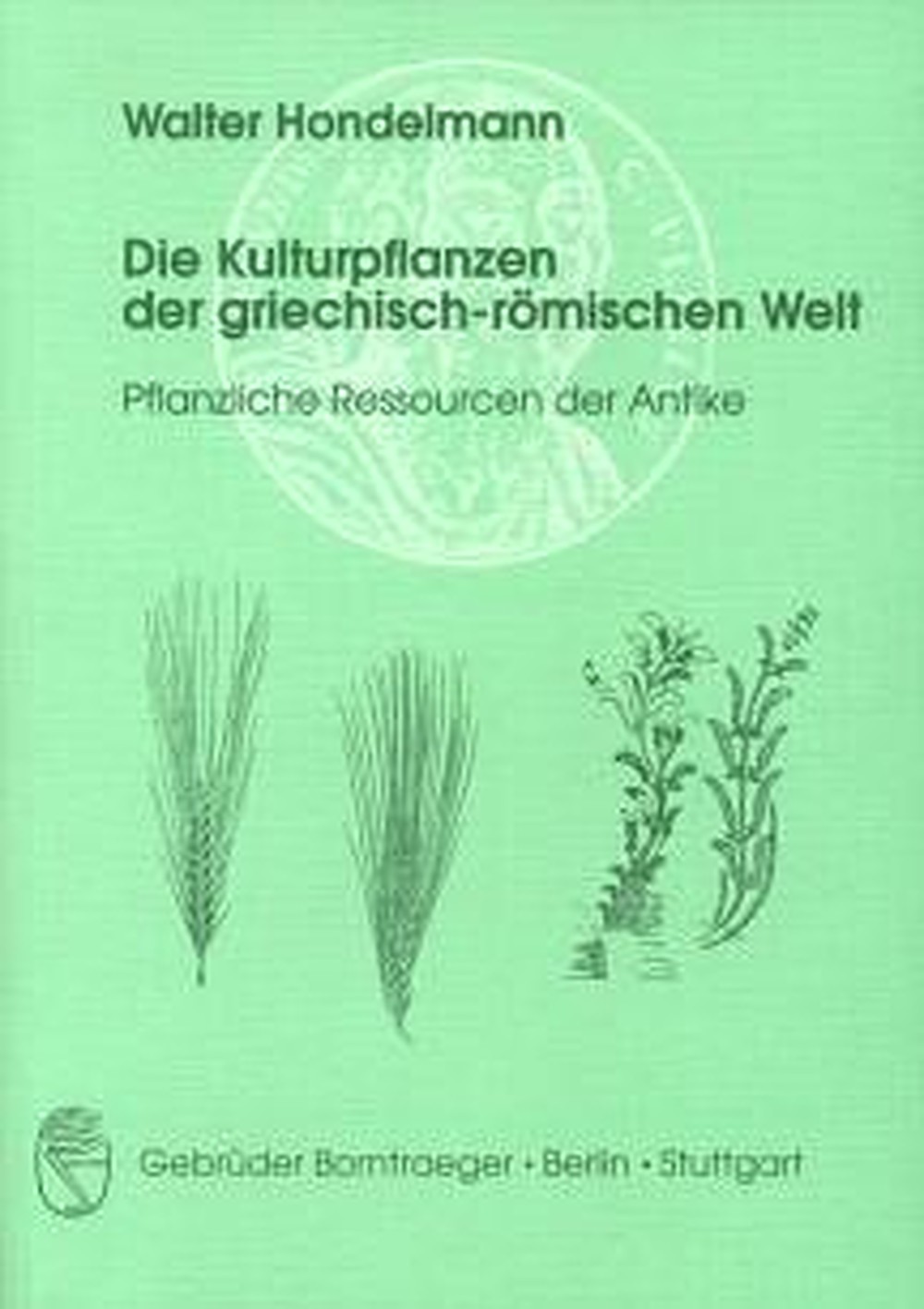Dass ein Pflanzenkenner und -züchter gleichzeitig die alten Sprachen
beherrscht, ist nicht alltäglich. Dies aber machte es erst möglich,
dass jetzt eine - eigentlich überfällige - Arbeit erschienen ist. So
erst bestand die Chance, die Quellen aus der griechisch-römischen
Zeit für das Verständnis über das Zustandekommen unseres
Kulturpflanzenbestandes auszuwerten. Dem landeskulturell
Interessierten wird das von Bedeutung sein: "Die antike Landwirtschaft
hat für die nachfolgenden Jahrhunderte einen nicht zu gering zu
veranschlagenden Beitrag geleistet. Bildete sie nicht eigentlich das
Wurzelwerk der westlichen Zivilisation? Noch heute sind unsere
Kulturpflanzen und die Haustiere lebende Zeugen ihres Wirkens. «
Der Verfasser macht einführend deutlich, dass die Nutzpflanzen der
vorgeschichtlichen Sammler die Vorläufer der Kulturpflanzen der später
sesshaften Menschen waren. Deren Wanderung vom Vorderen Orient bis
nach Mitteleuropa war begeitet von fortschreitender Veredelung durch
Auslese und erst in neuerer Zeit durch Züchtung. Anspruchsvoller
werdende Kulturpflanzen erforderten Standortverbesserung. Der Bauer -
agricola - kultivierte und pflegte das Land und seine Nutzpflanzen:
Ursprung der bis heute weiterentwickelten Landnutzung.
Dies wird anhand der Tabelle "Chronologie der Ausbreitung der
Ackerbaukultur verdeutlicht und in Beziehung gesetzt zu den
Herkunftssgebieten vor allem im Nahen Osten. Eine Beschreibung der
naturräumlichen Voraussetzungen in den Herkunfts- und
Verbreitungsgebieten ergänzt das, konzentriert auf Kleinasien,
Griechenland und Italien.
Hondelmann geht auf die von ihm ausgewerteten Quellen ein; dies sind
Theophrast, Cato, Varro, Columella und der ältere Plinius sowie auf
die weiterführende Sekundärliteratur. Die Aussagen werden hinsichtlich
der wichtigsten antiken Kulturpflanzenarten und deren Formenvielfalt
überprüft. Danach werden die Nutzpflanzengruppen Getreide,
Hülsenfrüchte, Gemüse, Gewürzpflanzen, Öl- und Faserpflanzen und
Obstgehölze detailliert, abgehandelt und interpretiert. Bei jeder der
behandelten Arten erfährt man Wichtiges über Herkunft und
Domestikation sowie auch zu den ökologischen Anforderungen und damit
zu den Ansprüchen an den Kulturstandort. Die Stellung der Arten in der
antiken Volksernährung wird behandelt.
Wir halten ein bei gründlicher Wissenschaftlichkeit gleichzeitig
spannendes Buch in den Händen, dem man deshalb nicht nur die berühmte
freundliche Aufnahme, sondern eine weite Verbreitung wünscht. Das
beginnt mit der Diskussion, dass die bis heute geführte Auswertung
antiker botanischer und agrarischer Literatur im wesentlichen durch
vorrangig philologische Gesichtspunkte gekennzeichnet war. Schon so
betrachtet stellt die Arbeit etwas völlig Neues dar. Auch der
vielleicht nur am Rande und sozusagen "außerberuflich'' interessierte
Leser findet Dinge, "an die man bisher gar nicht gedacht hatte". Allein
die Frage unterschiedlicher Bedeutung antiker, bzw. später
wissenschaftlicher, Namen für die uns heute bekannten Pflanzen sorgt
schon für Spannung. Vertieft man sich dann in die Beschreibungen der
einzelnen Kulturpflanzen, so wird erst recht die Neugier geweckt
angesichts der Fülle von Daten, auch zu den früheren Anbau-, Nutzungs-
umd Verzehrweisen; und diese Neugier setzt sich dann von Seite zu
Seite fort.
Der Verfasser schließt mit dem Satz: "Ihnen, den namenlosen
Landleuten, sollte ein Denkmal gesetzt werden, eine Stele der
Erinnerung". Das ist vollauf gelungen, und so füllt diese Arbeit nicht
nur etwa eine Lücke, sondern sie macht vielmehr auf die Lücke
aufmerksam, die bisher bestand.
K. Resche, Bremen
Landnutzung und Landentwicklung, Jg. 44, Heft X/2003