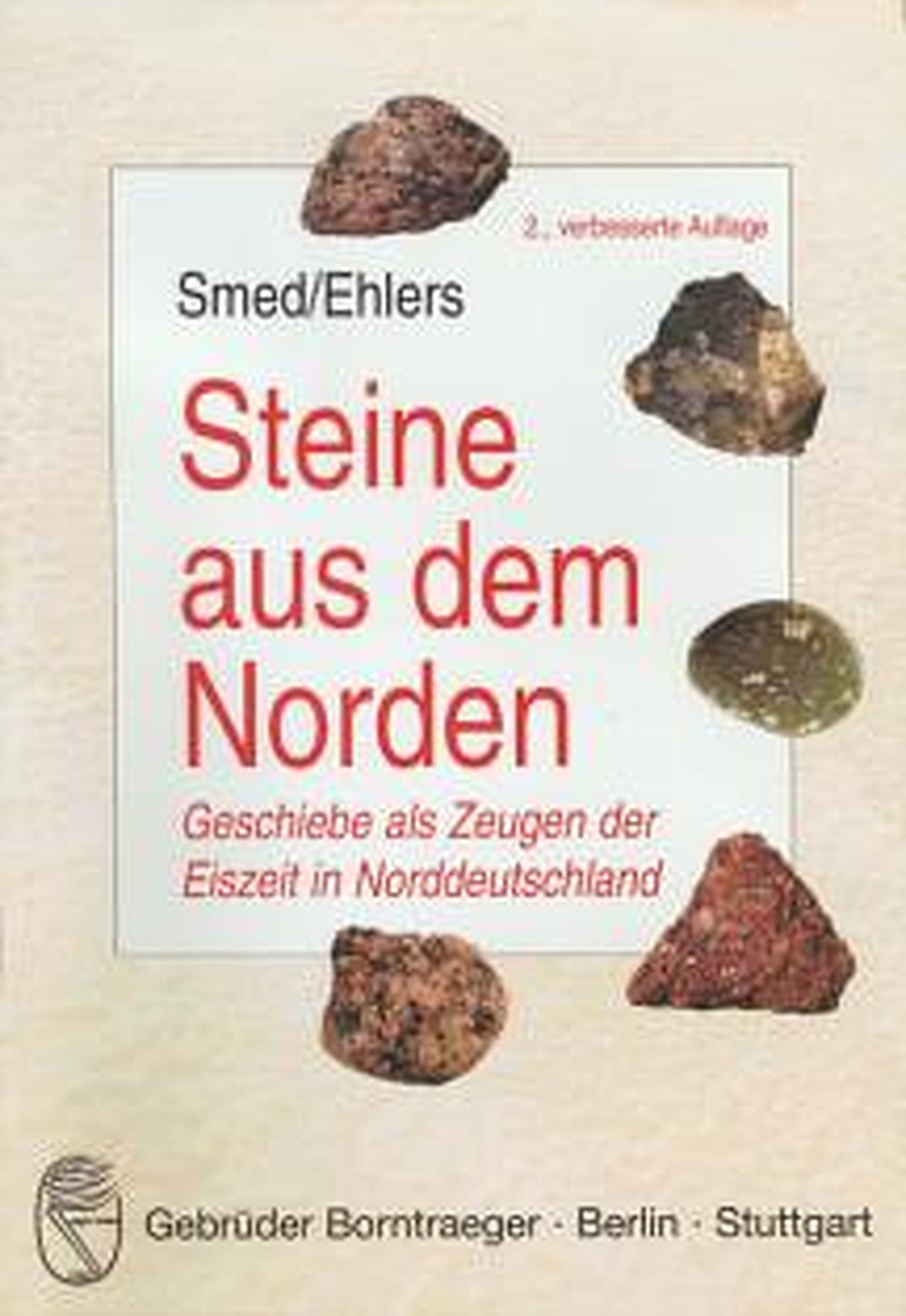Das vorliegende Bestimmungsbuch für Leitgeschiebe als
Hinterlassenschaft der Eiszeit in Norddeutschland vermittelt auch dem
Nichtfachmann Einblicke in die Glazialgeologie. Die Verfasser
erläutern viele Fachausdrücke, die wichtigsten Minerale und liefern im
Anhang ein kleines Fachlexikon.
Im 1. Kapitel wird die Frage nach dem Zweck der deutschen Ausgabe
dieses Buches beantwortet. Es soll Amateure dazu anregen, an der
Erforschung der eiszeitlichen Geschichte Norddeutschlands, ohne
aufwendige Labormethoden, mitzuwirken.
Im 2. und 3. Kapitel werden dem Leser Grundlagen der Gesteinskunde
vermittelt. Das 2. Kapitel beginnt mit dem Ausspruch Aller Anfang ist
schwer. Dies trifft leider für die hier gemachten Ausführungen ebenso
zu. Hier seien nur einige Beispiele genannt, die dem kritischen Leser
schon in der ersten Auflage unangenehm aufgefallen sind: Salz und Rost
sind keine Minerale, sie bestehen aber aus solchen. Sand und Ton sind
keine Gesteine, sondern (unverfestigte) Sedimente. Die Gesteine teilt
man in die drei Hauptgruppen Sedimentgesteine (nicht Sedimente),
magmatische Gesteine und metamorphe Gesteine ein. Die Verf. schreiben
zwar richtigerweise, es gäbe zwei Arten von Feldspat, unterteilen dann
aber in Plagioklas (Albit und Anorthit) und Kalifeldspat. Nicht
berücksichtigt wird also die Mischkristallbildung zwischen
Kalifeldspat und Albit zu den Alkalifeldspäten. Bei der Berechnung der
dunklen Minerale in einem Gestein zählt man nicht nur den Biotit zu
den dunklen Mineralen, sondern auch den hellen Glimmer Muskovit. Im
Unterkapitel über Die Verteilung saurer und basischer Vulkane wird die
Plattentektonik recht ausführlich beschrieben. Hier vermißt der Leser
den weltweit häufig zu findenden Vulkanismus an
Kontinentalrändern. Die Entstehung und das Auftreten von sauren,
intermediären und basischen Gesteinen ist sehr stark vereinfacht
dargestellt. Mancherorts führte diese Vereinfachung zu sachlichen
Fehlern, wie Rhyolith ist noch gefährlicher als Andesit. Die
Verf. meinen damit natürlich nicht die Gesteine, sondern ihre
Schmelzen und die damit verbundenen Ausbruchsmechanismen.
Im 4. Kapitel wird die geologische Entwicklung Skandinaviens eingehend
beschrieben. Die geologische Karte von Südskandinavien ist sehr
übersichtlich und informativ. Rekonstruktionen der bekanntesten Tiere,
die während des Altpaläozoikums im Ostseeraum gelebt haben (Seelilien,
Orthoceras und Endoceras) lockern die ausführliche Beschreibung der
geologischen Entwicklung Skandinaviens auf.
Das 5. Kapitel beschäftigt sich mit der Frage Wie kamen die Steine
nach Norddeutschland? Die einzig sinnvolle Erklärung mit dem Inlandeis
findet sich eingehend beschrieben, gleichfalls das Eiszeitalter
(Quartär) und die Eisvorstöße der Menap-, Elster-, Saale- und
Weichsel-Kaltzeiten aus dem Norden. Danach gehen die Autoren eingehend
auf Leitgeschiebe, ihre Herkunft und auf die Geschiebezählung ein. Als
ergänzendes Begleitmaterial dienen die vereinfachten, aber recht
übersichtlichen Karten über die Herkunftsgebiete der nordischen
Leitgeschiebe.
Das 6. Kapitel behandelt einige Besonderheiten, die man an
Strandgeröllen oder Steinen aus Kiesgruben erkennen kann und in den
vorherigen Kapiteln keinen Platz gefunden haben: a) von gekochtem
Granit und Porphyr; b) die Erstarrung eines Magmas; c) Gneis und
andere metamorphe Gesteine; d) eine Brekzie; e) dichte Gesteine; f)
Sedimentgesteine und Flint; g) Pflastersteine. Unter a) erfährt der
Leser am Beispiel der Granite und Porphyre aus Dalarna etwas über die
Bildung von Epidot und Chlorit aus der Reaktion von heißen wässrigen
Lösungen mit dem Nebengestein. Im Unterkapitel b) gehen die Verfasser
auf die Entstehung der graphischen Textur, auf die Bildung von zonar
aufgebauten Rapakivi-Graniten sowie auf Xenolithe und Pegmatite
ein. In c) werden Augengneis, Bänder- und Schlierengneis, Adergneis
und Migmatit unterschieden. In einem eigenen Unterkapitel (d) geht man
unverständlicherweise auf die Brekzienbildung ein, vermutet man diese
jedoch sinnvollerweise unter (f) Sedimentgesteinen. Als dicht (e)
werden folgende Gesteine unterschieden: Flint, dichte oder glasartige
Lava, Hornfels, Helleflinta und Mylonit sowie Ignimbrit und dichter
Kalkstein. Danach folgt Unterkapitel (f) mit Sedimentgesteinen wie
Kalkstein, Sandstein und Flint. Das letzte Unterkapitel beschäftigt
sich mit Pflaster- und Kantsteinen wie dem Rønne-Granit,
Bohuslän-Granit, Vånga-Granit oder dem Larvikit.
Im 7. Kapitel lernt auch der Nichtfachmann mithilfe eines einfachen
Schlüssels nicht nur die Gesteine in Moränen petrographisch
anzusprechen, sondern auch von etwa einem Viertel aller Granite und
der Mehrzahl der Porphyre die Herkunft zu bestimmen. Die
Vorgehensweise ist folgendermaßen: Zuerst klärt man, ob das zu
bestimmende Gestein ein Magmatit, Metamorphit oder Sedimentgestein
ist. Die beiden letzteren lassen sich direkt in den entsprechenden
Farbtafeln finden. Am umfangreichsten sind die Farbtafeln der
Magmatite. Hier lassen sich die Porphyre anhand verschiedener Merkmale
unterscheiden: a) Läßt sich ein ignimbritisches Gefüge erkennen? b)
Sind Einsprenglinge von Quarz, Feldspäten oder Olivin vorhanden? c)
Welche Farbe hat die Grundmasse? usw. Eine weitere einfache Übersicht
ermöglicht die Unterscheidung von Graniten: 1) Granite mit auffälligen
Quarzfarben, 2) Granite mit Einsprenglingen, 3) Granite mit großen
Kalifeldspäten (bis >4 cm), 4) fein- und gleichkörnige Granite, 5)
schwarzweiße und schwarz-grau-weiße Granite und 6) Granit-Einteilung
nach der Feldspat-Zusammensetzung.
Darauf folgen 34 Farbtafeln nebst ausführlichen
Gesteinsbeschreibungen, untergliedert nach den verschiedenen
Herkunftsorten der Gesteine. Auf den Tafeln 1-12 sind Vulkanite zu
finden, auf den Tafeln 13-25 Plutonite, auf den Tafeln 25-27
Metamorphite, auf den Tafeln 27-33 Sedimentgesteine und auf den Tafeln
33-34 Gesteine vom finnischen Festland.
Eine Übersicht über Makrofotos zum Studium der Granitminerale gewährt
eine weitere, aber unnummerierte Farbtafel. Die darauf zu findenden
Abbildungsnummern reichen unverständlicherweise von 78 bis 82. Die
Textabbildungen enden mit der Abb. 67, die Abbildungsnummern der
Gesteine auf den Farbtafeln mit Nr. 157.
Im Anhang werden dem Leser als sinnvolle Ergänzung die im Buch
erwähnten Minerale nebst ihren äußeren Kennzeichen und chemischen
Formeln nähergebracht. Eine Auflistung der Gesteinsfotografen sowie
der Eigentümer der abgebildeten Gesteine, ein zweigeteiltes, sehr
aktuelles Literaturverzeichnis (1. leicht zugängliche Bücher über
Gesteine und 2. Fachliteratur zum Thema Leitgeschiebe) und ein
übersichtliches Register vervollständigen das Buch.
Die vorliegende 2. Auflage enthält gegenüber der vorhergehenden eine
Reihe von neuen Abbildungen und Verbesserungen. Leider sind aber immer
noch nicht alle Unkorrektheiten beseitigt worden, besonders in den
Kapiteln 2 bis 6.
Die kurz gehaltenen, einprägsamen Ausführungen zur Geologie,
Glaziologie und Geschiebekunde machen dem Gesteinssammler Mut, sich in
diese nicht immer leicht verständliche Thematik einzuarbeiten. Die im
Text zu findenden Abbildungen und Karten sind gut gemacht und sehr
illustrativ. Die qualitativ zumeist ausgezeichneten Gesteinsfotos auf
den Farbtafeln einschließlich deren Beschreibung ermöglichen es auch
dem Laien, typische Leitgeschiebe zu identifizieren.
Der Besitz dieses Buches ist für jeden Geschiebesammler ein absolutes
Muss, stellt es doch im deutschsprachigen Raum das einzige, so
ausführliche und mit originalgetreuen Gesteinsfotos versehene Werk
über eiszeitliche Geschiebe dar. Hoffentlich verbessert man deshalb
die noch vorhandenen Fehler in der nächsten Auflage!
C. Schmitt-Riegraf
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie, Jg. 2002, Heft 5-6