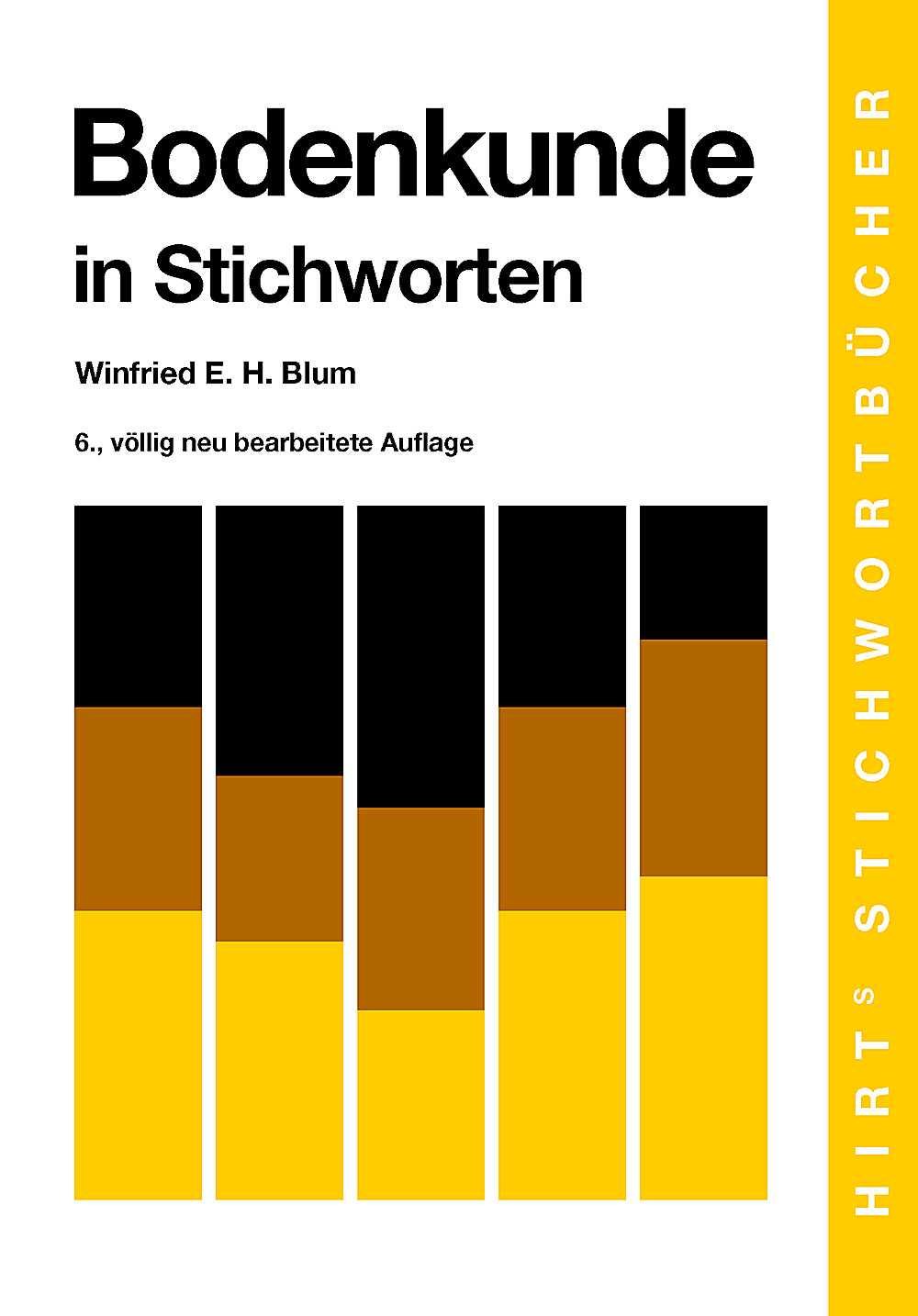Das kleine Lehrbuch gehört seit mehr als 30 Jahren zur
geowissenschaftlichen Standardliteratur an Universitäten,
Fachhochschulen, Schulen und weiteren Bildungsstätten. Besonders bei
Studierenden ist das Werk als Kompendium für die Prüfungsvorbereitung
sehr geschätzt. Die "Bodenkunde in Stichworten" wurde 1969 von Prof.
Diedrich Schröder (Kiel) konzipiert und bis zu seinem Tode 1988
ständig aktualisiert. Danach übernahm Prof. Winfried E. H. Blum (Wien)
diese verdienstvolle Aufgabe. So brachte er 1992 die 5. ergänzte und
erweiterte Auflage heraus. Inzwischen ist das Wissen über Böden und
insbesondere ihre Funktionen für Umwelt und menschliche Gesellschaft
kontinuierlich angestiegen. Dadurch ist die Notwendigkeit gewachsen,
das Lehrbuch neu zu schreiben. Einige Teile der früheren Ausgabe
wurden nach gründlicher Überarbeitung übernommen.
Das Buch ist insgesamt neu gegliedert und im Bereich der
Bodensystematik und -klassifikation dem aktuellen nationalen und
internationalen Kenntnisstand angepasst. So enthält die neue Ausgabe
in Kap. 5.1 eine Übersicht über das Klassifikationssystem der
Bundesrepublik Deutschland (AK Bodensystematik, 1998; KA5:
Ad-hoc-Arbeitsgruppe Boden, 2005) und auch die Österreichische
Bodensystematik (Nestroy et al., 2000). Neben einer kurzen Übersicht
über die US Soil Taxonomy (1999) wird die aktuelle internationale
Bodensystematik World Reference Base for Soil Resources (WRB)
dargestellt und kurz erläutert. Kapitel 5.2 ist den Böden Europas
gewidmet, wobei naturgemäß die Böden Mitteleuropas besonders
berücksichtigt sind. Die Gliederung erfolgt hier nach dem
Klassifikationssystem der Bundesrepublik Deutschland. Es werden die
wichtigsten Bodentypen, z. T. mit Subtypen, ohne Übergangsformen,
behandelt. Zusätzlich zu den Typennamen in deutscher Sprache werden
auch Bodenbezeichnungen nach WRB und US Soil Taxonomy angegeben, wobei
aber darauf hingewiesen wird, dass aufgrund der Verschiedenheit der
Systeme eine genaue Korrelation nicht immer möglich ist.
In Kap. 6 (Boden in der Umwelt) wurde die neue Europäische
Bodenschutz-Strategie, an der der Autor bekanntlich selbst maßgeblich
mitgewirkt hat, berücksichtigt. Kapitel 7 (Boden als Pflanzenstandort)
ist trotz seiner Kürze eine gelungene Synthese von Bodenökologie und
Pflanzenernährung und schlägt gerade für Studierende eine didaktisch
geschickte Brücke zwischen Bodenkunde und angewandten Fächern wie
Pflanzen-, Garten- oder Waldbau. Ausführlicher als bisher sind die
Boden-Informationssysteme (Kap. 8) sowie die Geschichte der Bodenkunde
(Kap. 9) dargestellt. Die Zusammenstellung relevanter Literatur wurde
aktualisiert, wobei die Auswahl als sehr gelungen gelten kann. Denn
gerade dem Anfänger erleichtert die Beschränkung auf das Wesentliche
den Einstieg.
Inhaltlich wurden Diskrepanzen zwischen den noch in der 5. Auflage
verwendeten Schroeder’schen Horizontbezeichnungen (z. B. E für
Eluvialhorizont, ox für residuale Anreicherung von Oxiden in
Latosolen) und den modernen Bezeichnungen der KA5 bereinigt. Hilfreich
sind auch die Hinweise auf die in Deutschland und Österreich
unterschiedlich benutzten Bezeichnungen. Allerdings sind in den Abb.
46, 47 und 48 (Chrono-, Klima- bzw. Reliefsequenzen von Böden) immer
noch die alten Schroeder’schen Horizontbezeichnungen vorhanden (z.B.
Afo, Et, Eh, Bfe,al). Gleiches gilt für die Farbtafel auf der rechten
Umschlaginnenseite, wo bei einigen Bodenprofilen (Roter Latosol,
Eu-Gley) versäumt wurde, die Typbezeichnungen zu aktualisieren. Solche
Inkonsistenzen sind gerade für Anfänger verwirrend und sollten bei der
nächsten Überarbeitung unbedingt bereinigt werden. Überlegenswert wäre
auch, bei den Bodenprofilen in den Farbtafeln die jeweiligen
WRB-Bodentypen mit anzugeben. Die Schreibweise für Zusatzbuchstaben
für spezifische Merkmale sollte künftig vereinheitlicht werden;
teilweise ist noch die früher übliche Tiefstellung vorhanden.
Bei der Darstellung der Humusformen (2.2.5) fehlen sowohl im Text als
auch in Abb. 24 Bezüge zur Podsolierung und entsprechende Querverweise
zum Bodentyp Podsol unter 5.2. Podsolierungsvorgänge (bzw. die sie
bedingenden Mobilisierungs- und Translokationsprozesse) setzen im
humiden Klima gewöhnlich beim Übergang von Moder zu Rohhumus ein. Im
Resultat ist dann - zumindest bei Rohhumus - im mineralischen
Oberboden meist eine deutliche Bleichung erkennbar. Diese
Zusammenhänge sollten deshalb durch Angabe eines Ae- bzw.
Ahe-Horizonts deutlich gemacht werden.
Das bewährte Layout der "Bodenkunde in Stichworten" wurde weiter
verbessert. Allerdings wäre bei einigen Abbildungen eine graphische
Überarbeitung vorteilhaft gewesen. So ist z. B. Abb. 45 nur undeutlich
erkennbar. Sehr lobenswert ist, dass jetzt auch einige vierfarbige
Abbildungen (z. B. Abb. 28: Körnungsdreieck nach KA5) hinzugenommen
wurden. Dies ist hilfreich und trägt sicherlich auch zur Attraktivität
der Neuauflage bei. Leider sind aber gerade die Farbabbildungen häufig
etwas unscharf geraten, was ihren Gebrauchswert mindert.
Das neu bearbeitete Werk reiht sich wiederum als "Schmuckstück" in
die traditionelle Reihe von Hirts Stichwortbüchern ein, die in
konzentrierter Form umfangreiches Wissen vermitteln wollen.
Übersichtliche Gliederung und ausführliche Register ermöglichen dem
Leser das Selbststudium wie auch ein leichtes Nachschlagen von
grundlegenden Informationen. Zahlreiche Karten, graphische
Darstellungen und Tabellen ergänzen und veranschaulichen den Text in
idealer Weise. Das kleine Buch wird sicherlich wieder sehr stark
nachgefragt sein, denn die jetzt vorliegende Neubearbeitung ist dem
Autor insgesamt sehr gelungen.
K. H. Feger, Tharandt/Dresden
erschienen in: Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2007,
Wiley-VCH, Weinheim, Vol. 170, S. 699.