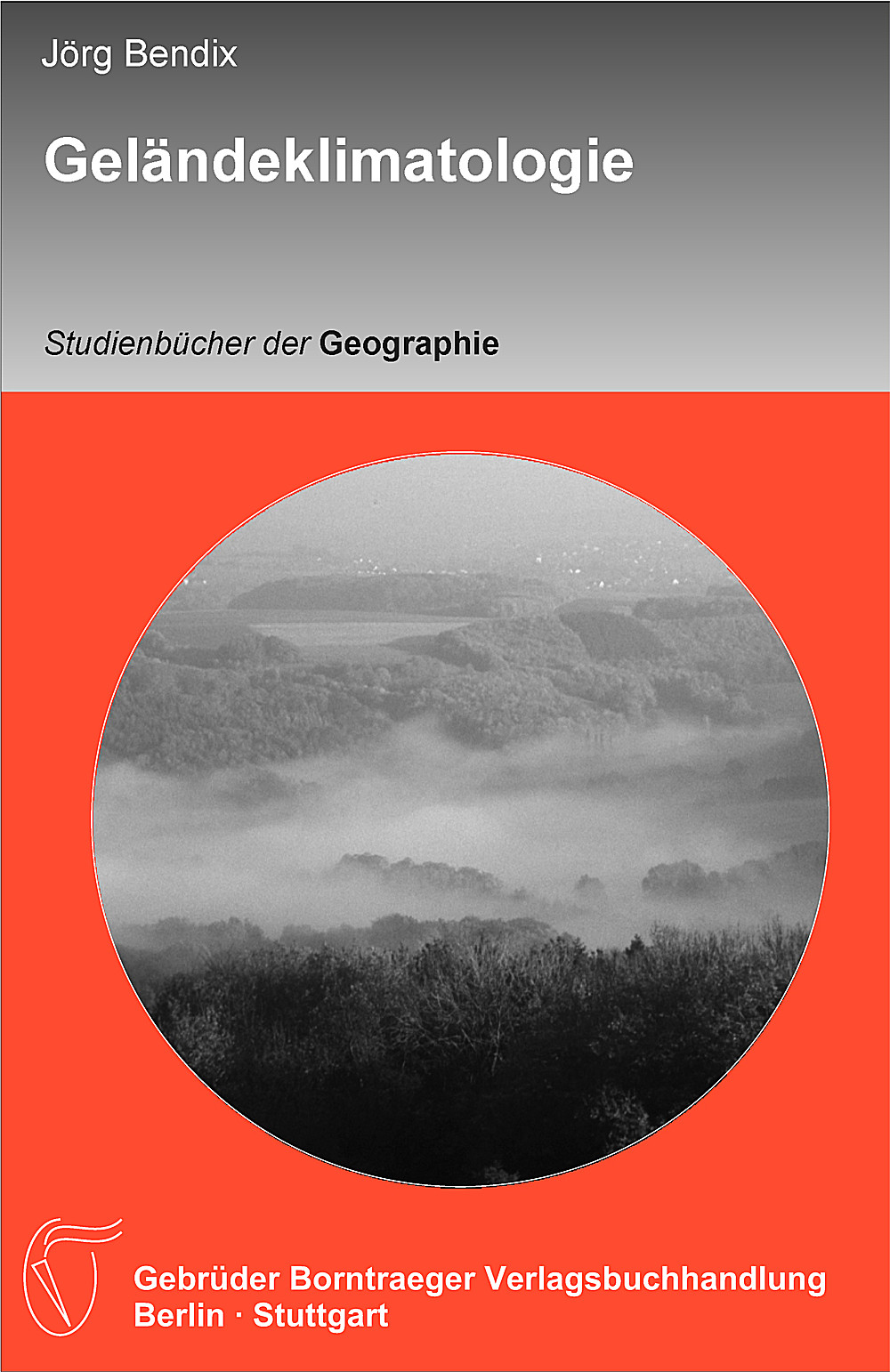Für in der Umweltplanung tätige Personen sind profunde Kenntnisse über
mesoskalige meteorologische Prozesse und Phänomene eine unverzichtbare
Voraussetzung, um die Auswirkungen von Landschaftseingriffen auf das
regionale Klima beurteilen zu können. Eine anwenderbezogene
Zusammenstellung des aktuellen Wissensstandes ist aber in deutscher
Sprache derzeit nicht verfügbar. Diese Lücke versucht das vorliegende
Buch zu schließen. Es befasst sich mit den regionalen und lokalen
Modifikationen des Großklimas, die sich aufgrund der räumlich
variablen Topographie und/oder der wechselnden
Oberflächenbeschaffenheit der Erde ausbilden. Es werden solche
Phänomene behandelt, die in den Bereich der Mikro-ß bis Meso-ß Skala
fallen und die sich in der vertikalen Dimension über den Bereich der
atmosphärischen Grenzschicht erstrecken. Der Autor spricht dabei in
erster Linie Studierende und Lehrende der Fachrichtungen Geographie,
Ökologie und Geoökologie an. Daher liegt der Schwerpunkt der
Darstellung auf einer Beschreibung der entsprechenden Prozesse und
Phänomene, die das mesoskalige Klima bestimmen sowie auf der
Bereitstellung von Formeln, die zur Abschätzung der Größenordnung
einzelner Klimaelemente dienen. Auf eine ausführliche Erörterung der
Theorie, die den einzelnen Prozessen zugrunde liegt, wird bewusst
verzichtet und auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen.
In einem einleitenden Teil werden zunächst der Begriff der
Geländeklimatologie definiert und die Raum- und Zeitskalen festgelegt,
die durch die Geländeklimatologie abgedeckt werden. Dabei wird auch
auf die teils unterschiedlichen Betrachtungsweisen eingegangen, die in
der Geographie und Meteorologie vorherrschen. Es schließt sich, weil
Geländeklima im Wesentlichen ein Phänomen der Grenzschicht ist, eine
Übersicht über deren Aufbau, ihre zeitlichen Entwicklung und räumliche
Variation an.
Der Hauptteil des Buches ist in zwei Themenkreise gegliedert: Im
ersten Themenkreis wird beschrieben, wie sich ein Geländeklima
aufgrund der ortsspezifischen Klimafaktoren ausbildet. Im zweiten wird
auf die Methoden eingegangen, die in der Geländeklimatologie zum
Einsatz kommen.
Da für die Ausbildung des lokalen bzw. regionalen Klimas die Umsetzung
der Nettostrahlung an der Erdoberfläche in den Bodenwärmestrom, den
fühlbaren und latenten Wärmestrom entscheidend ist, werden in den
Kapiteln 3 (Gelände und Strahlungsbilanz) und 4 (Gelände und
Wärmebilanz) die Einflüsse der Klimafaktoren auf die Strahlungs- und
Energiebilanz erörtert. Dabei räumt der Autor der Darstellung des
Geländeeinflusses auf die Strahlungsbilanzkomponenten einen besonders
breiten Raum ein. Der Einfluss der Klimafaktoren auf die
Energieumsetzung an der Erdoberfläche wird anhand von typischen Tages-
bzw. Jahresgängen der Energiebilanzkomponenten für verschiedene
Oberflächentypen dokumentiert.
Es folgt die Diskussion der verschiedenen Klimaelemente, angefangen
bei der Temperatur (Kapitel 5). Meines Erachtens wäre es allerdings
sinnvoller und übersichtlicher gewesen, in diesem Kapitel die
Gleichung aus Anhang 9 (Grundlegende Modellgleichungen) zur
Beschreibung der lokalzeitlichen Änderung der Temperatur zu
verwenden. Einen weiteren Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die
Beschreibung der Entwicklung der Grenzschichttemperatur und die der
Temperaturinversion. Da letztere eng mit der Mischungsschichthöhe
(Kapitel 2) verknüpft ist, wäre es auch möglich gewesen, zumindest die
Ausführungen über die Grenzschichtentwicklung über komplexem Gelände
hier aufzunehmen, da einige Voraussetzung zum Verständnis der
Grenzschichtentwicklung auch erst hier bereitgestellt werden.
In Kapitel 6 werden die Auswirkungen der Landoberflächenbeschaffenheit
und die der Geländegestalt auf die Verdunstung und daraus resultierend
auf die Feuchte in der Grenzschicht beschrieben. Hier wäre die
Einführung der Haushaltsgleichung für die Feuchte oder ein Verweis auf
die entsprechende Gleichung in Anhang 9 angebracht gewesen, um die
verschiedenen Prozesse einfacher nachvollziehen zu können. Es folgen
Ausführungen über den Einfluss des Geländes auf die Wolken- und
Niederschlagsbildung (Kapitel 7), mit einer ausführlichen Beschreibung
der Nebelbildung. Die thermischen und dynamischen Effekte des Reliefs
auf die Wolkenbildung und den Niederschlag werden anhand vieler
schematischer Darstellungen erläutert.
Den Abschluss dieses ersten Themenkreises bildet eine sehr
ausführliche Beschreibung der mesoskaligen Windsysteme - angefangen
bei den thermisch induzierten Windsystemen bis hin zu den
Auswirkungen, die die Schichtungsstabilität in Verbindung mit
Hindernissen auf die Strömung hat. Die verschiedenen Phänomene werden
auch hier anhand vieler anschaulicher Beispiele beschrieben und
Formeln zur Abschätzung der Stärke des Seewindes oder des Hangauf-
bzw. Hangabwindes bereitgestellt.
Der zweite Themenkreis, der die Methoden des Geländeklimas beschreibt,
enthält die Abschnitte: direkte bodengebundene Messsysteme, indirekte
bodengebundene Messsysteme, indirekte Profilmessungen, Methoden der
Weiterverarbeitung und numerische Simulationsmodelle. Direkte und
indirekte bodengebundenen Methoden umfassen die gebräuchlichsten und
wichtigsten Verfahren zur Messung der vorher erwähnten
Klimaelemente. Im Abschnitt über indirekte Profilmessungen werden die
Messprinzipien der inzwischen häufig eingesetzten Messsysteme zur
Sichtweite (Ceilometer), des Windes (SODAR, RADAR), der Temperatur
(RASS) und der Feuchte (DIAL) kurz aber klar und verständlich
erklärt. Es fehlt höchstens ein Hinweis darauf, dass derzeit fast nur
noch "phased array"-SODARs verwendet werden. Etwas zu kurz fällt
die abschließende Beschreibung der mesoskaligen und der SVAT-Modelle
aus.
Insgesamt kann gesagt werden, dass das Buch von Jörg Bendix eine
sinnvolle Ergänzung der Literatur darstellt, die sich mit
meteorologischer Anwendung beschäftigt, auch wenn es einige
Überlappungsbereiche mit der "Angewandten Meteorologie" von Foken
gibt. Es bildet eine gute und übersichtliche Darstellung der
relevanten mesoskaligen Phänomene, die bei umweltrelevanten
Fragestellungen in Betracht zu ziehen sind. Das Buch zeichnet sich
darüber hinaus durch einen didaktisch gelungenen Aufbau, eine Fülle
hervorragender - teils überarbeiteter - Darstellungen zu den
verschiedenen mesoskaligen Phänomenen und eine i. a. adäquate
Beschreibung der Phänomene und Prozesse aus. Es ist damit für die
Zielgruppen der Ökologen, Geographen, Geoökologen und Anwender, aber
auch für Meteorologen, als Einstieg zum Verständnis mesoskaliger
Phänomene, fast ohne Einschränkungen zu empfehlen. In einigen Fällen
wäre allerdings eine Beschreibung der Phänomene anhand von Gleichungen
einfacher und verständlicher gewesen. Außerdem ist für die Anwendungen
einiger Formeln auf konkrete Fragestellungen die Hinzuziehung der
angegebenen Originalliteratur unerlässlich, da der Anwendungsbereich
und die notwendigen Voraussetzungen nicht genannt werden. Dies sei an
einigen Beispielen belegt: So wird in Kapitel 4 darauf hingewiesen,
dass die Berechnung des fühlbaren Wärmestroms im Fall freier
Konvektion anders als bei labiler Schichtung erfolgen sollte. Es fehlt
allerdings die Angabe über den konkreten Anwendungsbereich der
einzelnen Formeln. Des Weiteren wird in Kapitel 5 eine prognostische
Gleichung für die Grenzschichtentwicklung aufgeführt. Hinweise, welche
Prozesse die Konstanten bestimmen, die in der Formel enthalten sind,
werden nicht gemacht. In Kapitel 7 wird eine Formel für den
Bildungszeitpunkt von Strahlungsnebel angegeben. In die Berechnung
geht der Vertikalwind ein. Es wird allerdings nicht gesagt, für welche
Höhe die Angabe notwendig ist. Da der Vertikalwind außerdem
messtechnisch nahezu nicht erfassbar ist, wäre eine zusätzliche
Information sinnvoll gewesen, woher die entsprechenden Angaben zu
beziehen sind. Als letztes Beispiel sei die Berechnung der Stärke des
Hangaufwindes genannt. Dazu sind Angaben über den relativen
Wärmeverlust an die Talluft notwendig, auf die nicht eingegangen
wird. Das heißt, in einigen Fällen wären eine ausführlichere
Diskussion der genannten Berechnungsverfahren sowie eine bessere
Einbindung in die Textumgebung notwendig gewesen.
Bei der Zusammenstellung weiterführender Literatur fehlt
m.E. zumindest die Arbeit von Atkinson (Meso-scale atmospheric
circulations), die etliche der hier beschriebenen Phänomene noch
intensiver abhandelt. Die genannten Schwächen schmälern aber in keiner
Weise das insgesamt positive Gesamtbild des Buches.
N. Kalthoff, Karlsruhe
Meteorologische Zeitschrift Vol. 14 No. 3