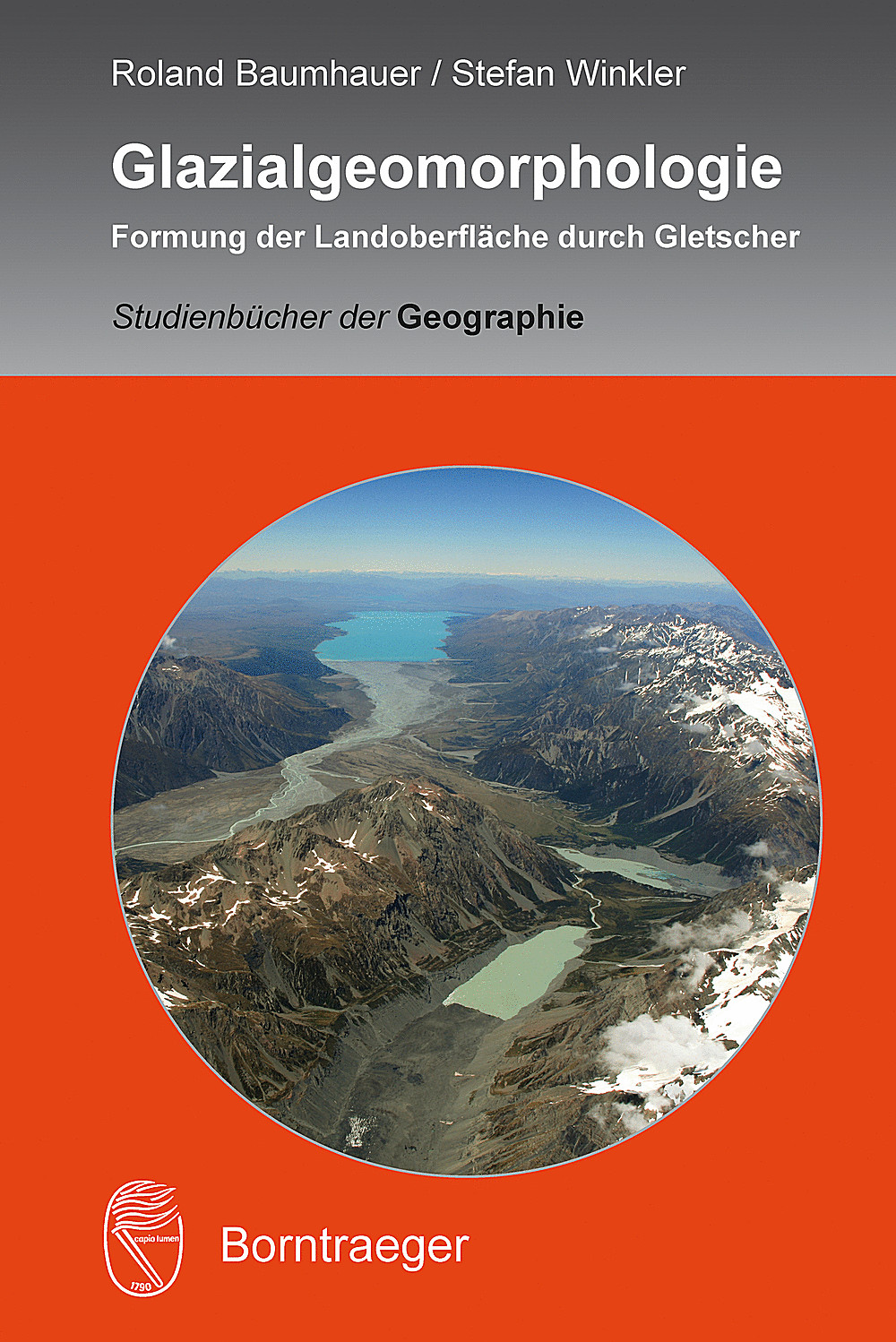Wenn man als Bodenkundler das Buch Glazialgeomorphologie von Roland
Baumhauer und Stefan Winkler ernst nehmen würde, müsste man sich von
vielen lieb gewonnenen Vorstellungen und Begrifflichkeiten
trennen. Vertraute Konzepte von der „glazialen Serie“ und
„Stauchendmoräne“ werden da ebenso in Zweifel gezogen wie die Begriffe
„Grundmoräne“ und „Geschiebe“. In ihrem Studienbuch der Geografie
versuchen die beiden Autoren einen Spagat zwischen einem
deutschsprachigen Lehrbuch und einer Reflektion, die den aktuellen
internationalen Forschungsstand auf diesem Gebiet wiedergibt. Sie
haben dem Buch eine sehr klare Struktur gegeben.
Im ersten Kapitel wird die Kryosphäre in ihrer räumlichen und
zeitlichen Entwicklung dargestellt. Dabei halten sich die Autoren
nicht lange mit prosaischen Beschreibungen von der Faszination der
Gletscher und massiver Eisschilde auf, sondern überhäufen den Leser
auf der ersten halben Seite mit Definitionen von Fachbegriffen:
Landeis, Meereis, sedimentäres Eis, magmatisches Eis, Injektionseis,
Segregationseis, Aggregationseis, Poreneis, Intrusiveis, Eislinsen,
Kammeis, Nadeleis, Eiskeile und Permafrost. Wer an dieser Stelle das
Buch nicht schon weggelegt hat, wird mit einer ausführlichen und
verständlichen Darstellung der komplexen Wechselwirkungen zwischen
Klima, Meeresströmungen und Eisdynamik auf der Basis aktueller
Literatur belohnt. Dabei gelingt den Autoren – wie auch an vielen
anderen Stellen – eine gute Balance zwischen Übersichtlichkeit und den
für das Verständnis wichtigen Details.
Das zweite Kapitel beschreibt die „Glaziologischen Grundlagen der
Glazialgeomorphologie“. In knapper, aber übersichtlicher Form werden
die Dynamik von Gletschern mit ihren physikalischen Eigenschaften und
die wichtigen Gletschertypen dargestellt. Wichtig für das weitere
Verständnis ist an dieser Stelle die Beschreibung glazialer
Debris-Kaskaden. In Kapitel zwei zeigt sich allerdings auch, dass die
Anschaulichkeit der im ganzen Buch vorherrschenden
Schwarz-Weiß-Darstellungen begrenzt ist. Insbesondere die mit viel
Sorgfalt ausgesuchten, überwiegend von Stefan Winkler selbst gemachten
Fotos wirken als Schwarz-Weiß-Aufnahmen teilweise unverständlich und
antiquiert. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Verlag nicht, wie
in aktuellen Lehrbüchern üblich, ein neues Buch mit hochwertigen
Farbfotos ausstattet.
Kapitel drei beginnt mit einer ausführlichen Definition und Begründung
der verwendeten Begriffe. Die Neudefinitionen orientieren sich dabei
an der aktuellen englischsprachigen Literatur. Dabei wird von den
Autoren nahegelegt, beispielsweise auf die Begriffe Stauchendmoräne,
Geschiebe, glaziär oder glazigen zu verzichten. Die Umbenennungen sind
teilweise gut begründet und fundiert, da sich der Stand der
Erkenntnisse weiterentwickelt hat, teilweise wirken sie aber auch
etwas gewollt.
Den Hauptteil des Buches macht das vierte Kapitel aus, in dem die
glazialen Oberflächenformen gegliedert nach ihrer Größe (Mikro-, Meso-
bzw. Makroformen) dargestellt werden. Dabei wird viel Wert auf den
aktuellen Wissensstand sowie die Neudefinitionen der Begrifflichkeiten
gelegt. Die Autoren verfolgen dabei auch hier ganz konsequent das
Konzept, die in der aktuellen Literatur üblichen englischen
Fachbegriffe auch im Deutschen zu verwenden. Statt „Stauchendmoräne“
sprechen sie von „push moraines“ oder „thrust moraines“, statt
„Ausschmelzen“ wird „melt out“ benutzt, statt „Absetzen“
„lodgement“. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist die Nähe zur
aktuellen Literatur, die die Autoren sehr klar, übersichtlich und
informativ darstellen. Dies ist sicherlich einer der größten Vorzüge
dieses Buches. Es ist insbesondere in Kapitel 4 teilweise mehr ein
Review des aktuellen Wissensstandes als ein Lehrbuch. Sehr informativ,
aber teilweise mit zu wenig Erläuterungen und anschaulichen
Darstellungen grundlegender Zusammenhänge. Aus der gehäuften
Verwendung von Anglizismen resultiert eine schlechte Lesbarkeit, weil
der Sprachfluss immer wieder unterbrochen wird.
Das Buch eignet sich aus meiner Sicht nicht als Einführung in das
Themengebiet. Zu diesem Zweck lassen sich allgemeine Lehrbücher der
Geomorphologie besser verwenden. Es liefert aber sehr gute Übersichten
der Forschung in den einzelnen Themenschwerpunkten und eignet sich
daher vor allem zur Vertiefung. Ob sich das von den Autoren
vorgeschlagene glazialgeomorphologische Vokabular im deutschsprachigen
Raum durchsetzen wird und ob wir als Bodenkundler und
Standortkartierer demnächst unsere gewohnten Begrifflichkeiten
aufgeben und umlernen müssen, wird die weitere Auseinandersetzung um
das Thema zeigen.
Martin Jansen, Göttingen
forstarchiv 86. Jg. (4), Juli/August 2015, Seite 118