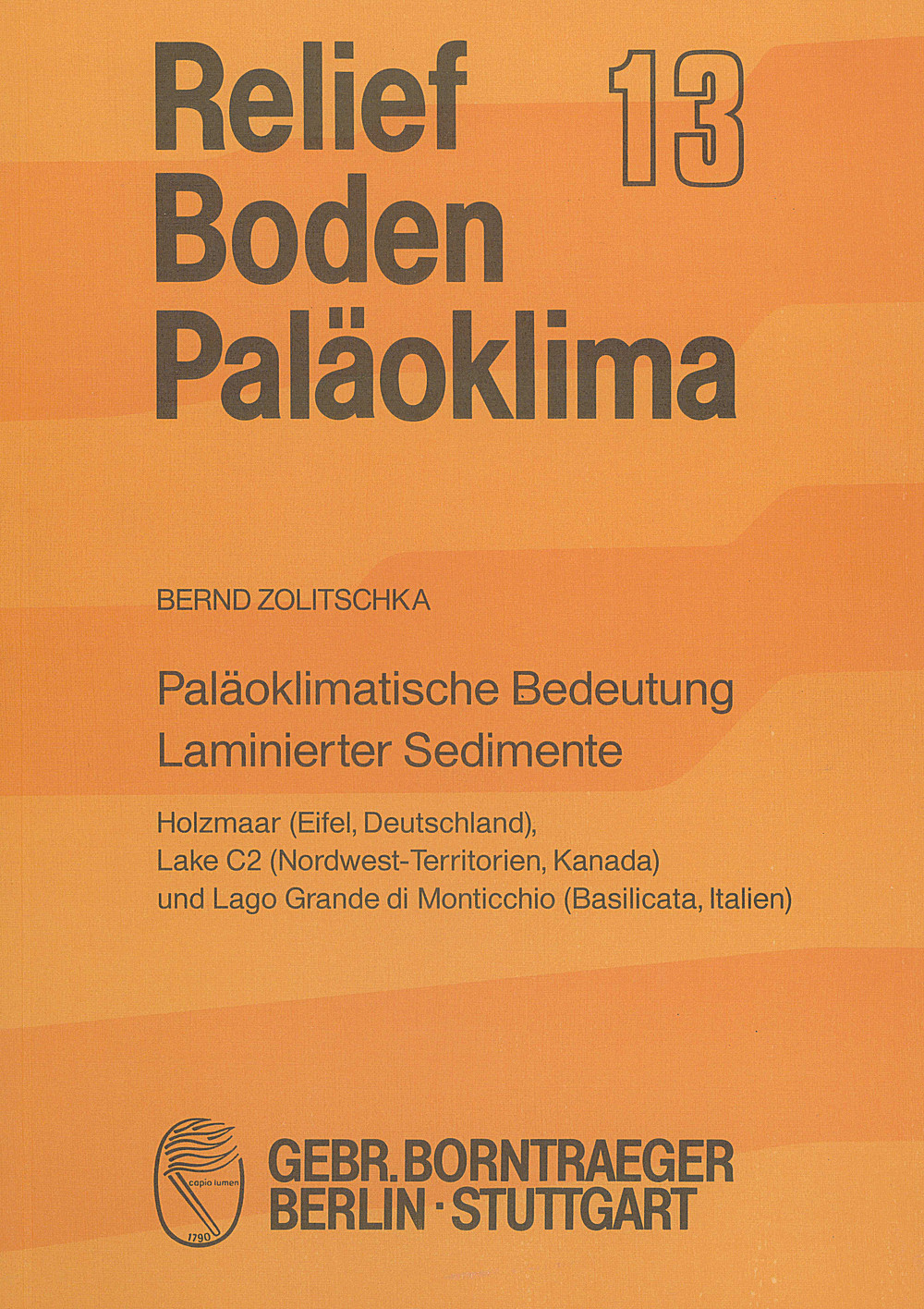Diese 1996 von der Universität Potsdam angenommene
Habilitationsschrift thematisiert die Nutzung jährlich laminierter
Seesedimente als Proxy-Daten für die Rekonstruktion des
Paläoklimas. Dazu untersucht der Autor drei Seen: den die letzten
2000 Jahre umfassenden Lake C2 in der hohen Arktis Nordkanadas, das in
der Eifel gelegene Holzmaar mit seinem Archiv von 23000 Jahren und den
mediterranen Lago Grande di Monticchio in Süditalien, dessen Sedimente
mehr als 75 000 Jahre zurückreichen. Herr ZOLITSCHKA legt damit eine
Arbeit vor, die nicht nur den State-of-the-Art bezüglich der
Seenforschung wiedergibt, sondern auf dem Gebiet der Rekonstruktion
des Paläoklimas aus warvierten Sedimenten Neuland betritt. Da die Seen
nach einem einheitlichen Schema untersucht werden, verliert man beim
Lesen nie den roten Faden: Der Beschreibung allgemeiner
Charakteristika nebst Lithologie folgen jeweils einschlägige
Ausführungen zur Chronologie. Dabei stehen naturgemäß die
Warvenchronologie und ihre Kontrolle durch unabhängige Methoden (14C,
210Pb-, 137CS-, Ar/Ar-Datierungen, Pollenzonierung, Tephrochronologie)
sowie eine Diskussion dieser Altersbestimmungen im Zentrum der
Betrachtung. Schließlich werden die Sedimente physikalisch und
geochemisch analysiert. Eine ausführliche Interpretation zur
Entwicklungsgeschichte der Seen und zur paläoklimatischen Aussagekraft
ihrer Sedimente schließt sich an. Je nach Ergiebigkeit des jeweiligen
Archivs werden dabei die unterschiedlichen Zeitabschnitte so
detailgenau wie möglich untersucht.
An den Sedimenten des Holzmaars (Kap. 3, S. 11-76) gelingt es
B. ZOLITSCHKA erstmals, durch die Synchronisation der Holzmaar-Daten
mit stabilen Isotopen-Daten der süddeutschen Kiefern-Chronologie beide
Archive zu parallelisieren und damit die Pollenzonen-Grenzen auf die
Dendrochronologie zu übertragen. Außerdem weist er überzeugend nach,
daß jahreszeitlich geschichtete Sedimente ein großes Potential
besitzen, um die Kalibration der Radiokohlenstoffmethode über den
durch die Dendrochronologie abgedeckten Zeitraum hinaus fortzusetzen
(S. 29). Ein so hochauflösendes Archiv macht zudem den Vergleich von
Sedimentationsraten der letzten 8000 Jahre mit archäologisch und
historisch bekannten Besiedlungsphasen möglich (vgl. Abb.29). Dabei
wägt der Autor kenntnisreich die beiden steuernden Faktoren Klima und
Mensch gegeneinander ab. Das Archiv erlaubt sogar eine
paläoklimatische Detailanalyse (Kap.3.5.2). Dafür zieht der Verfasser
zunächst die letzten 40 Jahre zu Rate, weil hierüber exakte Messungen
der Klimaparameter vorliegen. Durch Extrapolation ist es ihm dann
möglich, wärmere und kältere Abschnitte voneinander abzugrenzen. So
läßt sich etwa die "Kleine Eiszeit" identifizieren. Interessant ist
auch der Nachweis solarterrestrischer Beziehungen im System
Klima-Sediment (S.59f.): Die Warvendicken spiegeln sowohl den
11-jährigen Sonnenfleckenzyklus als auch eine Reihe von planetaren
Frequenzen wider. Die Sedimente des Holzmaars lassen sich mit weiteren
hochauflösenden Paläo-Umwelt-Archiven parallelisieren, z. B. mit
anderen europäischen Seesedimenten, Baumringdaten, grönländischen
Eiskernen und marinen Sedimenten aus dem Nordatlantik (S.60 ff.). Die
hierüber geführte Diskussion ist auf höchstem wissenschaftlichen
Niveau. Dabei wird die Arbeit von Herrn ZOLITSCHKA zu einer Fundgrube
hinsichtlich der Diskussion über die Zeitabschnitte Jüngere Dryas und
frühes Holozän. Besonders ideenreich sind die Erörterungen zur
zeitlichen Stellung der Laacher See Tephra mit einem Alter von 12.940
VT (Warvenjahre) (S.31). Die fundierten Ausführungen zur Jüngere
Dryaszeit (Kap.3.6.2) belegen eine Dauer von 700 Jahren. Für den
Beginn des Holozäns wird 11 570 cal. BP als Mittelwert aus
verschiedenen Archiven errechnet (S.66).
In dem nichtglazial geprägten Lake C2 (Ellesmere Island, Kanadische
Arktis) wurden zehn Kurzkerne (bis maximal 34 cm Länge) mit
laminierten minerogenen Sedimenten und ein 206 cm langer, bis zum
basalen DiamiLton reichender Sedimentkern abgeteuft (Kap.4, S.77-
115). Die berechneten Sedimentationsraten werden durch radiometrische
Datierungen (210Pb und 137Cs) unterstützt. Gemäß dem aktungeologischen
Ansatz wurden 1990-1992 die Parameter Temperatur, Abfluß und
Sedimenteintrag direkt gemessen; aus der Sommertemperatur konnte dann
ein Wert für den Sedimenteintrag ermittelt werden, der direkt mit der
Warvendicke korreliert. Die Kurzkerne lassen detaillierte Studien für
die letzten 200 Jahre zu, der Langkern mindestens bis 769 n. Chr. Die
Sorgfalt, mit der Herr ZOLITSCHKA bei der Diskussion dieser Kerne alle
möglichen Fehlerquellen abwägt, ist mustergültig (vgl. Kap.4.3.2 u.
4.3.3). Insgesamt kommt er zu einer differenzierten paläoklimatischen
Detailanalyse zunächst der letzten 40 und schließlich der letzten 1100
Jahre. Es gelingt ihm, seine Ergebnisse in andere Untersuchungen -
z. B. über Temperaturanomalien aus Sibirien und Variationen der
Baumgrenze in Schweden (vgl. Abb.71) - einzubetten. Die Rekonstruktion
der Sommertemperaturen bis 1 100 VT (850 n. Chr.) stimmt in
wesentlichen Zügen mit den an Baumringen der Nordhemisphäre gewonnenen
Daten überein (S.115).
Das 5. Kapitel (S.117-156) widmet sich dem Lago Grande di Monticchio,
einem Maarsee an der Westflanke des Monte Vulture in Süditalien. Ein
dort abgetenfter 51 m langer Sedimentkern ist durch 173 Tephralagen
gegliedert und in einigen Bereichen warviert (insgesamt 6954
Jahreswarven, 9% des Kerns). Unter Zuhilfenahme von 14C- und
Ar/Ar-Datierungen und einem Modell zur Interpolation der
ungeschichteten Abschnitte gelingt eine plausible
Chronostratigraphie. Schließlich kann der Autor die warvenkalihrierte
Tephrochronologie dieses Profils mit U/Th-kalibrierten
Radiokohlenstoff-Daten an Korallen vor Barbados vergleichen
(Abb.85). Er macht überzeugend deutlich, daß das Monticchio-Profil bis
insgesamt 76 300 Warvenjahre vor heute zurückreicht, also etwa bis zur
Sauerstoffisotopengrenze zwischen den Stufen 5a und 4. Mittels
physikalischer, geochemischer und mikroskopischer
Sedimentuntersuchungen (Kap.5.4) wird schließlich die
Entwicklungsgeschichte des Sees rekonstruiert (Kap.5.5). Das Klima ist
als steueroder Faktor der Sedimentation von größter Bedeutung,
menschlicher Einfluß erst in den letzten 1 000 Jahren nachweisbar. Der
Schwerpunkt der interessanten Ausführungen zum Paläoklima liegt auf
dem letzten Glazial (Weichsel) und dem Spätglazial. Die
Parallelisierung mit hochauflösenden marinen Profilen und Eiskernen
ist spannend zu lesen (Kap.5.6), insbesondere die Identifizierung von
den Heinrich Events entsprechenden Kaltphasen im Seekern sowie der
Vergleich zur Datierung des Beginns von Spätglazial, Jüngerer Dryas
und Holozän. Dabei ist hervorzuheben, daß erstmals für den
Mittelmeerraum die Jüngere Dryaszeit detailliert palynologisch und
sedimentelegisch belegt werden konnte.
Im letzten Kapitel (Kap. 6) faßt der Autor die paläoklimatische
Bedeutung laminierter Sedimente zusammen. Im günstigen Fall ist über
lange Zeiträume eine jährliche Auflösung möglich - eine mit anderen
Datierungsmethoden nicht erreichbare Präzision. Selbst nicht warvierte
Abschnitte können unter Umständen durch Interpolationsmodelle
überbrückt werden. Erläuterungen zu den verwendeten Methoden und das
14 Seiten umfassende, ausführliche Literaturverzeichnis beschließen
den sorgfältig edierten Band. Zwei kleine Kritikpunkte seien
angemerkt: Es wäre schön gewesen, wenn die Arbeit durch Fotos von den
Seen und von jeweils charakteristischen Abschnitten der Sedimentkerne
bereichert worden wäre. Die Datensätze der drei exemplarischen Seen
werden zu isoliert betrachtet; der Ansatz zu einer im letzten Kapitel
angedeuteten Synopse dieser Paläoklima-Archive sollte unbedingt
ausgebaut werden, da die Ausweisung von Zeiträumen mit synchronem
bzw. diachronem Klimaverlauf von überregionaler Relevanz ist.
Fazit: Die Ausführungen unterstreichen eindrücklich das hohe Potential
lakustriner Sedimentprofile, die als Bindeglieder zwischen marinen und
rein terrestrischen Klima-Archiven fungieren können. Durch den
Nachweis der Warven-Klima-Beziehung (vor allem über die Variation der
Warvendicke) belegt BERND ZOLITSCHKA überzeugend die Möglichkeit der
Nutzung laminierter Seesedimente als paläoökologische, insbesondere
paläoklimatische Archive. Der Autor wertet das exzellente Archiv See
nach allen Regeln der heutigen Kunst aus. Durch sorgfältige und
umfassende physikalische und geochemische Sedimentuntersuchungen sind
Aussagen zur Seengeschichte und zum Paläoklima möglich. Dabei gelingt
es Herrn ZOLITSCHKA in hervorragender Weise, die paläoklimatischen und
anthropogenen Einflüsse zeitlich hochauflösend zu detektieren. Die
äußerst differenzierte Betrachtung mit Abwägung aller Aspekte läßt
keine Problemstellung aus, die Detailgenauigkeit besticht. Darüber
hinaus sind die Ergebnisse jeweils statistisch gut abgesichert. Auf
weitere Forschungsergebnisse des Autors zu anderen warvierten
Seesedimenten darf man schon jetzt gespannt sein.
HELMUT BRÜCKNER, Marburg
Zeitschrift für Geomorphologie, Neue Folge, Band 46, Heft 1, 2002