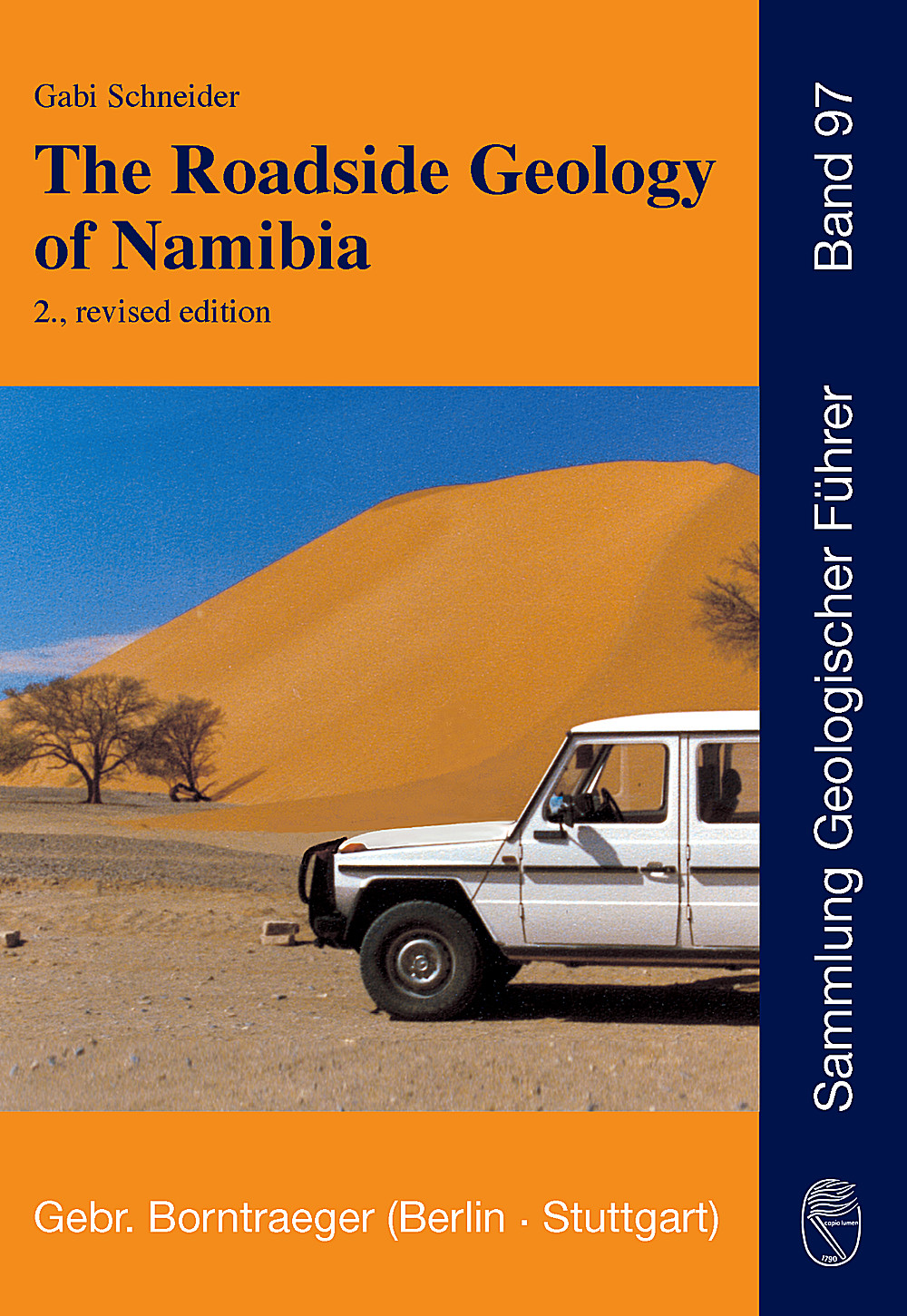Exkursionen durch Namibia mit dem Auto gedacht. Die Autorin
G. SCHNEIDER trug sich bereits längere Zeit mit dem Gedanken, ein
umfassendes Geologiebuch für Wissenschaftler wie für interessierte
Touristen zu erstellen; gefördert wurde diese Absicht durch das
Angebot von ERHARD NÄGELE (Stuttgart), das Werk in die „Sammlung
Geologischer Führer“ aufzunehmen.
Allein die Anziehungskraft weltweit berühmter geologischer Fundstellen
Namibias (vgl. S.47-124) würde ausreichen, das Buch für jeden
Geowissenschaftler interessant zu machen, auch wenn er Namibia nicht
unbedingt als nächstes Reiseziel gewählt hat. Dazu kommt die
ausführliche Beschreibung der Exkursionsrouten (S.125-264) mit
beigefügten geologischen Karten, vollständigen stratigraphischen
Säulenprofilen sowie exzellenten Landschaftsdarstellungen und
Fotos. Von besonderem Interesse sind die in diesem Teil Südwestafrikas
vielerorts anzutreffenden Belege für frühere wie auch derzeit gültige
Theorien über die Entstehung der Gesteine und die Entwicklung der Erde
von den Anfängen bis zum heutigen Bild der Verteilung von Kontinenten
und Ozeanen.
Die einführenden Kapitel geben einen Überblick über die geologische
Entwicklung Namibias – und Südafrikas – während 2,6
Mrd. Jahren. Namibia lag von Anfang an zwischen Kongo- und
Kalahari-Kraton (Abb. 2.1 und 2.2) und war mindestens bis zum Ende der
Dwyka-Vereisung (vor ca. 280 Mio. Jahren) noch mit Südamerika als
Gondwana-Kontinent eng verbunden; aus Abb. 2.1 lässt sich die Nähe zum
Südpol ablesen. Das Aufdringen von Vulkaniten der Etendeka-Formation
vor 132 Mio. Jahren markiert das Endstadium des
Gondwana-Kontinents. Gleich alte Vulkanite im brasilianischen
Paraná-Becken belegen für diesen Zeitpunkt noch die Zugehörigkeit von
Brasilien und Namibia zu einem gemeinsamen Kontinent. Kurz danach
begann das Auseinanderdriften von Afrika und Südamerika. Das sind
Fakten, die schon ALFREDWEGENER kannte, als er 1915 die „Entstehung
der Kontinente und Ozeane“ beschrieb, wenn er auch noch nicht die
heutigen Erfahrungen über das Rifting von Krustenplatten, das System
mittelozeanischer Rücken, das Spreading von Ozeanböden und die
Kollision kontinentaler mit ozeanischer Kruste hatte. So konnte er
auch noch nichts über die Ereignisse eines viel früheren,
neoproterozoischen, vollständigen plattentektonischen Zyklus im Raum
des Damara- Orogens im nordwestlichen und zentralen Namibia (Fig.3.3 –
3.6) wissen. Dieser komplette plattentektonische Zyklus ereignete sich
im Zeitabschnitt zwischen 820 und 650 Mio. Jahren.
Die Kapitel 3 (Erdgeschichte) und 5 (Paläontologie) gewähren einen
kurzen, aber doch vollständiger Überblick über die Gesteinsentwicklung
und die fossilen Belege vom Archaikum bis zum Känozoikum. Beigefügt
ist eine stratigraphische Tabelle (3.1, S. 10), die in den folgenden
Kapiteln durch detaillierte Tabellen (z. B. 8.6 oder 9.10.2), meist
mit begleitenden Spezialkarten (z. B. 9.11.1 und 9.11.2) ergänzt wird.
Gelegentlich fallen kleine Ungereimtheiten auf wie die „Kalahari
Sequence“ in Tab.3.1 und auf Seite 21, die man im übrigen Text als
„Kalahari Group“ bezeichnet (z. B. Fig.3.7 und 9.9.2). Als Beispiel
für Druckfehler sei der pitchstone (S.63) erwähnt, der in Fig.8.6.2
als „pitchsyone“ auftritt. Dies sind aber nur Details angeMuseen,
Sammlungen, Expeditionen 605 sichts der Fülle interessanter
Forschungsergebnisse – oft mit weltweitem Bezug – zur
erdgeschichtlichen Entwicklung Namibias, zu paläontologischen
Zeitmarken (Kap. 5) und Vorkommen (Kap. 4) sowie bergbaulicher Nutzung
von Mineralien (Kap. 7) und vor allem angesichts der lebendigen
textlichen Präsentation.
Kapitel 8 ist den geologischen Höhepunkten einer Namibia-Reise
gewidmet. 32 Lokalitäten, die seit über 100 Jahren das Interesse der
Geowissenschaftler auf sich lenken, beschreiben die Autoren bezüglich
ihrer jeweiligen Gesteinsabfolgen und orogenen Entwicklung detailliert
und umfassend; die beigefügten geologischen Karten, Querschnitte,
stratigraphischen Profile und Fotos fesseln den Leser und lassen den
Wunsch aufkommen, als nächstes Reiseziel Namibia zu planen. Zu nennen
sind vulkanische Strukturen wie der Brukkaros (S. 51-54), berühmte
Ring-Strukturen wie der Brandberg (S. 47-51) und Messum (S. 91-93),
aber auch schon früh in der Literatur beschriebene Lokalitäten wie der
Erongo-Komplex (S. 64-68) mit seinem äußeren, ca. 180 km langen
Ring-Dyke aus olivinführendem Dolerit; über magnetische Messungen
zeigt sich, dass sich dieser Gang konisch in die Tiefe zum Kern des
Erongo-Komplex fortsetzt (S.136). Schon HANS CLOOS deutete in seinem
„Gespräch mit der Erde“ (1947, S. 94-97) die wechselvolle Entwicklung
des Erongo-Komplex mit ihren Granit-Intrusionen und begleitenden
Metamorphosen richtig.
Umso gespannter liest man dann die begleitenden
Exkursions-Beschreibungen in Kapitel 9, für den Erongo speziell die
Routen 9.1 und 9.2. Insgesamt 29 Exkursions- Routen (vgl. dazu die
Übersichtskarte Abb. 9.1), alle mit sehr guten geologischen Karten und
Querschnitten sowie stratigraphischen Profilen, führen den Leser durch
Namibia.
Das Buch von GABI SCHNEIDER gehört in den Bücherschrank jedes
Geologen. Man liest es mit wachsendem Interesse von Anfang bis
Ende. Der Autorin und dem Verlag gebührt herzlicher Dank für dieses
auch in der Gestaltung erfreuliche Werk!
K. POLL
Zentralblatt f. Geol. Pal. Teil II Jg. 2008 H. 3/4