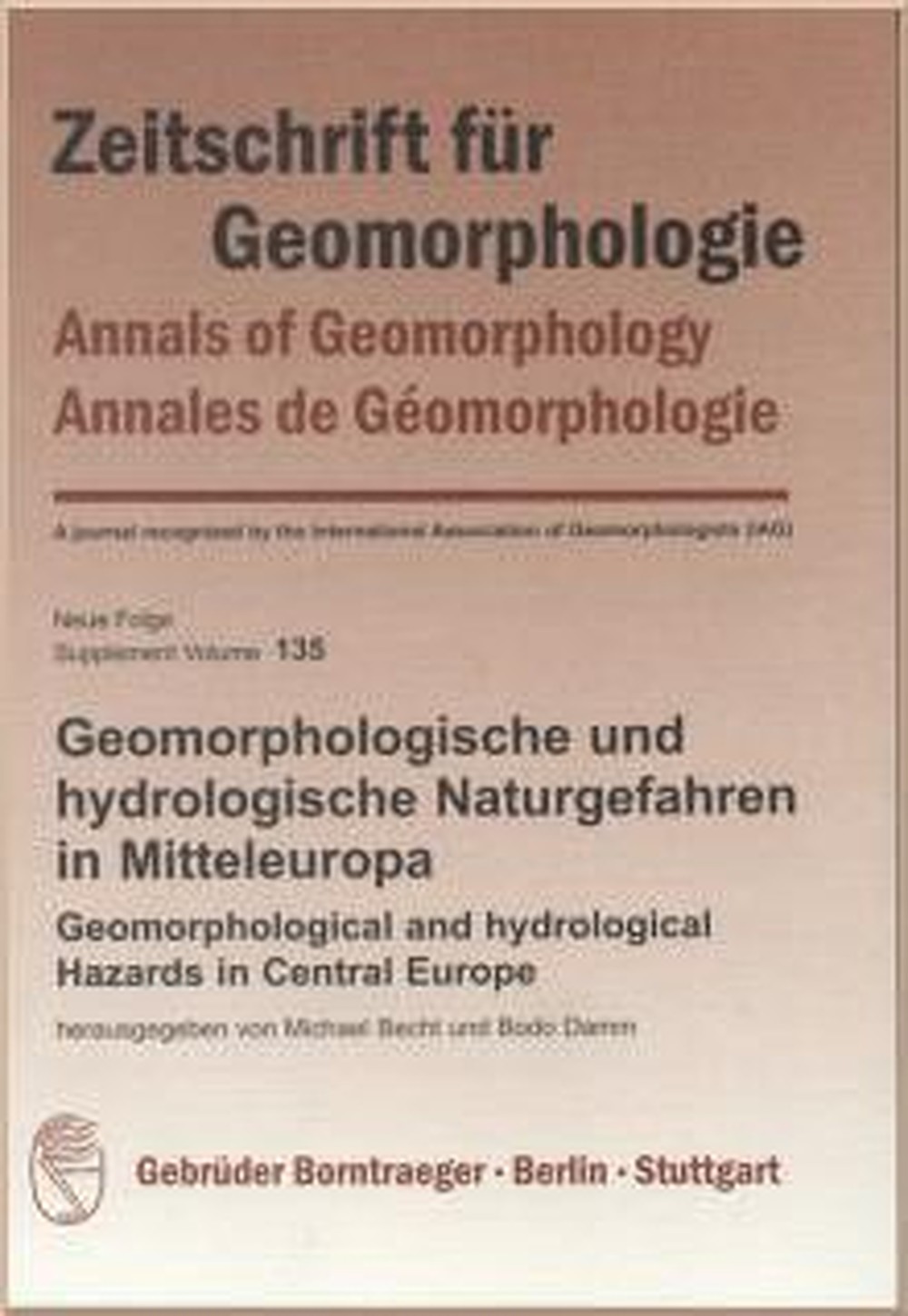Inhaltsbeschreibung nach oben ↑
Naturgefahren beeinträchtigen weltweit das wirtschaftliche und
gesellschaftliche Handeln in zahlreichen Regionen. Besonders in den
vergangenen Jahrzehnten sind das Ausmaß ökonomischer Verluste sowie
die Anzahl der von Naturereignissen Betroffenen empfindlich
angewachsen. Die zunehmenden Auswirkungen von Naturgefahren stehen
mit einem Ansteigen hydrometeorologischer Gefahren als Folge von
Klimaänderungen, demographischen Veränderungen, wachsendem
Nutzungsdruck und dem Fehlen von präventivem Handeln im
Zusammenhang. Hierdurch werden zunehmend mehr Menschen und Werte
Gefahren ausgesetzt.
Historische und methodische Aspekte der Naturgefahrenforschung in
Mitteleuropa stellen zwei Beiträge in den Mittelpunkt. Ein Beitrag
befasst sich mit der Analyse von historischen Naturgefahren im
Alpenraum. Die Autoren belegen die Notwendigkeit eingehender
historischer Untersuchungen und können zeigen, dass
historisch-naturwissenschaftliche Methoden vor allem bei
Hochwassergefahren einen bedeutenden Wissenszuwachs erbringen und
damit eine wesentliche Grundlage für Bewertungs- und Planungsprozesse
darstellen können. Den besonderen Wert historischer Daten für die
Hochwasserforschung verdeutlicht auch der folgende Beitrag: Auf der
Grundlage der „Historischen Hochwasserchronologie Werm (1500 — 1900)”
werden Frequenz- und Magnitudenanalysen von Hochwasserereignissen an
verschiedenen Thüringischen Fließgewässern vorgenommen. Schaden-
bzw. Verlustindizes ermöglichen darüber hinaus die soziale und
ökonomische Bewertung der Ereignisse.
Mit aktuellen Hochwasserereignissen und deren Auswirkungen befassen
sich die Autoren von drei weiteren Beiträgen:
- Landschaftsveränderungen und Zerstörungen durch das Mulde-Hochwasser
in der Tagebaulandschaft bei Bitterfeld im August 2002. (Mit der
Analyse des Ereignisses, das für mitteleuropäische Verhältnisse bisher
ungekannte Ausmaße erreichte, erarbeitet der Autor Grundlagen für
Maßnahmen, mit denen das Gefährdungspotential durch zukünftige
Hochwasser reduziert werden kann.)
- die Ursachen der Hochwasser im Rheineinzugsgebiet, die in den 1990er
Jahren Milliardenschäden verursachten. Die Untersuchungen belegen,
dass sich besonders die Folgen der baulichen Eingriffe in das
Flusssystem auf die Hochwasserganglinien quantifizieren lassen. Anhand
von zwei Projekten stellt der Autor beispielhaft Aktivitäten im
Bereich des Hochwassermanagements im Rheineinzugsgebiet vor.
- die Bedeutung des Gefahren- und Schadenspotentials durch
Wildbachprozesse in Mittelgebirgsräumen, belegt anhand von Beispielen
aus Nordhessen und Südniedersachsen. Durch die Untersuchungen wird
deutlich, dasss technische Verbauungen von Bächen bisher nur
eingeschränkt zur Reduktion von Schadenspotentialen beitragen
konnten. Mit einem GIS-gestützten Verfahren versuchen die Autoren
außerdem, Abfluss und Abtrag für ein extremes Abflussereignis zu
simulieren.
Die Analyse und Bewertung von Gefahren und Risiken durch gravitative
Massenbewegungen haben drei Beiträge aus verschiedenen Hoch- und
Mittelgebirgsräumen zum Inhalt, in welchen Konzepte für eine Anwendung
der technischen Risikoanalyse im Naturgefahrenbereich erstellt
werden. Durch Integration von Grundlagendaten sowie geomorphologischen
Informationen in ein GIS analysieren die Autoren Gefahrenpotentiale
und scheiden Gefahrenzonen für das ’worst-case-scenario’ aus. Der neue
konzeptionelle Ansatz ist auf die Prozessbereiche Mure, Steinschlag
und Lawine anwendbar. Eine Bewertung des Gefahrenpotentials von
Großhangbewegungen wird auf der Grundlage geomorphologischer,
geologischer und geotechnischer Analysen sowie externer
Steuerungsfaktoren vorgenommen. Der Autor macht in seinem Beitrag
deutlich, dass sinnvolle und finanziell vertretbare Verbauungs- und
Sanierungskonzepte bei Großhangbewegungen in vielen Fällen nur schwer
zu realisieren sind. Der nächste Beitrag befasst sich mit den
Problemen, die sich aus der Beplanung und Nutzung instabiler
Geländebereiche ergeben. Am Beispiel von Rutschgefahren in
Südniedersachsen wird deutlich gemacht, dass u.a. die Auswirkungen von
Klimaänderungen bei der Entwicklung des Siedlungsraums bisher nicht
berücksichtigt werden können. Eine nachhaltige Raumnutzungsplanung
erfordert in Zukunft ein verändertes Problembewusstsein bei
Bevölkerung und Entscheidungsträgern.
Mit der Modellierung geomorphologischer Naturgefahrenprozesse und
einer Betrachtung der Entwicklung wirtschaftlicher Verluste durch
Naturgefahren befassen sich die beiden abschließenden Beiträge. Am
Beispiel eines alpinen Einzugsgebiets in den “Nördlichen Kalkalpen
werden Verfahren zur Dispositions- und Prozessmodellierung für
Steinschlag, Felssturz, Muren und Rutschungen zur Abschätzung von
Gefahrenpotentialen vorgestellt. Anhand verschiedener Beispiele werden
Anwendungsmöglichkeiten der Modelle in der Geomorphologie und
Naturgefahrenforschung erläutert. Ein Autor analysiert wirtschaftliche
Zusammenhänge zwischen Naturkatastrophen und Klimaänderungen und
beschreibt die Befürchtungen und Handlungsoptionen aus Sicht der
Versicherungswirtschaft. Er zeigt in seinem Beitrag, dass sich Schäden
durch Naturkatastrophen in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht
haben und Abschätzungen künftiger Schadenspotentiale für verschiedene
Katastrophenszenarien bislang ungekannte Ausmaße
erreichen. Handlungsoptionen sollten daher insbesondere eine
verstärkte Schadenvorsorge einbeziehen.