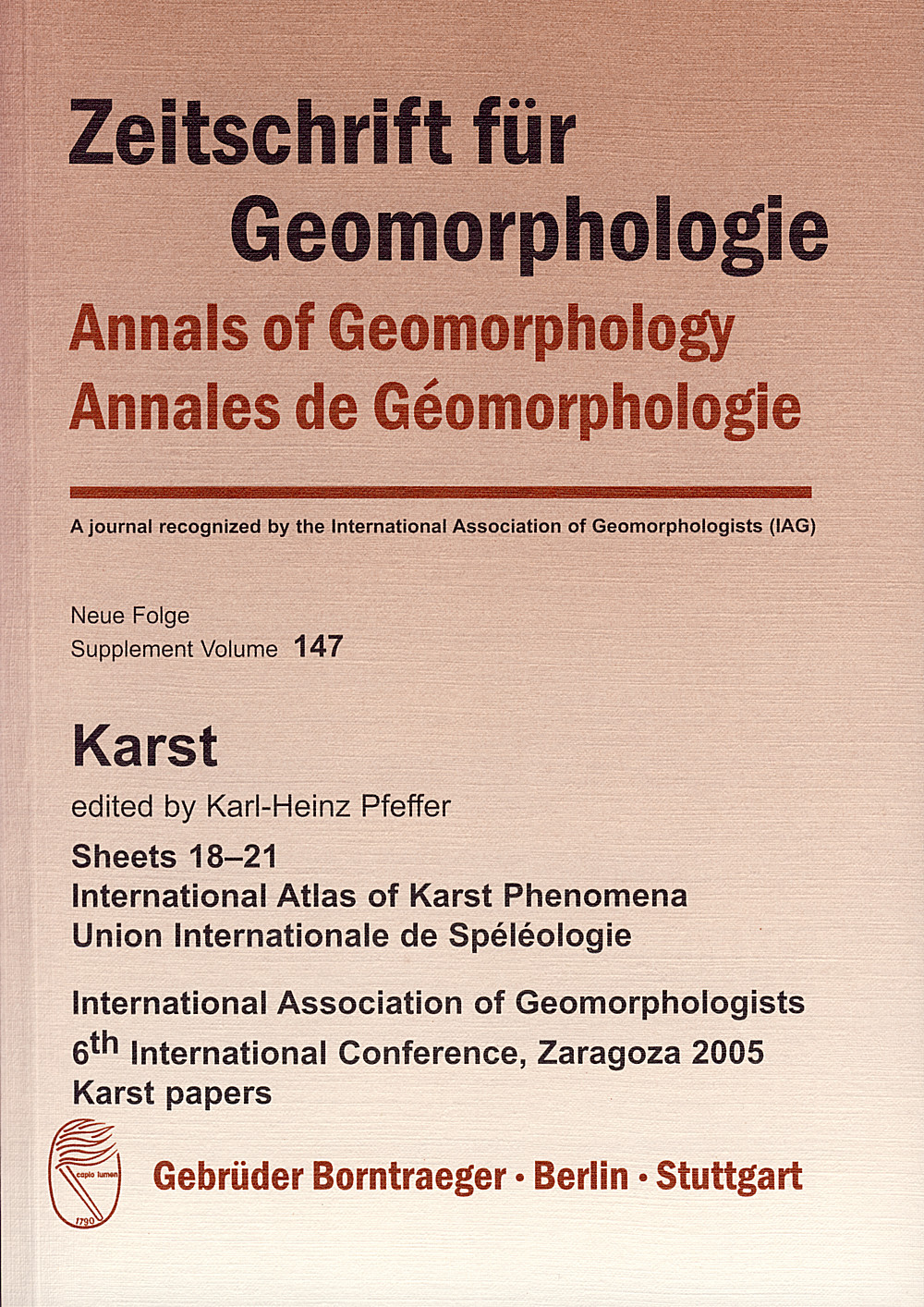Der Internationale Atlas der Karstphänomene hatte, seit im Jahre 1960
das erste Blatt erschienen war, zum Ziel, Karst vom klassisch
geomorphologischen Standpunkt aus zu behandeln. Die heutige
Betrachtungsweise ist durch das Einbeziehen ökologischer
Gesichtspunkte insbesondere auch anthropogener Einflüsse
umfassender. Nach einer längeren Pause seit 1998 erscheint nun in der
Reihe der Supplementbände der Zeitschrift für Geomorphologie wieder
ein Band mit neuen Blättern des Internationalen Atlas der
Karstphänomene (Blätter 18–21). Eine Übersicht über die bisher
publizierten Blätter des Atlas bietet der Vorspann auf den Seiten
V–VI.
Der Band beinhaltet in einem ersten allgemeinen Abschnitt eine
Übersicht über die globale Verteilung von Karbonatgesteinen und zeigt
damit jene Gebiete, die zumindest potenziell verkarstet sein könnten
(P. W. Williams & D. C. Ford), und eine Liste der 2006 von der UIS
beschlossenen kartographischen Symbolik für Phänomene des
Oberflächenkarsts (Ph. Häuselmann).
Im zweiten Abschnitt des Bandes werden vier Artikel vorgestellt, die
auch die beigelegten Blätter 18–21 des Atlas zum Gegenstand
haben. „Karst groundwater vulnerability assessment in a pre-alpine
fluviokarst system“ (H. J. Laimer) befasst sich mit der
Vulnerabilitätskartierung eines überwiegend als Grünkarst
ausgebildeten Gebietes in der Hallstätter Zone um Bad Ischl in den
oberösterreichischen Kalkvoralpen (Blatt 18). In „Quantitative karst
morphology of the Hochschwab plateau, Eastern Alps, Austria“ (L. Plan
& K. Decker) werden umfangreiche Analysen des morphologischen
Inventars der Karstoberfläche des Hochschwab-Plateaus östlich des
Meridians von Wildalpen in der nördlichen Steiermark mit statistischen
Auswertungen (Dichte, Volumen, strukturgebundene Richtungen) zur
Dolinenverteilung vorgestellt. Das Kartenblatt 19 umfasst zwei
Teilblätter im Maßstab 1 : 14.000 mit einer klaren und übersichtlichen
kartographischen Darstellung der über 12.000 Einzelobjekte umfassenden
Oberflächenkarstphänomene. Besonders eindrucksvoll ist auch das
Bildmaterial zum Glaziokarst mit zahlreichen Kleindolinen
unterschiedlicher Genese, die in die Sohle einer größeren Hohlform,
des sog. Ochsenreichkars, eingebettet sind. Der Beitrag
„Landschaftsentwicklung und Landschaftsprozesse in einem Hochtal der
Nördlichen Kalkalpen (Oberjoch/Allgäuer Alpen)“ (St. Bräker) befasst
sich mit ökotopbildenden Landschaftsprozessen und ihrer Klassifikation
mittels multivariater statistischer Methoden (Blatt 20). Ausgehend von
einer traditionellen Ökotopanalyse mit Kartierung und Reliefaufnahme,
Standortanalysen zu Boden und Vegetation sowie Laboranalysen werden
die Zusammenhänge mit multivariaten Methoden der Faktoren- und der
Clusteranalyse klassifiziert und daraus Prozesstypen
(z. B. Bodenwasserregime, Stoffumsatzregime, Klimaregime)
extrahiert. Mit einem außeralpinen Raum (Blatt 21) befasst sich die
Arbeit „The Karst Region Khon San in Northeast Thailand“
(K.-H. Pfeffer & S. Yongvanit). Die Arbeit vermittelt insgesamt ein
abgerundetes Bild eines tropischen Karstgebietes unter geoökologischen
(Klima, Vegetation, Geologie, Relief und Bodentypen) und
soziogeographischen (anthropogene Einflüsse) Gesichtpunkten.
Der dritte Abschnitt des Supplementbandes ist ausgewählten
Karstarbeiten gewidmet, die am 6. Internationalen Kongress der
Geomorphologen im Jahre 2005 in Zaragoza vorgestellt wurden. „A new
hypogean karst form: the oxidation vent“ (J. De Waele & P. Forti)
untersucht am Beispiel von durch Bergbau aufgeschlossenen Höhlen
Sardiniens speläo- und minerogenetische Prozesse, die zur Entstehung
ungewöhnlicher eher selten auftretender Lösungsformen und sekundärer
Mineralaggregate geführt haben. Wände und Höhlendecke sind von cave
clouds (wolkenartig ausgebildeten Ausfällungen) bedeckt, wobei diese
Speleotheme durch saure Wässer aus der Oxidation von Polysulfiden
stark korrodiert sind. Senkrecht zu den Strukturen der cave clouds
verlaufende bubble trails (Entgasungsspuren) weisen entlang ihres
Verlaufes oder an ihren Mündungen konisch nach innen zulaufende Löcher
auf, die als oxidation vents bezeichnet werden. Ihre Entstehung wird
auf die Anwesenheit metallischer Sulfide und über längere Zeiträume
wirkende Oxidationsprozesse zurückgeführt, wobei der Entgasungsprozess
unter epiphreatischen Bedingungen zwar gefördert aber durch abdeckende
Speleotheme behindert wird. Der Artikel „A geochronological approach
for cave evolution in the Cantabrian Coast (Pindal Cave, NW Spain)“
(M. Jiménez-Sánchez et al.) berichtet über die U-Th- Datierung von
Speleothemen aus einer Höhle an der nordkantabrischen Küste, wodurch
vier verschiedene Evolutionsphasen und derDer dritte Abschnitt des
Supplementbandes ist ausgewählten Karstarbeiten gewidmet, die am
6. Internationalen Kongress der Geomorphologen im Jahre 2005 in
Zaragoza vorgestellt wurden. „A new hypogean karst form: the oxidation
vent“ (J. De Waele & P. Forti) untersucht am Beispiel von durch
Bergbau aufgeschlossenen Höhlen Sardiniens speläo- und
minerogenetische Prozesse, die zur Entstehung ungewöhnlicher eher
selten auftretender Lösungsformen und sekundärer Mineralaggregate
geführt haben. Wände und Höhlendecke sind von cave clouds (wolkenartig
ausgebildeten Ausfällungen) bedeckt, wobei diese Speleotheme durch
saure Wässer aus der Oxidation von Polysulfiden stark korrodiert
sind. Senkrecht zu den Strukturen der cave clouds verlaufende bubble
trails (Entgasungsspuren) weisen entlang ihres Verlaufes oder an ihren
Mündungen konisch nach innen zulaufende Löcher auf, die als oxidation
vents bezeichnet werden. Ihre Entstehung wird auf die Anwesenheit
metallischer Sulfide und über längere Zeiträume wirkende
Oxidationsprozesse zurückgeführt, wobei der Entgasungsprozess unter
epiphreatischen Bedingungen zwar gefördert aber durch abdeckende
Speleotheme behindert wird. Der Artikel „A geochronological approach
for cave evolution in the Cantabrian Coast (Pindal Cave, NW Spain)“
(M. Jiménez-Sánchez et al.) berichtet über die U-Th- Datierung von
Speleothemen aus einer Höhle an der nordkantabrischen Küste, wodurch
vier verschiedene Evolutionsphasen und der Zusammenhang mit
Hebungsphasen im Küstenbereich nachgewiesen werden konnten. Die
Arbeit „Geomorphology of the Canale di Pirro Karst Polje (Apulia,
Southern Italy)“ (M. Parise) behandelt deskriptiv ein deutlich
strukturgebundenes Polje südöstlich von Bari im apulischen Karst, das
mit 12 km Längserstreckung beachtliche Ausmaße erreicht.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die genannten Artikel einen
breitgestreuten Querschnitt durch derzeit laufende Forschungsarbeiten
im Bereich der Karstmorphologie bzw. Geospeläologie bieten und das
beigelegte Kartenmaterial eine weitere Bereicherung der schon bisher
erschienenen Blätter des Internationalen Atlas der Karstphänomene
darstellt. Ralf Benischke Zusammenhang mit Hebungsphasen im
Küstenbereich nachgewiesen werden konnten.
Die Arbeit „Geomorphology of the Canale di Pirro Karst Polje (Apulia,
Southern Italy)“ (M. Parise) behandelt deskriptiv ein deutlich
strukturgebundenes Polje südöstlich von Bari im apulischen Karst, das
mit 12 km Längserstreckung beachtliche Ausmaße erreicht.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die genannten Artikel einen
breitgestreuten Querschnitt durch derzeit laufende Forschungsarbeiten
im Bereich der Karstmorphologie bzw. Geospeläologie bieten und das
beigelegte Kartenmaterial eine weitere Bereicherung der schon bisher
erschienenen Blätter des Internationalen Atlas der Karstphänomene
darstellt.
Ralf Benischke
Beiträge zur Hydrogeologie Jahrgang 2007/2008 S. 239-240