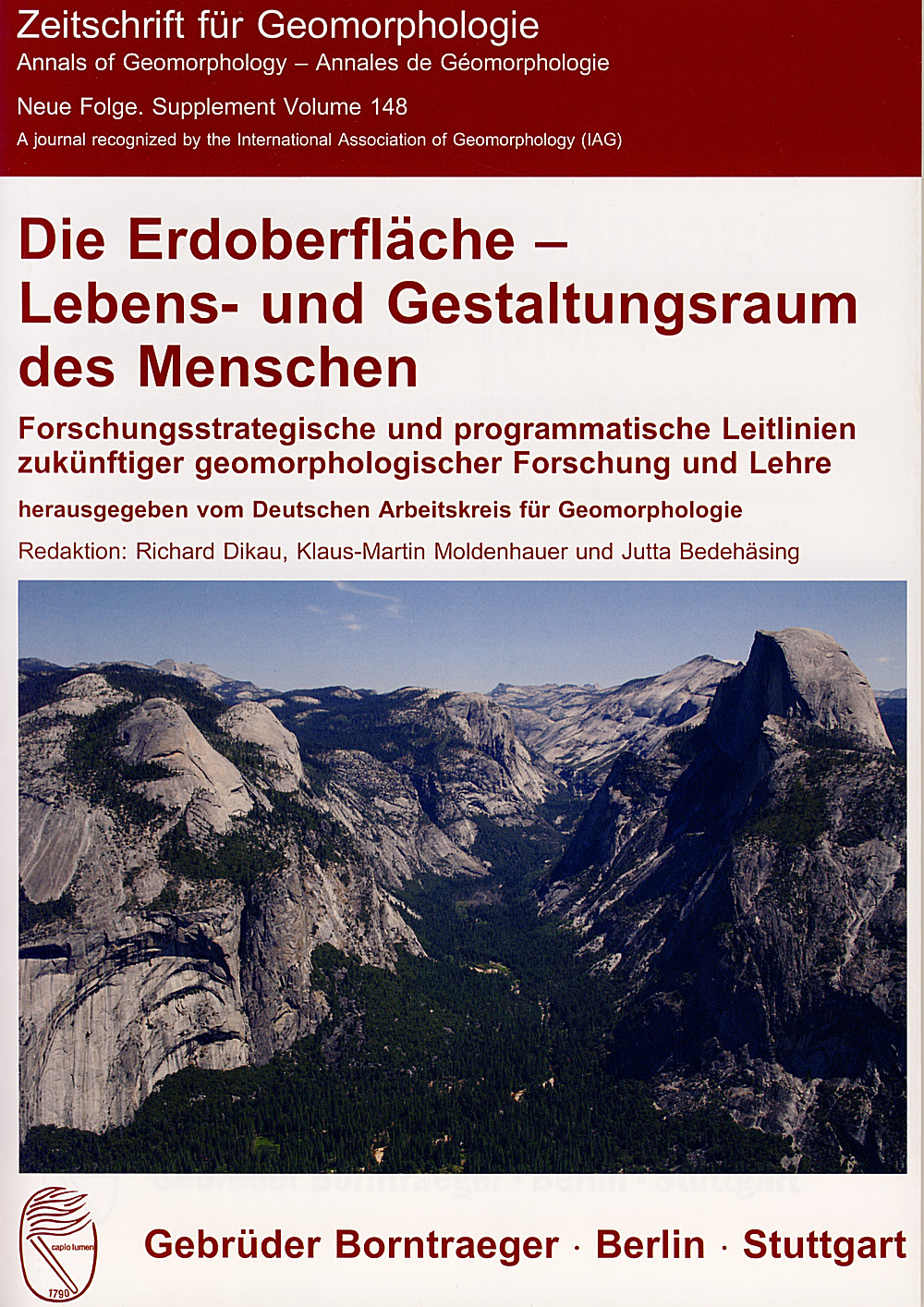Die vom Deutschen Arbeitskreis für Geomorphologie vorgelegte
Veröffentlichung versteht sich als eine Denkschrift, die angesichts
von „neuen Entwicklungen in den internationalen
Erdsystemwissenschaften“ „einen forschungsstrategischen und
programmatischen Diskussionsbeitrag der geomorphologischen Disziplin
in Deutschland“ liefern soll. Anlass sind die besonderen
Herausforderungen, die für die Geomorphologie in den sich
verschärfenden globalen Umweltveränderungen und in neuen Entwicklungen
in den internationalen Erdsystemwissenschaften gesehen werden. 24
Autoren sind an dem Band mit ein oder zwei Beiträgen oder
Teilbeiträgen beteiligt, abgesehen von R. Dikau, von dem 6 Abschnitte
stammen. Er liefert auch das Vorwort und wird als Redaktionsmitglied
genannt, so dass kein Zweifel bestehen kann, dass er die Hauptarbeit
der Herausgabe getragen hat und wohl auch als Initiator der Schrift
anzusehen ist. Insofern verwundert es nicht, dass unter den Autoren
frühere und heutige Mitarbeiter oder Schüler Dikaus stark vertreten
sind. Auffällig ist allgemein die zahlenmäßig starke Beteiligung
relativ jung berufener Ordinarien der Geomorphologie, die
erwartungsvoll stimmt.
Im Kern dieser Veröffentlichung werden vier zentrale Themenbereiche
geomorphologischer Forschung und Lehre herausgestellt, die sich an den
Herausforderungen des globalen Wandels orientieren, nämlich (1)
geomorphologische Entwicklung und aktuelle Formung der Erdoberfläche,
(2) aktuelle Mensch-Umwelt-Interaktionen, (3) holozäne
Umweltrekonstruktion und Geoarchäologie und schließlich (4)
Naturgefahren und Naturrisiken. Jeder dieser Themenbereiche ist in 3
bis 5 Unterkapitel untergliedert, in denen von verschiedenen Autoren
nach vorgegebenem Gliederungsschema internationaler Status quo der
Forschung im jeweiligen Teilbereich und Ziele und Perspektiven in der
Archivforschung, der Prozessforschung sowie der Modellierung und
Prognostik behandelt werden. Diese Themenbereiche übergreifend werden
anschließend (5) die Potenziale neuer Methoden für die
geomorphologische Forschung abgeleitet, wobei die Unterkapitel neue
Datierungsmethoden, geophysikalische Methoden und Methoden zur
„Detektion von Reliefformen und der Kinematik der Erdoberfläche“
(d. h. Fernerkundung, Dendrogeomorphologie, Digitale Kartographie)
beinhalten. Eine kurze Zusammenfassung der Perspektiven und
strukturellen Rahmenbedingungen geomorphologischer Forschung und
Lehre, in der noch einmal die Herausforderung des globalen Wandels
herausgestellt und die Bedeutung der Interdisziplinarität und der
internationalen Zusammenarbeit betont wird, beschließt die
Denkschrift.
Der begrenzte Umfang einer Rezension verbietet es, auf die einzelnen
Beiträge einzugehen. Allgemein erscheint es fraglich, ob die vielen
Unterkapitel mit jeweils anderen Autoren die Aussagekraft dieser
Denkschrift verbessern. Die Schlussfolgerungen, Probleme und
Perspektiven für die Forschungen zur aktuellen Formung der
Erdoberfläche sind – abgesehen von der Gewichtung – die gleichen wie
bei der Untersuchung des Sedimenthaushaltes und unterscheiden sich
nicht sehr von denen der holozänen Umweltrekonstruktion und wenig von
Teilaspekten der Naturgefahrenforschung : qualitative und quantitative
Verbesserung der raumzeitlichen Differenzierung von Geo-Archiven als
Voraussetzung für Modellierungen, Anlage von langfristigen
detaillierten Messreihen, Verbesserung bzw. Entwicklung von Modellen
zur Prozessforschung und Reliefentwicklung. Die Probleme des Up- und
Downscalings, des Übergangs vom Messfeld in die Landschaft werden
verschiedentlich angesprochen, aber es bleibt beim Leser die Sorge, ob
es in Zukunft neben vielen Modellierern und Messfeldgeomorphologen
auch noch Geomorphologen geben wird, die den Blick für das Relief als
übergeordnetes Ganzes und die dafür notwendige Geländeerfahrung
haben. In seinem Beitrag über die geomorphologischen Auswirkungen
anthropogener Umweltveränderungen stellt Bork als ein langfristiges
und allgemeines Forschungsziel der Geomorphologie die umfassende,
systematische Verknüpfung des aktualistischen, modellorientierten
Methodensystems mit dem geowissenschaftlich- paläoökologischen System
heraus. Der Rezensent stimmt dem voll zu, ist sich aber nicht sicher,
ob dieses Ziel von allen beteiligten Autoren erkannt wird.
Die Unterkapitel sind in ihrer Bedeutung fast unvermeidlich
ungleichgewichtig, und man kann Zweifel haben, ob die Diskussion der
Schwellenwertproblematik oder auch der Deckschichten wirklich einen
eigenen Abschnitt verdient haben. Andererseits sind offenkundig Lücken
vorhanden. Es überrascht schon, wenn man bei der betonten
Herausforderung der Geomorphologie durch globale Umweltveränderungen
kaum ein Wort über die Küstengeomorphologie findet, wenn die
Karstmorphologie mit einer Bemerkung über den Lösungsaustrag erledigt
wird oder wenn, trotz Eitels Darlegungen über reaktive
(d. h. ökologisch sensitive) Räume, z. B. von der geomorphologischen
Wüstenforschung nur im Zusammenhang mit der Desertifikation die Rede
ist. Dass Tektonik in diesem Heft kaum stattfindet, verwundert schon
weniger, denn das spiegelt tatsächlich das Bild der deutschen
Geomorphologie wider.
Überspitzt gesagt beziehen sich die in dieser Denkschrift
herausgestellten Themenbereiche im wesentlichen auf die fluviale
Dynamik in den Mittel- und Hochgebirgen Mitteleuropas. Das entspricht
den bevorzugten Arbeitsgebieten der Mehrzahl der Autoren. Aber es ist
sehr die Frage, wieweit sich die deutschen Geomorphologen und die
Mitglieder des AKG damit angemessen vertreten finden. Unter den
Rahmenbedingungen der Forschung finden die interdisziplinäre und die
internationale Zusammenarbeit nicht die breite Erwähnung, die man mit
Blick auf das Schlusskapitel erwarten sollte. Interdisziplinäres
Arbeiten wird in dieser Schrift praktisch nur im Bereich der
Geoarchäologie erkennbar, und die Hinweise auf dieBeteiligung am
Internationalen Geosphären-Biosphären-Programm und an seinen Ablegern
reichen für den Nachweis internationaler Zusammenarbeit kaum
aus. Damit soll nicht gesagt sein, dass es die nicht gäbe, aber sie
wird eben nicht dokumentiert.
Auf die Gefahr hin, es mit der Führung des AKG, dem ich mich weiterhin
verbunden fühle, völlig zu verderben: diese Denkschrift enttäuscht
mich. Vielleicht zweifeln sogar die Herausgeber daran, dass dies eine
echte Denkschrift ist. Der Begriff kommt zwar im Vorwort und im
Klappentext mehrfach vor, aber nicht im Titel. Ich hätte mir als
Denkschrift jedenfalls eine auf einer ehrlichen und konkreten
Darlegung der Bilanz der Geomorphologie aufbauende Perspektive
gewünscht: was wollen wir, was können wir wie erreichen; d. h. nicht
die Darlegung von Arbeitsgebieten, sondern die Nennung möglichst
konkreter Zielsetzungen unter Berücksichtigung auch der Lehre, die in
der vorliegenden Schrift nur im Titel und in einer Überschrift
erscheint. Eine solche Denkschrift wäre der Situation angemessen, in
der die Geomorphologie an den deutschen Hochschulen aus verschiedenen
Gründen, die man auch thematisieren müsste, ernsthaft in ihrem Bestand
bedroht ist. Die vorliegende Veröffentlichung bietet zwar manche
Orientierung – am wenigsten allerdings wohl für den Außenstehenden –
sie hat aber bei weitem nicht das Durchschlagsvermögen, um an der
derzeitigen prekären Situation der Geomorphologie etwas zu ändern.
Jürgen Hagedorn, Göttingen
Zeitschrift für Geomorphologie N.F. 52/4 (Dezember 2008)