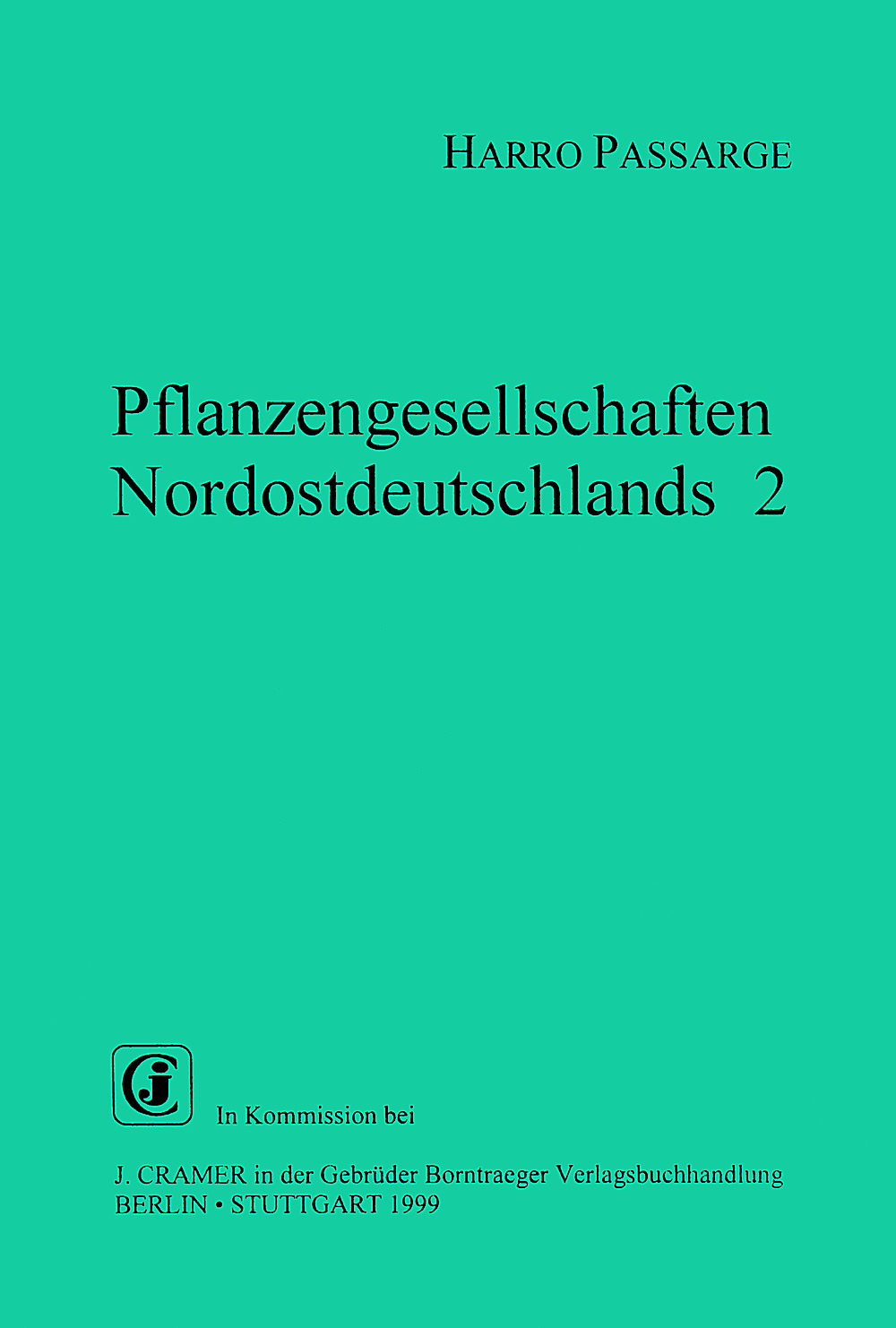PASSARGE legt hiermit den zweiten Band seiner 1996 begonnenen
Übersicht über die Pflanzengesellschaften Nordost deutschlande
vor. Während im ersten. mit 298 S. etwas dünneren Band die "Hydro- und
Therophytosa", also die Wasserpflanzen- und die
Therophytengesellschaften, behandelt wurden, sind Gegenstand des
vorliegenden Bandes die Ufer-, Röhricht-, Sumpf- und
Moorgesellschaften sowie die terrestrischen Rasengesellschaften
(allerdings ohne die Trockenrasen) Das Untersuchungsgebiet -
Ost-Elbien im Diktum des Verfassers - umfaßt die Bundesländer
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin, sowie den nördlichen
Teil von Sachsen-Anhalt.
Auf wenige einführende Seiten folgt der Hauptteil, in welchem die
Vegetationseinheiten nach einem hierarchischen System abgehandelt
werden. Zu jedem Verband gibt es eine Übersichtstabelle, darüberhinaus
dokumentieren genauere Tabellen geographische und standortsabhängige
Abwandlungen. Dabei handelt es sich jeweils um vollständige
Stetigkeitstabellen mit zusätzlicherAngabe der mittleren Mengenspanne.
Der Autor hat allein für diesen Band mehrere tausend, wenn nicht sogar
über zehntausend Vegetationsaufnahmen zusammengetragen, geordnet und
diskutiert - eine gewaltige Leistung! Der Wert dieses Werkes beruht in
hohem Maße auf der zusammenfassenden Darstellung einer so großen Zahl
bzgl. der Autoren und der räumlichen Herkunft breit gestreuter
Vegetation.saufnahmen. Damit ist eine hervorragende Übersicht über die
Vegetation Nordostdeutschlands gegeben. Jeder Interessierte kann sich
zugleich für einene Arbeiten sehr rasch einen Uberblicli Siber
Literaturquellen mit Original-Vegetationstabellen verschaffen. Der
Text zu den einzelnen Assoziationen ist knapp gefaßt: der Autor
benennt die bezeichnenden Arten und beschreibt die
Bestandes-Physiognomie; es folgen Hinweise auf Untergliederungen in
geographischer und standörtlicher Hinsicht. sowie eine Einschätzung
der Gefährdungssituation. Einige der vorgestellten Assoziationen und
viele der Subassoziationen werden hier neu vom Autor beschrieben und
durch Angabe eines nomenklatorischen Typus validisiert.
Bei dem vorliegenden Werk handelt es sich um eine stark ergänzte und
ausgebaute Neuauflage. denn bereits 1964/1968 erschienen die
"Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes" "I" und
"II" als Bd. 13/16 der Reihe Pflanzensoziologie mit PASSARGE als
alleinigem bzw. als erstem Autor. Während damals gut 660 Seiten
ausreichten. um die aus dem Untersuchungsgebiet belegten
Vegetationseinheiten tabellarisch darzustellen undzu beschreiben, ist
diese Seitenzahl mit den beiden neuen Bänden schon deutlich
überschritten, obwohl erst gut die Hälfte des Stoffes abgedeckt
ist. 1964 wurde z.B. die Klasse der Phragmitetea auf 20 Seiten
abgehandelt, 1999 widmet PASSARGE ihr (nun aufgespalten in 2 Klassen)
108 Seiten, ohne daß der Text ausschweifender geworden
wäre. Zweifellos hat die erste zusammenfassende Darstellung der
Pflanzengesellschaften Nordostdeutschlands zu vegetationskundlichen
Studien angeregt, so daß nunmehr ein sehr viel umfangreicheres und
umfassenderes Aufnahmematerial für eine Synopse zur Verfügung steht.
Bei einem Blick in das Inhaltsverzeichnis des zu besprechenden Bandes
fällt sofort eine Besonderheit in der pflanzensoziologischen
Nomenklatur auf: die angeführten Gesellschaftsnamen sind nicht wie
üblich zumeist aus 2 Artnamen zusammengesetzt, sondern leiten sich von
dem Namen nur einer Art ab. Beim weiteren Nachlesen stellt man
fest. daß diese Namen Assoziationsgruppen bezeichnen. Dabei entspricht
die Zahl der Assoziationsgruppen etwa der Zahl der gewöhnlich
akzeptierten Assoziationen. So führt R. POTT (1995: Die
Pflanzengesellschaften Deutschlands. Stuttgart: Ulmer Verlag) in der
Klasse der Littorelletea 13 Assoziationen und Gesellschaften. während
PASSARGE für sein viel kleineres Arbeitsgebiet 11 Assoziationsgruppen
in l9 Assoziationen unterteilt. Dahinter steckt eine ganz eigene
Grundidee der Synsystematik. Das in weiten Kreisen akzeptierte
pflanzensoziologische System baut auf Charakterarten auf welche über
ihren Treuegrad definiert sind. Die Zahl der Assoziationen ist auf ein
überschaubares Maß begrenzt, indem jede Assoziation (außer der
Zentralassoziation eines Verbandes) mindestens eine Art aufweisen
muß. die dort ihren Vorkom mensschwerpunkt besitzt. PASSARGE hingegen
argumentiert, daß die pflanzensoziologische Grundeinheit der
Assoziation sich durch eine hohe Homotonität (Anteil der gemeinsamen
Arten) auszeichnen sollte und daß auch der Bauwert der Arten bei der
Synsystematik zu berücksichtigen sei. Er sieht es als Vorzug seines
Systems. daß damit eine viel größere Anzahl an Assoziationen
beschrieben werden bannt Tatsächlich ist mit der Angabe einer
.Assoziation nach PASSARGE eine sehr genaue Aussage über die
vorzufindende Artenkombination getroffen. Aber die Anzahl der
Grundeinheiten ist so groß. daß es selbst für versierte
Vegetationskundler schwer sein dürfte. den Überblick nicht zu
verlieren. Die größere Breite der auf Charakterarten basierenden
Assoziation ist für eine genaue vegetationskundliche Einordnung
insofern kein Hindernis. als ja eine beliebige Unterteilung in
homotonere Untereinheiten möglich ist. Wenn sich auch bei dem auf
Charakterarten aufbauenden System immer wieder Ungereimtheiten
ergeben. besitzt es doch den großen Vorzur vergleichsweise
überschaubar und damit anwendungsfreundlich zu sein. Jeder Versuch mit
einem hierarchischen System die realeVegetationsvielfalt zu
beschreiben. muß zwangsläufig an Grenzen stoßen. Der Außenwirkung und
damit der praktischen Bedeutung der Pflanzensoziologie käme dennoch
eine Einigung auf ein (wenn auch immer unvollkommenes) System mit
Sicherheit zugute!
Die Tabellen PASSARGES sind horizontal nach Artengruppen
gegliedert. Bei diesen Artengruppen sind Arten ähnlichen
ökologisch-soziologischen Verhaltens- zusammengestellt. Die
Artengruppen sind nicht fest definiert und variieren selbst zwischen
den Tabellen eines Verbandes (z.B. bilden Molinia caerulea und
Callunna vulgaris in Tab. 113 und 114 eine Artengruppe während sie in
Tab. 115 verschiedenen Artengruppen zugeteilt sind). Die Artengruppen
werden nicht benannt oder näher erklärt. und es gibt auch keine
Literaturverweise. Andererseits kommen die Artengruppen auch dem
Vegetationskundler sehr bekannt vor der normalerweise mit dem auf
Charakterarten basierenden System umgeht - die Artgruppierungen
überschneiden sich weitestgehend.
Die Interpretation der Tabellen ist recht mühsam, da die
differenzierenden Artengruppen weder zusammengestellt noch optisch
hervorgehoben sind. Für ein häufig in den Übersichtstabellen anstelle
einer Stetigkeitsangabe stehendes "d" konnte die Rezensentin keine
Erläuterung finden. Eine Anfrage beim Verfasser ergab, daß hiermit
Arten gekennzeichnet wurden, die nur in einer von 2 oder mehreren
Subassoziationen vorkommen.
Alles in allem ist es sehr erfreulich, daß hier wiederum eine aktuelle
und grLindliche vegetationskundliche Übersicht für einen großen Teil
Deutschlands entsteht. Alle an der Vegetationskunde Interessierten
hoffen mit Sicherheit darauf, daß das Werk in naher Zukunft durch die
noch fehlende Übersicht über die Trockenrasen, die Kraut- und
Staudengesellschaften. sowie die Zwergstrauch-, Gebüsch- und
Waldgesellschaften ergänzt werden wird.
A. GRÜTTNER, Halle (Saale)
Flora, vol.195,no.4,Dec.2000,p. 195/196