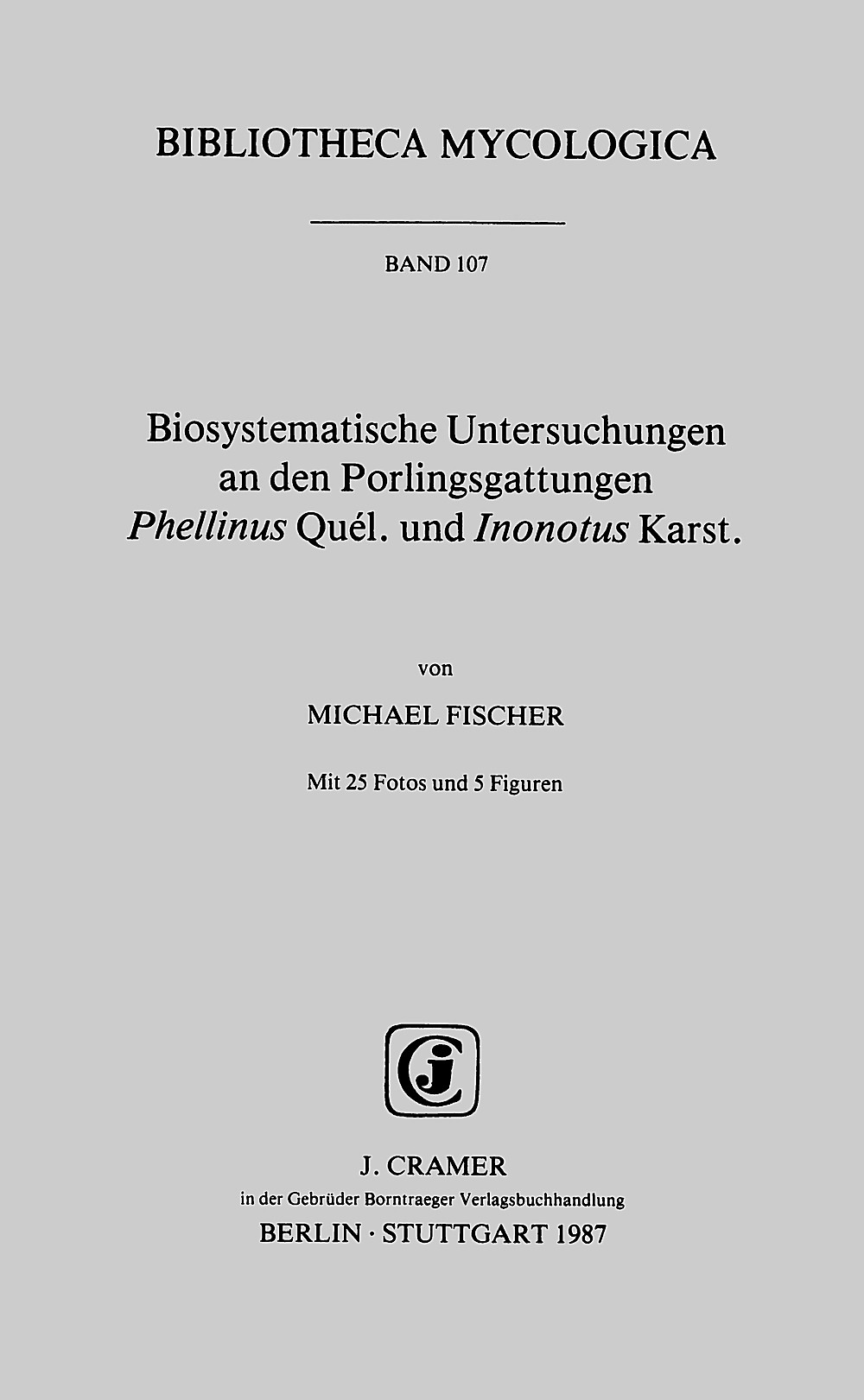Inhaltsbeschreibung top ↑
Zwanzig bzw. vier Arten der nahverwandten Hymenochaetaceen-Gattungen
Phellinus und lnonotus wurden in erster Linie nach genetischen, aber
auch ökologischen und teilweise biochemischen Aspekten
bearbeitet. Damit eng verknüpft waren Fragen und Problemstellungen der
Artbildung und des Lebenskreislaufs wie Sporenkeimung, Sexualität oder
Fruktifikation.
In verschiedenen Teilbereichen erwies sich eine Simulation der
Verhältnisse des natürlichen Standortes als nützlich. Sporenkeimungen
waren demnach fast ausschließlich nur bei einem pH-Wert von 4,0—5,0
auf Malzextrakt-Medium zu erzielen. Die besten Resultate ergaben sich
auf natürlichen Holzsubstraten des eigenen Wirtes; die Keimung auf
wirtsfremden Hölzern war aber nicht völlig gehindert.
Zwölf Phellinus- und drei lnonotus-Sippen zeigten ein heterothallisch
unifakto rielles Sexualitätsmuster; damit verbunden war das Phänomen
der multiplen Allelie.
Acht Phellinus-Sippen und eine von lnonotus waren homothallisch.
Bei den heterothallischen Sippen wurde die kompatible Reaktion
zwischen zwei homokaryotischen Kreuzungspartnern durch die Etablierung
eines heterokaryotischen Kreuzungsmycels in der Kontaktzone
angezeigt. Inkompatible Konfrontationen waren durch die Bildung einer
dunkel pigmentierten Demarkationslinie zu erkennen. Bei den
homothallischen Sippen kam es entweder zur Vermischung der
homokaryotischen Partner — so jeweils bei P. robustus, P.
hip-pophaecola‚P. punctatus, l. obliquus — oder sie blieben durch eine
barrageähnliche Zone stark reduzierten Mycelwachstums von— einander
getrennt — so jeweils bei P. hartigii, P. ferruginosus,
P. nigrolimitatus, P. viticola, P. ribis.
Zweikernige Hyphenabschnitte wiesen P. torulosus, P. ferruginosus,
P.. nigrolimitatus sowie P. viticola auf. Alle anderen Sippen waren
mehrkernig (im Schnitt 4-6 Kerne/Zelle).
In den Basidien der dahingehend untersuchten Sippen P. igniarius und
P. torulosus (heterothallisch) sowie P. ferruginosus und l. obliquus
(homothallisch) lagen ein großer oder zwei bzw. vier kleinere Kerne
vor. Die subhymenialen Zellen schienen zum Großteil zweikernig.
Messungen des DNA-Gehalts von Zellkernen, karyologische Beobachtungen
an Mycel und Hymenialelementen, Sexualität sowie Kreuzungsverhalten
der vier Myceltypen — Fruchtkörper-‚ Vielspor-, Kreuzungs- und
Einspormycel - ließen auf drei hypothetische Typen eines
Lebenskreislaufs schließen:
1) Heterothallisch unifaktoriell mit einer Haplophase als Grundstufe
waren:
igniarius
cinereus
ossatus
conchatus
laevigatus
pomaceus
P. populicola
P. nigricans
P. tremulae
P. torulosus
P. pini
P. chrysoloma
l. hastifer
l. nodulosus
l. radiatus
2) homothallisch und haploid waren:
P. ferruginosus
P.rugrohnntatus
P.viticola
P. ribis (P)
l. obhquus
3) homothallisch mit einer Diplophase als Grundstufe waren:
P. robustus
P. hartigii
P. hippophaecola
P. punctatus
Allen drei Gruppierungen scheint das Auftreten von Kernfusionen in
Kreuzungs-, Vielspor- und Fruchtkörper-Mycel gemeinsam. Das Ergebnis
sind diploide bzw. tetraploide Kerne. Da es in den Basidien der
beobachteten hetero- und homothallischen Arten zu Karyogamie und
Meiosis kommt, ist die Notwendigkeit einer zusätzlichen
Reduktionsteilung bereits außerhalb der Basidie gegeben. Es wird
angenommen, daß die beiden Kerne der Subhymenialzellen wieder im
postmeiotischen Zustand vorliegen.Grundsätzlich kann bisher nicht
ausgeschlossen werden, daß haploid bzw. diploid verbliebene Kerne in
die Basidienanlage einwandern. Die Notwendigkeit einer extrabasidialen
Reduktionsteilung würde somit entfallen.
Kreuzungs- und Fruchtkörpermycel bei den heterothallischen
bzw. Einspor- und Fruchtkörpermycel bei den homothallischen Arten
unterschieden sich im Kreuzungs- und Fruktifikationsverhalten. Daraus
wurde auf eine Nichtidentität der jeweiligen Myceltypen
geschlossen. Mycelien hingegen, die sich aus Sporenabwurf präparaten
von Fruchtkörpern entwickelten (= Vielspormycel), waren in allen
untersuchten Belangen mit Fruchtkörpermycel identisch.
Hieraus ergibt sich bei beiden Fortpflanzungstypen die Annahme der
Entstehung fruktifikationsfähiger Individuen aus einer Vielzahl am
natürlichen Standort vorhandener Sporen
(s. Fig. 2,3,5). Kernwanderungen und Kernaustausch auch bei
homothallischen Arten (Anastomosenbildung!) sollten eine bestmögliche
Kombination genetisch heterogener Kerne ermöglichen. Fruchtkörper
hetero— und homothallischer Arten wären demnach - unter Umständen in
unterschiedlichem Ausmaße — heterokaryotisch.
Die Phänomene Kernfusion und Reduktionsteilung in Mycel und Basidie
gewinnen dadurch an Bedeutung. Während bei den heterothallischen Arten
die Rekombinationsrate zusätzlich erhöht wird, wird Rekombination
bei den homothallischen Arten durch das Vorhandensein heterogener
Kerne erst eigentlich ermöglicht und sinnvoll.
Es erscheint möglich, daß durch die Verteilung ursprungsverschiedenen
genetischen Materials im Mycel (Sektorenbildung!)
Selek.Ionsmechanismen bereits auf dieser Stufe angreifen und
entsprechend günstige Kernkombinationen begünstigen können. Die
Aussage, Homothallie im wesentlichen mit lnzucht gleichzusetzen,
bedarf daher einer Relativierung.
Nur P. torulosus, P. ferruginosus, P. viticola und l. obliquus
fruktifizierten in Kultur bereitwillig und reproduzierbar. Schwierig
und nicht beliebig wiederholbar war die Fruktifikation bei P .
igniarius, P. populicola, P. tremulae und P. pini. Die Morphologie der
Laborfruchtkörper unterschied sich fast durchwegs von der der
entsprechenden Freilandfruchtkörper. Außer im Fall von P. pini und
l. obliquus wurden ausschließlich resupinate Lager gebildet. Eine
Simulation der natürlichen Bedingungen bzgl. pH-Wert, Luftfeuchte und
Temperatur erwies sich als vorteilhaft.
Die vier Myceltypen ließen sich weder in Hinsicht auf Morphologie und
Wachstumspotenial noch im Test auf extrazelluläre Phenoloxidasen oder
Celluloseabbau unterscheiden. Möglicherweise bestehen statistisch
erfaßbare Differenzierungen im Bereich der Kernzahl/Zelle.
Bestärkt durch interspezifische Kreuzungstests war es nötig, zwei
Namen - P. igniarius und P. cinereus — neu zu definieren und einen
Namen — P. ossatus — neu aufzustellen.
Bestätigt werden konnte der z.T. bisher wenig abgesicherte Artstatus
von P. populicola, P. nigricans (mit gewissen Einschränkungen),
P. hippophaecola, l. hastifer, I. nodulosus und I. radiatus.
Taxonomisch schwer faßbare Sippen — vor allem innerhalb des
P. igniarius - Komplexes — erwiesen sich als biologisch
eigenständig. lm Gegensatz dazu ließen sich die im taxonomischen Sinn
recht gut definierbaren Sippen der P. pini-Gruppe nicht auch
gleichzeitig als biologische Arten ansprechen. Biologischer und
taxonomischer Artbegriff scheinen demnach bei diesen Beispielen nicht
immer vollständig in Übereinstimmung zu stehen.