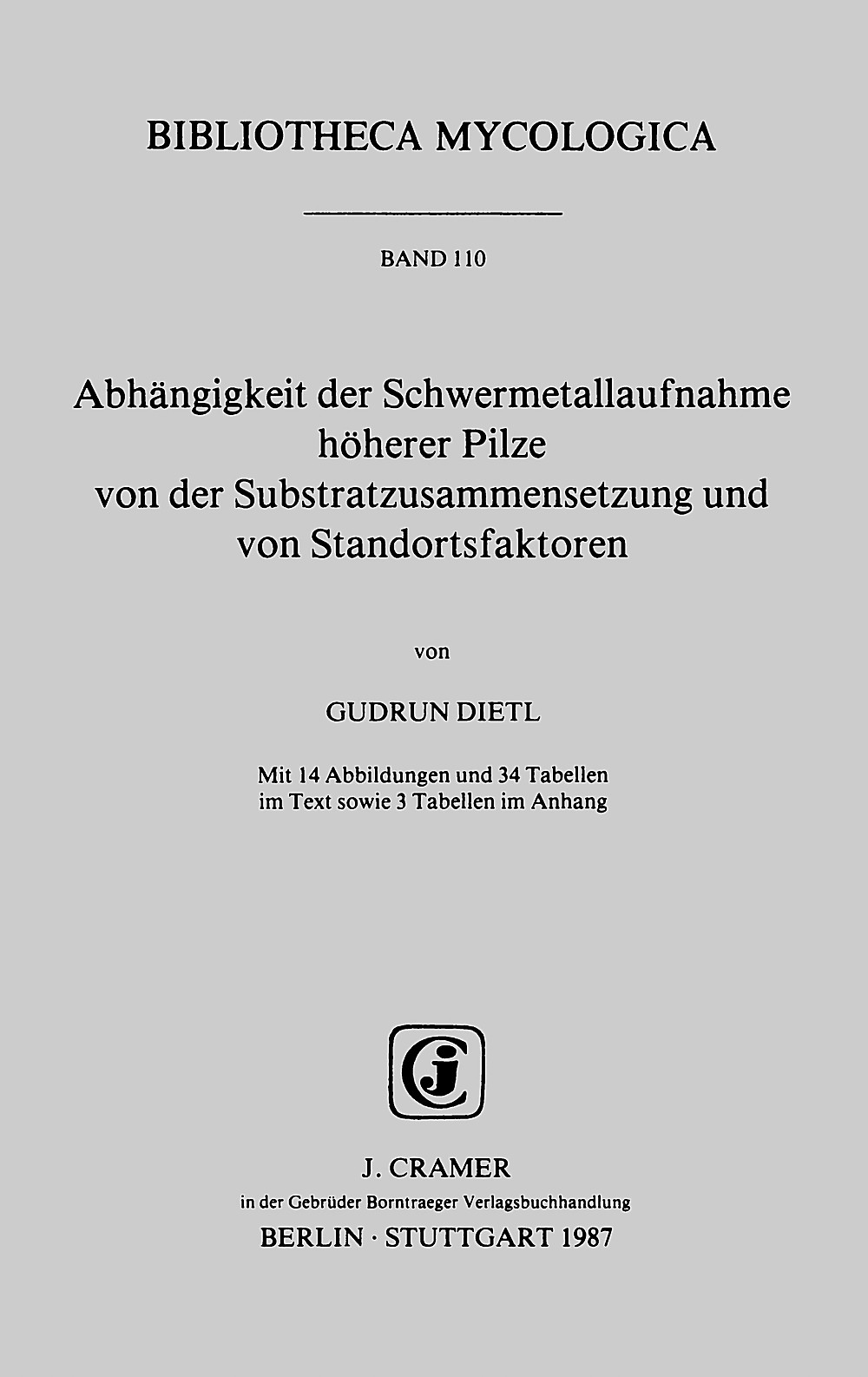Inhaltsbeschreibung top ↑
1. Die Richtigkeit des verwendeten Analysenverfahrens wurde mit Hilfe
von Standardreferenzmaterialien sowie anhand eines Methodenvergleichs
durch unabhängige Verfahren (RFA, NAA, AAS) in zwei Labors überprüft.
Als Kontrollmaterial dienten im letzteren Fall selbstgezüchtete
Champignons (Agaricus bisporus) aus Versuchsansätzen mit
unterschiedlich hoher Cd-Konzentration.
2. Steigende Cd-Zusätze (stets in Form des Nitrats) zum Substrat
hemmen das Myzelwachstum von A. bisporus zunehmend bis hin zur
vollständigen Wachstumsunterdrückung.
Ca-Zusatz (ebenfalls als Nitrat) fördert das Myzelwachstum und
verschiebt in Kombination mit Cadmium die Toxizitätsgrenze zu höheren
Cd-Konzentrationen hin.
3. Anders als beim Myzelwachstum bewirken steigende Cd-Zusätze keinen
kontinuierlichen Produktionsrückgang; vielmehr fällt die Produktion
erst in der Nähe der Toleranzgrenze schlagartig ab, um bei noch
höheren Cd-Gaben ganz auszubleiben.
Die Toleranzgrenze der Fruchtkörperbildung (562 mg Cd/kg TS) liegt
niedriger als die des Myzelwachstums (1124 mg/kg TS).
4. Schwefelsäurezusatz verringert die Produktion, vor allem
in Kombination mit hohen Cd-Zugaben.
Durch Ca-Zusatz läßt sich dagegen die Fruchtkörperproduktion
steigern. Gleichzeitige Cd-Gaben schwächen diese fördernde Wirkung nur
geringfügig ab. Die Toleranzgrenze für die Fruchtkörperbildung liegt
hier niedriger als für die Versuchsansätze mit alleiniger Cd-Zugabe.
5. In molaren Größenordnungen zunehmende Cd-Gaben führen bei
A. bisporus zu ebenfalls in den entsprechenden Größenordnungen
ansteigenden Cd-Gehalten. Es besteht dabei eine nahezu lineare
Abhängigkeit zwischen Cd-Zusatz zum Substrat und der Cd-Konzentration
in den Fruchtkörpern.
Durch weitere, gleichzeitige Substratzusätze (Schwefelsäure
bzw. Ca-Nitrat) wird die Cd-Aufnahme zwar modifiziert, die
grundsätzliche Abhängigkeit von der Cd-Substratkonzentration bleibt
aber bestehen.
6. Bei gegebenem Cd-Zusatz zum Substrat erhöht Schwefelsäurezugabe
die Cd-Aufnahme (in der 1. Ernte um fast das Doppelte), aber auch
steigende Ca-Zugaben verursachen eine beträchtliche Zunahme der
Cd-Konzentration in den Fruchtkörpern.
7. Die Cu-Aufnahme von A. bisporus steigt auf dieselbe Weise wie beim
Cadmium an, obwohl die Cu-Konzentrationen der Substrate aller
Versuchsansätze gleich hoch waren. Daraus resultiert eine strenge,
hochsignifikante Korrelation zwischen Cd- und Cu-Gehalt in den
Fruchtkörpern.
Die Stärke der Korrelation hängt vom Cd-Angebot im Substrat ab; so
besteht bei niedrigem Angebot keine Korrelation, zunehmende Cd-Gaben
läßt sie oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes sprunghaft
ansteigen, während bei den höchsten Cd-Substratkonzentrationen die
Korrelationskoeffizienten fast den Wert 1 erreichen.
8. Die Ag-Konzentration des Substrates lag unterhalb der
Nachweisgrenze, so daß aus den Ag-Gehalten der Fruchtkörper auf eine
sehr effektive Anreicherung geschlossen werden muß. Blei konnte
dagegen weder in den Fruchtkörpern noch im Substrat nachgewiesen
werden.
9. Die Cd-‚ Cu- und Ag-Gehalte in Pilzen aus nacheinander folgenden
Ernten eines Versuchsansatzes wechseln Unregelmäßig, wobei Pilze
späterer Ernten oft höhere Schwermetallkonzentrationen aufweisen. Dies
wird auf die Veränderung der Substratzusammensetzung durch die Um- und
Abbauvorgänge des Pilzmyzels zurückgeführt.
10. Junge Pilzfruchtkörper enthalten höhere
Schwermetallkonzentrationen als ausgereifte Exemplare.
11. Diese Zuchtversuche zeigen, daß A. bisporus zur Herstellung von
Standardmaterialien verschiedenster Metallkonzentrationen und
-kombinationen geeignet ist.
12. Die Streuung im Cd-, Cu- und Ag-Gehalt einer dicht beieinander
stehenden Gruppe von Rettichhelmlingen (Mycena pura s.l.) ist genauso
groß wie bei den gezüchteten Champignons aus einer Ernte eines
Versuchsansatzes.
Hierin drückt sich die natürliche Variabilität bei gegebenen
Standortverhältnissen an einem jeden Sammelpunkt bzw. im Fall von
A. bisporus bei konstanten Versuchsbedingungen aus.
13. Die Cd-Gehalte der vier nahe verwandten Arten der Rettichhelmlinge
(Mycena pura s.str.‚ M. rosea, M. pelianthina, M. diosma)
unterscheiden sich nicht, wenn sie zufällig an einem Sammelpunkt
gemeinsam vorkamen.
14. Vor allem in den Fichtenwäldern ist das Phänomen zu beobachten,
daß sich innerhalb einer Fläche und sogar an einem Sammelpunkt zwei
Kollektive von Rettichhelmlingen finden, die sich in ihrem Cd-Gehalt
um etwa eine Zehnerpotenz unterscheiden; dazwischen liegende Werte
treten nicht auf.
15. Die Häufigkeitsverteilung der Cd-Gehalte in Rettichhelmlingen aus
einer Waldfläche ergibt für Laubwälder eine linksgipflig schiefe
Verteilung. Für Nadelwaldflächen ist eine zweigipflige Verteilung mit
einem kleinen Gipfel im niederen und einem breiten Maximum im hohen
Cd-Konzentrationsbereich typisch, worin sich die Existenz der beiden
oben genannten Pilzkollektive ausdrückt.
16. Der Median aus den Cd-Gehalten aller Rettichhelmlinge einer
Untersuchungsfläche weist jeweils einen für diese Waldfläche
charakteristisch hohen Betrag auf, der in Pilzen aus verschiedenen
Sammeljahren konstant bleibt.
17. Rettichhelmlinge aus Nadelwäldern enthalten mehr Cadmium als
solche aus Laubwäldern.
Dies zeigt sich zum einen an den Cd-Medianwerten direkt benachbarter
und zum anderen in der Häufigkeitsverteilung der Mediane aller Nadel-
und Laubwaldflächen. Der häufigste Cd-Medianwert liegt bei den
Nadelwäldern mit 16 — 18 mg/kg TG annähernd doppelt so hoch wie bei
den Laubwäldern (7 — 12 mg Cd/kg TG).
18. In den verschiedenen Regionen der Schwäbischen Alb treten
charakteristische Unterschiede in den Cd-Gehalten der Rettichhelmlinge
auf.
Ausschließlich niedrige Werte kommen z.B. am Südrand der Ulmer und
Heidenheimer Alb vor, durchweg hohe Gehalte sind auf der Reutlinger
Alb zu finden, die höchsten Konzentrationen sind auf dem Härtsfeld
innerhalb eines Geländes ehemaliger Bohnerzgruben zu beobachten.
19. Die Cd- und Cu-Gehalte in Rettichhelmlingen sind mäßig stark
miteinander korrelliert. Das Ausmaß der Korrelation hängt dabei vom
jeweiligen Standort ab.
20. Die gleichmäßig niedrigen Ag-Gehalte in Rettichhelmlingen lassen
schließen, daß dieses Element im Gegensatz zu Cadmium gegenüber der
Konzentration im Boden nicht angereichert wird.
21. Die Pb-Gehalte in Rettichhelmlingen aus Wäldern an stark
befahrenen Autostraßen sind beträchtlich erhöht. Mit zunehmendem
Abstand vom Straßenrand nimmt die Pb-Konzentration dabei exponentiell
ab.
22. In Wäldern weitab von Straßen liegen die Pb-Gehalte der
Rettichhelmlinge gleichermaßen niedrig; Unterschiede zwischen Laub-
und Nadelwäldern sind kaum feststellbar.
23. Aus den Zuchtversuchen und den Ergebnissen der
Freilanduntersuchungen ist zu folgern, daß häufig vorkommende und
schwermetallakkumulierende Pilzarten wie z.B. die Rettichhelmlinge
(Mycena pura s.l.) sehr gut als Bioindikatoren für Schwermetalle in
Böden geeignet sind.