Bespr.: Tuexenia 19, 1999, S. 502 top ↑
Tuexenia 19, 1999, S. 502
Prof. Dr. H. Dierschke
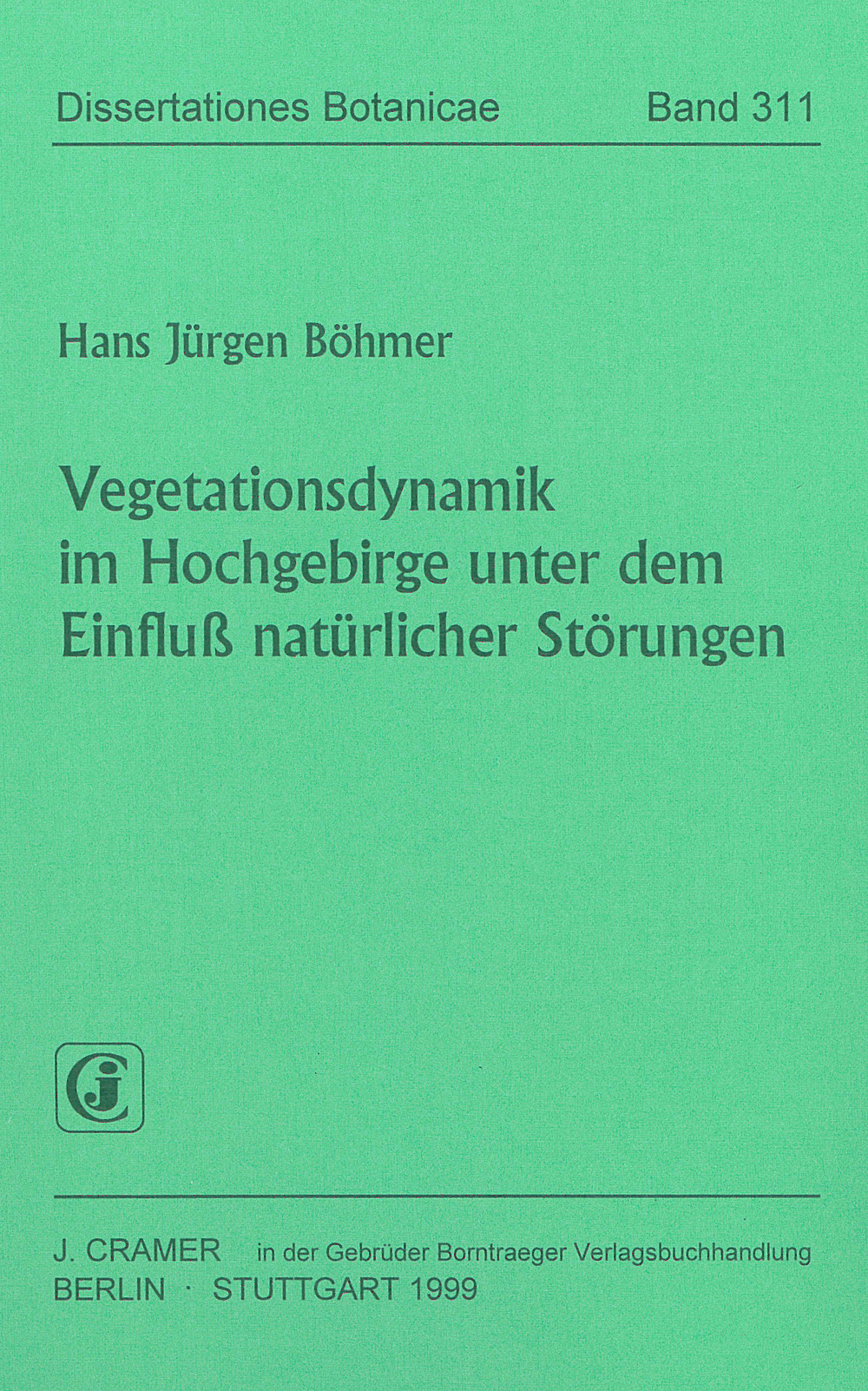
1999. 1. Auflage, 180 Seiten, 78 Abbildungen, 2 Tabellen, 14x22cm, 350 g
Language: Deutsch
(Dissertationes Botanicae, Band 311)
ISBN 978-3-443-64223-5, brosch., price: 42.00 €
in stock and ready to ship
Tuexenia 19, 1999, S. 502
Prof. Dr. H. Dierschke
Naturschutz und Landschaftsplanung 9/2000, 32. Jg., S. 285
Der dichte alpine Krummseoggenrasen (Untersuchungen im Glatzbach-Einzugsgebiet, Hohe Tauern, um 2600 2650 m Höhe) gilt als Zeuge langdauernder Stabilität auch gegenüber säkularen Klimaschwankungen, erfährt aber natürliche Störungen und damit Veränderungen vornehmlich durch Frostdynamik (Auffrierungen). Das Maximum der Artenzahl ist in den gestörten Abschnitten anzutreffen. Eine Regeneration des Curvuletums kann gegenwärtig kaum oder nur sehr langsam erfolgen. Bei den Windheiden der Saualpe/ Kärnten (Untersuchung im Kienberg-Hafeneck-Gebiet, 2010-2030 m) erlaubt erst die inhärente Störung durch den permanenten Windeinfluß die dauerhafte Dominanz der Schlüsselart Loiseleuria procumbens in der artenarmen Dauergesellschaft und verhindert die Ansiedlung anderer konkurrenzstarker Arten. Intensive Störung führt zur Auflösung der Windheiden in Windsicheln mit speziellen windorientierten Verbreitungsmustern und Entwicklungszyklen. Im Valle di Gressoney/Aosta (Untersuchungsgebiet im Lys-Vorfeld bei 2000-2470 m Höhe) dienten die historischen Vorstöße des Lys-Gletschers in die Höhenstufe des subalpinen Lärchenwaldes herab als Beispiel einer katastrophalen Störung. Die nachfolgende Vegetationsentwicklung im Gletschervorfeld von der Initialen Kryptogamenphase bis zum subalpinen Wald erfolgte nicht kontinuierlich, sondern mosaikartig, da die Chronosequenz von der Differenzierung der Standortfaktoren überlagert wird. Die jüngste Weiterentwickung des Waldes im Vorfeld ist glazifluvial und anthropogen gestört.
Die Studie belegt mit eindrucksvoller Material- und Datenfülle, daß natürliche Störungen integraler Bestandteil der Vegetationsdynamik im Hochgebirge und für viele Ökosysteme sogar notwendige Voraussetzung für Arten- und Strukturreichtum sind. Die relativ am wenigsten gestörte Vegetation erweist sich in der Regel als die artenärmste, während bei mittlerer Störungsintensität bzw. in mittleren Sukzessionsstadien die höchsten Artenzahlen anzutreffen sind, entsprechend der "Intermediate Disturbance Hypothesis". Die inhaltsreiche, theoretisch gut gestützte und breit fundierte Arbeit lenkt den Blick auch auf offene Fragen, weist aber zugleich Wege für die weitere vegetationsdynamische Forschung weit über die engere Zielsetzung hinaus.
PETER HÖLLERMANN
``Erdkunde'', Band 54, Heft 3, Jahrgang 2000
"Vegetationsdynamik" war in Vegetationskunde und Vegetationsgeographie immer ein zentrales Thema, aber meist mit deutlichen Defiziten auf Seiten der Theorie. Wie oft in der Ökologie, waren die "Theorien", "Gesetze" und "Modelle" auch hier tendenziell tautologisch und/oder unerreichbar weit von der Beobachtungsebene entfernt und/oder ihr Geltungsbereich blieb weitestgehend unklar. Die vorliegende Arbeit ist ein kompetenter Versuch, die genaue Beobachtung empirischer Testfälle mit umsichtiger Theoriebildung zu verbinden.
Die theoretischen Teile der Arbeit sind auch ein methodisch interessantes Beispiel für"Theoriebildung mittels Literaturauswertung"; der Autor zeigt, wie man auch in der Vegetationskunde Theoriebildung und Theorieklärung auch durch genaues Lesen theoretischer Texte weitertreiben kann. Dabei ergeben sich unter anderem semantisch klarere und praktisch brauchbarere Definitionen und Differenzierungen zahlreicher, bisher oft in unklaren Fassungen verbreiteter Konzepte, z. B. für"Störung", "Störungsregime", "Mosaik-Zyklus", "endogen" und "exogen". Der textlich sehr dichte empirische Teil der Arbeit betrifft drei Vegetationstypen des Hochgebirges: Krummseggenrasen, subalpin-alpine Zwergstrauchgesellschaften ("Windheiden") und subalpinen Lärchenwald. Ein Schwer- und Glanzpunkt ist dabei die Darstellung, Untersuchung und Deutung von kleinflächigen Dominanzmustern und ihrer Dynamik. Der Autor geht dabei stellenweise weit über die üblichen Techniken der Vegetationsaufnahme hinaus; er tut dies aber nie aufgrund eines abstrakten Präzisionsideals, sondern immer im Hinblick auf die Theorien und theoretischen Konstrukte, die er aus der vorliegenden Literatur präzitierend herausgearbeitet hat. Im Hinblick auf die EDV-gestützten Prozeduren hätte man sich zuweilen mehr Information über die Konstruktion der benutzten Programme gewünscht, um die Ergebnisse auch als Leser besser interpretieren und ihre Tragweite verlässlicher abschätzen zu können.
Aufgrund seiner sorgfältigen Empirie kann der Autor in der untersuchten Vegetation mehrere Typen von Vegetationsdynamik aufzeigen: Eine endogene "Karussell-Dynamik", eine Vegetationsdynamik aufgrund "störungsähnlicher" endogener Effekte sowie zwei Typen exogener Vegetationsdynamik: eine aufgrund katastrophischer Störungen und eine mit "inhärentem Störungsregime" (bei dem die Schlüsselorganismen an die Störungen angepasst sind). Man erhält auch klare Informationen darüber, wie bei den untersuchten Vegetationstypen Störungsregime, Vegetationsdynamik und Biodiversität miteinander verknüpft sind. Gerhard Hard
Geographische Rundschau, Juli/August 7-8/2001
In diese Reihe gehört auch die Arbeit von Hans Jürgen BÖHMER, welche innerhalb des DFG-Projektes "Mosaik-Zyklus-Modelle hochdynamischer Lebensgemeinschaften des Alpenraumes" am Geographischen Institut der Universität Erlangen entstanden ist.
Den Schwerpunkt seiner Untersuchungen legte BÖHMER auf die Charakterisierung des Einflusses natürlicher Störungen auf die Vegetationsdynamik alpiner Ökosysteme. Zu diesem Zweck verglich er Krurnrnseggenrasen aus dem Gebiet Hohe Tauern mit Windheiden aus Kärnten und mit Gletschervorfeld-Vegetation aus dem Aosta-Tal im Hinblick auf räumliche und zeitliche Vegetationsmuster und deren Ursachen. Anhand dieser drei Beispiele diskutiert er die Anwendbarkeit des Konzeptes der "natürlichen Störungen" nach SOUSA und des "Mosaik-Zyklus-Konzeptes" nach REMMERT.
Die Publikation beginnt mit einer recht umfangreichen Einführung in die theoretischen Grundlagen der Arbeit und stellt die verwendeten Begrifflichkeiten und Konzepte in einen größeren Rahrnen. Besondere Berücksichtigung findet die Differenzierung dynamischer Vorgänge in endogene und exogene Dynarnik. Hieran schließt sich eine Darstellung des Mosaik-Zyklus-Konzeptes an, was angesichts der sonst herrschenden begrifflichen Unschärfe sinnvoll erscheint.
Es folgt eine knappe Darstellung der Konzeption und der verwendeten Methoden, die bis auf die etwas undifferenzierte Betrachtung der Dauerflächen-Methode in sich schlüssig ist. Im Rahmen der Arbeit wurden vor allem pflanzensoziologische Aufnahmen angefertigt und mit Hilfe eines klassischen Tabellenvergleichs und anhand multivariater Methoden im Sinne einer "location for time"-Interpretation ausgewertet. Ergänzend erfolgten unter anderem dendroökologische Untersuchungen und Bodenanalysen.
Im Hauptteil der Arbeit werden die drei untersuchten Ökosysteme im Sinne von Fallstudien betrachtet und analysiert. Die untersuchten Krummseggenrasen erweisen sich als irn Vergleich zu anderen alpinen Ökosystemen ausgesprochen stabile Lebensgemeinschaften, die unter optimalen Bedingungen durch die Dominanz von Carex curvula gekennzeichnet sind. Nischen für andere Gefäßpflanzenarten ergeben sich unter anderem durch Kryoturbation, welche eine mehrstufige und artenreichere Vegetationsentwicklung zurück bis zu einem gräserdominiertem Stadium einleitet. Die endogene Vegetationsdynamik des Lebensraumes interpretiert BÖHMER im Sinne des Mosaik-Zyklus-Konzeptes und des Karussell-Modells nach VAN DER MAAREL & SYKES.
Für die Windheiden ergibt sich die Dominanz von Loseleuna procumbens aufgrund des permanenten Einfluges des Faktors sind, welcher die Ansiedlung anderer Arten verhindert. Überschreitet die Intensität der Störungen gewisse Schwellen, kommt es zur Auflösung der Lebensgemeinschaft, bei der jeweils sichelförmige Vegetationsflecken zurückbleiben. Die Regeneration offener Stellen vollzieht sich in einem vierphasigen Zyklus. BÖHMER spricht hier von einem "inhärenten Störungsregime".
Die Vegetation des subalpinen Gletschervorfeldes als drittem untersuchten Lebensraum entwickelt sich nach der "katastrophalen Störung" des Gletschervorstoßes kontinuierlich innerhalb von fünf Phasen. Die sich in der zweiten Phase etablierenden baumförmigen Gehölze, darunter vor allem Larix decidua als Pionierbaumart, erreichen in der vierten Phase einen ersten Bestandesschluß. BÖHMER bezeichnet diese Bestände als Altersklassenwälder. Da die weitere Entwicklung anthropogen überprägt ist, bleiben Zukunftsprognosen spekulativ. Für den Fall einer unbeeinflußten Weiterentwicklung vermutet BÖHMER jedoch in Anlehnung an die Untersuchungen von MÜLLER-DOMBOIS in Metrosideros-Wäldern auf Hawai eine Art von Kohortensterben mit Erreichen des typischen Durchschnittsalters der beteiligten Gehölze.
BÖHMERS in der Vegetationskunde eher unüblicher Ansatz, innerhalb einer Untersuchung sehr unterschiedliche Lebensräume unter ähnlichen Fragestellungen zu betrachten, führt zu vielen vergleichenden Schlußfolgerungen. Partiell fehlt es der vorliegenden Arbeit aus vegetationskundlicher Sicht zwar an empirischer Fundierung. So hätten sich manche Aussagen durch zusätzliche experimentelle Daten sicher gut belegen lassen. Allerdings ist auch verständlich, daß dies angesichts des sehr breit gefaßten Arbeitskontextes kaum innerhalb der für eine Dissertation zur Verfügung stehenden dreijährigen Arbeitszeit leistbar war. Insofern können offene Fragen auch als Chance für zukünftige Untersuchungen begriffen werden.
Die Untersuchung natürlicher Störungen als Ursache von Vegetationsentwicklungen ist nicht nur von wissenschaftlichem Interesse, sondern erlaubt auch Folgerungen für den Naturschutz. So liefert BÖHMERs Arbeit drei Beispiele für die inzwischen recht verbreitete Erkenntnis, daß natürliche Störungen vor allem mittleren Ausmaßes die Artenvielfalt eines Gebietes positiv beeinflussen können und unterstreicht so ein weiteres Mal die Bedeutung eines flächenhaften Prozeßschutzes als Teil integrierter Naturschutzkonzepte. Zugleich sollte nicht vergessen werden, daß die irn Hochgebirge herrschende Dynamik auch einen Eigenwert jenseits der populären Biodiversitätsdebatte besitzt.
Silvan KINDT, Freiburg i. Br.
Phytocoenologia, Vol. 31, No. 2