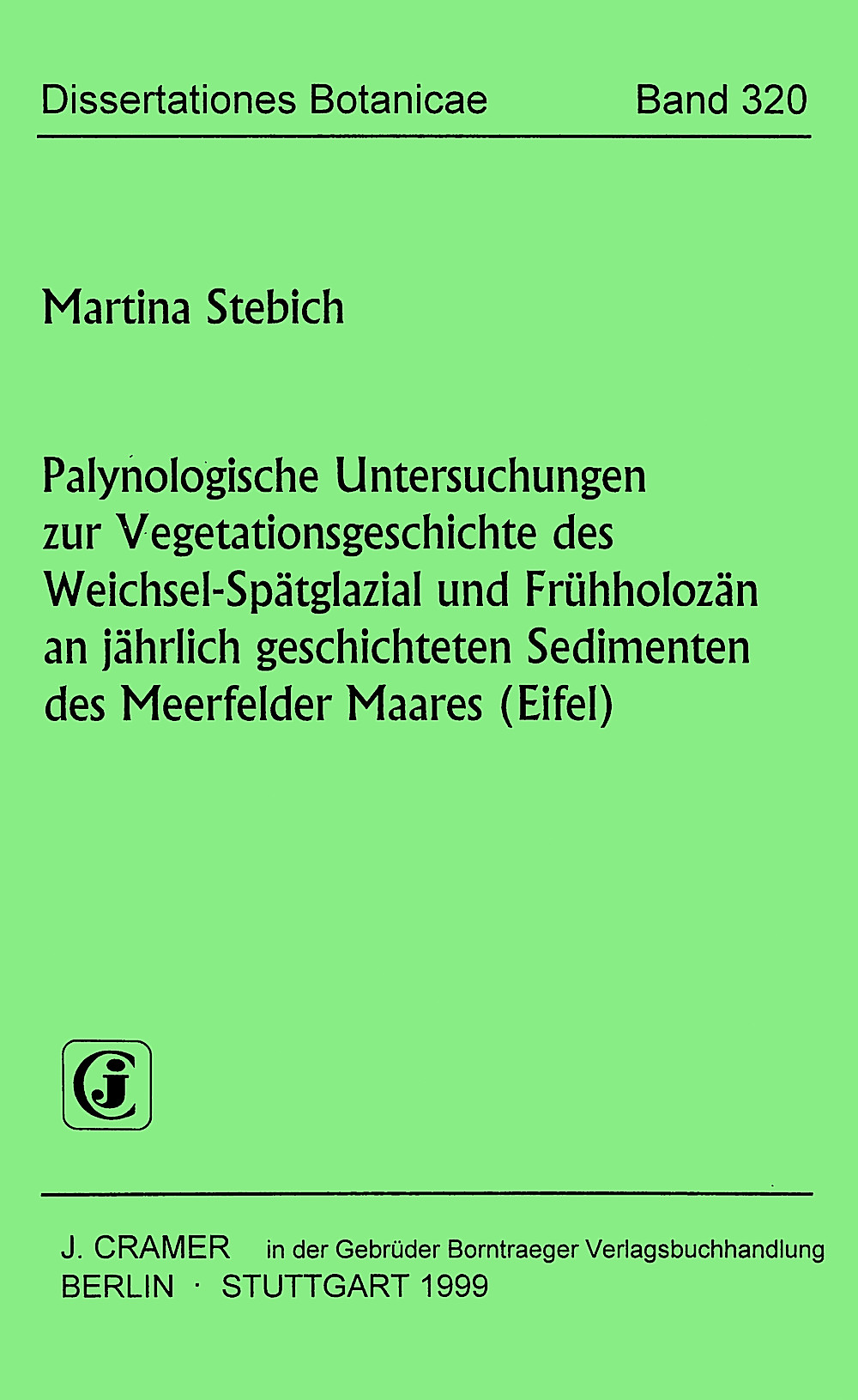Inhaltsbeschreibung top ↑
In der vorliegenden Arbeit wurde eine nahezu lückenlos jährlich
geschichtete Profilsequenz aus dem Meerfelder Maar vorn ausgehenden
Pleniglazial bis ins Frühholozän palynologisch bearbeitet. Als
zeitliches Fundament diente die durch BRAUER und ENDRES (Arbeitsgruppe
NEGENDANK, GFZ-Potsdam) erstellte kalendarische Warvenchronologie.
Durch die Verknüpfung von Palynologie und Warvenchronologie wurde die
Berechnung des jährlichen Polleneintrages (Influx) und damit ein
unmittelbarer Vergleich der Fossil- befunde mit Angaben zum rezenten
Polleneintrag ermöglicht. Flankiert wurden die
vegetationsgeschichtlichen Befunde durch sedimentologisch-geochemische
Parameter, welche ebenfalls durch die Arbeitsgruppe NEGENDANK zur
Verfügung gestellt wurden.
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit bildete die Differenzierung der
Birkenarten mittels Pollenanalyse. Die Messungen zeigten, daß eine
metrische Analyse offenbar wenig geeignet ist, verschiedene
Birkenarten zu unterscheiden. Erst pflanzliche Großreste ermöglichen
im gegebenen Fall sichere Aussagen.
In den Pollenkurven des Profils MFM6 zeigt sich eine sukzessive
Vegetationsabfolge, welche von kurzfristigen Klimafluktuationen mit
hoher Frequenz überlagert wurde. Wegen der nach wie vor bestehenden
Korrelationsprobleme weichsel-spätglazialer Folgen in Mitteleuropa
wurden bei der biostratigraphischen Einordnung der örtlichen Befunde
maß- geblich die Holostratotypen (Bollingso, IVERSEN 1942, 1954 sowie
Glüsing, MENKE 1968) berücksichtigt. Dabei zeigte sich, daß
grundsätzlich die klassische Einteilung des Spätglazial für die
biostratigraphische Gliederung des Profils aus dem Meerfelder Maar
herangezogen werden kann. Andererseits zeigen die vorliegenden
paläobotanischen Untersuchungen mit hoher zeitlicher Auflösung ein
differenzierteres Bild des vegetations- und klimageschichtlichen
Geschehens im Weichsel-Spätglazial. Vielfach zeichnen sich allerdings
neben scharfen Zonengrenzen auch Übergangsbereiche ab, die eine
Festlegung der Grenzen erschweren.
Der Übergang vom Pleniglazial zum Spätglazial wurde im Profil MFM6
deutlich erfaßt. In den Pollenspektren des basalen Profilbereichs
kommt der Charakter einer eiszeitlichen Kältesteppe zum Ausdruck.
Ein Anstieg der Kurven von Betula, Salix und Juniperus signalisiert
die erste spätglaziale Klimaverbesserung. In diesem Bereich nehmen die
allochthonen Komponenten ab und die absolute Pollenkonzentration
zu. Nach den Jahresschichtenzählungen liegt die Grenze
Pleniglazial/Spätglazial im Meerfelder Maar bei ca. 14.450
Warvenjahren B.P.
Die Befunde belegen, daß die erste Erwärmungsphase nach dem Beginn des
Eiszerfalls nicht mit dem Bolling-Interstadial (erster markanter
Baumbirkenanstieg) sensu IVERSEN einsetzt, sondern bereits durch das
Aufkommen einer Strauchvegetation mit Mineralbodenheliophyten"
gekennzeichnet ist. Damit wird in der Eifel am Beginn des Spätglazial
ein Äquivalent zum Meiendorf-Intervall sensu MENKE erfaßt, welches
gemäß Jahresschichtenzählungen ca. 640 Jahre umfaßte und älter als das
Bolling ist. Nach den Birkenpollenmessungen sowie Großrestbefunden aus
Meerfelder Maar und Hitsche dürfte sich in der Eifel jedoch bereits im
Meiendorf die Baumbirke etabliert haben, während Betula nana nur
gering vertreten gewesen ist.
Die Älteste Dryaszeit korrespondiert im Sinne IVERSENs mit einem
ausgeprägten Nichtbaumpollenmaximum vor der bollingzeitlichen
Ausbreitung der Baumbirken und dauerte ca. 140 Warvenjahre
an. Demgegenüber tritt die Signatur der Älteren Dryaszeit (Dauer ca.
165 Warvenjahre) weniger prägnant hervor. Lediglich ein tendentieller
Birkenrückgang und ein schwaches Nichtbaumpollenminimum können als
Anzeichen einer leichten Klimaverschlechterung vor dem Allerod
gedeutet werden. Der Übergang zum nachfolgenden Allerod ist in den
paläobotanischen sowie lithologischen Signalen relativ unscharf
ausgebildet. Als biostratigraphische Kriterien zur Festlegung der
Allerod-Untergrenze dienen der deutliche Anstieg der Baumpollensumme
(insbesondere durch Baumbirke und Kiefer bedingt) sowie die Abnahme
der Gräser und Mineralbodenheliophyten (Artemisia, Helianthemum u.a.).
Als Indiz füir eine mit der Gerzensee-Schwankung korrelierbare,
schwache Klimafluktuation innerhalb des Allerod kann eine deutliche
Zunahme des Nichtbaumpollenanteils, gekoppelt mit einem Rückgang des
Birkenpollens, verzeichnet werden. 200 Jahre nach dem Ausbruch des
Laacher See-Vulkans, der im Meerfelder Maar mittlerweile auf 12.880
Warvenjahre B.P. datiert wurde, erfolgte aufgrund palynologischer und
lithologischer Merkmale die Festlegung der Allerod-Obergrenze. Nach
den Warvenschichtenzählungen beträgt die Gesamtdauer des Allerod 690
Jahre.
Die nachfolgende Jüngere Dryas setzt sich im Verlauf der Pollenkurven
deutlich ab und konnte zweifelsfrei als Stadial mit Bewaldungsrückgang
identifiziert werden. Die relative Dauer der Jüngeren Dryas kann mit
ca. 1.090 Warvenjahren angegeben werden. Im Gegensatz zu den 440
Jahre nach Beginn der Jüngeren Dryas abrupt zunehmenden Warvendicken
zeigt sich in den Pollenkurven kein korrespondierendes Signal.
Als überregional nachvollziehbares Signal für die Grenzziehung Jüngere
Dryas/Präboreal dient der sprunghafte Anstieg der Birken- und
Kiefernwerte sowie der Pollenkonzentration, während Juniperus rapide
zurückgeht und unmittelbar die organische Warvenproduktion
einsetzt. Nach den Warvenzählungen kann für den Beginn des Holozän ein
Alter von 11.590 Jahren angegeben werden. Somit beträgt die Dauer des
gesamten Spätglazial ca. 2860 Warvenjahre.
Ein u.a. von BEHRE und IVERSEN postulierter und heute kontrovers
diskutierter präborealer Klimarückschlag (Rammelbeek-Phase) läßt sich
in den Eifelmaaren anhand der Pollenbefunde nicht eindeutig
belegen. Den Übergang vom Präboreal zum Boreal kennzeichnet der Beginn
des Steilanstieges der Haselkurve. Eine zusammenfassende graphische
Dar- stellung der örtlichen vegetationsgeschichtlichen sowie bio- und
chronostratigraphischen Befunde kann Abb. 26 entnommen werden.
Die im Meerfelder Maar registrierten Signaturen der Pollenkurven
korrespondieren mit vergleichbaren Befunden im
nordwestmitteleuropäischen Raum. Insbesondere durch die
palynologischen Ergebnisse aus dem Holzmaar (LITT et al. 1997), Usselo
& DeBorchert (VAN GEEL et a1. 1989, HOEK 1997) als auch aus dem
Hämelsee (MERKT & MÜLLER 1999) ist ein Anschluß der Profile über
Niedersachsen nach Schleswig-Holstein gegeben und damit eine
überregionale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.
Bei einem Vergleich der Signale aus dem Meerfelder Maar mit den
Eiskemdaten aus Grönland (GRIP), welcher auf unabhängigen
Kalenderzeitskalen beruht, zeigt sich insbesondere in Bezug auf die
Grenzen und die Dauer der Jüngeren Dryas sowie der
Gerzensee-Schwankung eine sehr gute zeitliche
Übereinstimmung. Demgegenüber weicht nach der derzeitigen Datenlage
der Beginn des Spätglazial in beiden Archiven um ca. 250 Jahre
voneinander ab. Die Ursache hierfüir liegt vermutlich in der
unzureichenden Zeit- kontrolle der Eiskemdaten, da im älteren Bereich
den Datierungen keine wirklich zählbaren Jahresschichten, sondern
sog. "ice-flow-models" zugrunde liegen.
Als entscheidender Vorteil der Jahresschichtenfolgen im kontinentalen
Bereich erweisen sich im Gegensatz zu den Eiskemdaten die
biostratigraphische Kontrolle sowie die saisonale Schichtung der
Seesedimente, die die Aufstellung einer wirklich kalendarischen
Chronolgie erlaubt.