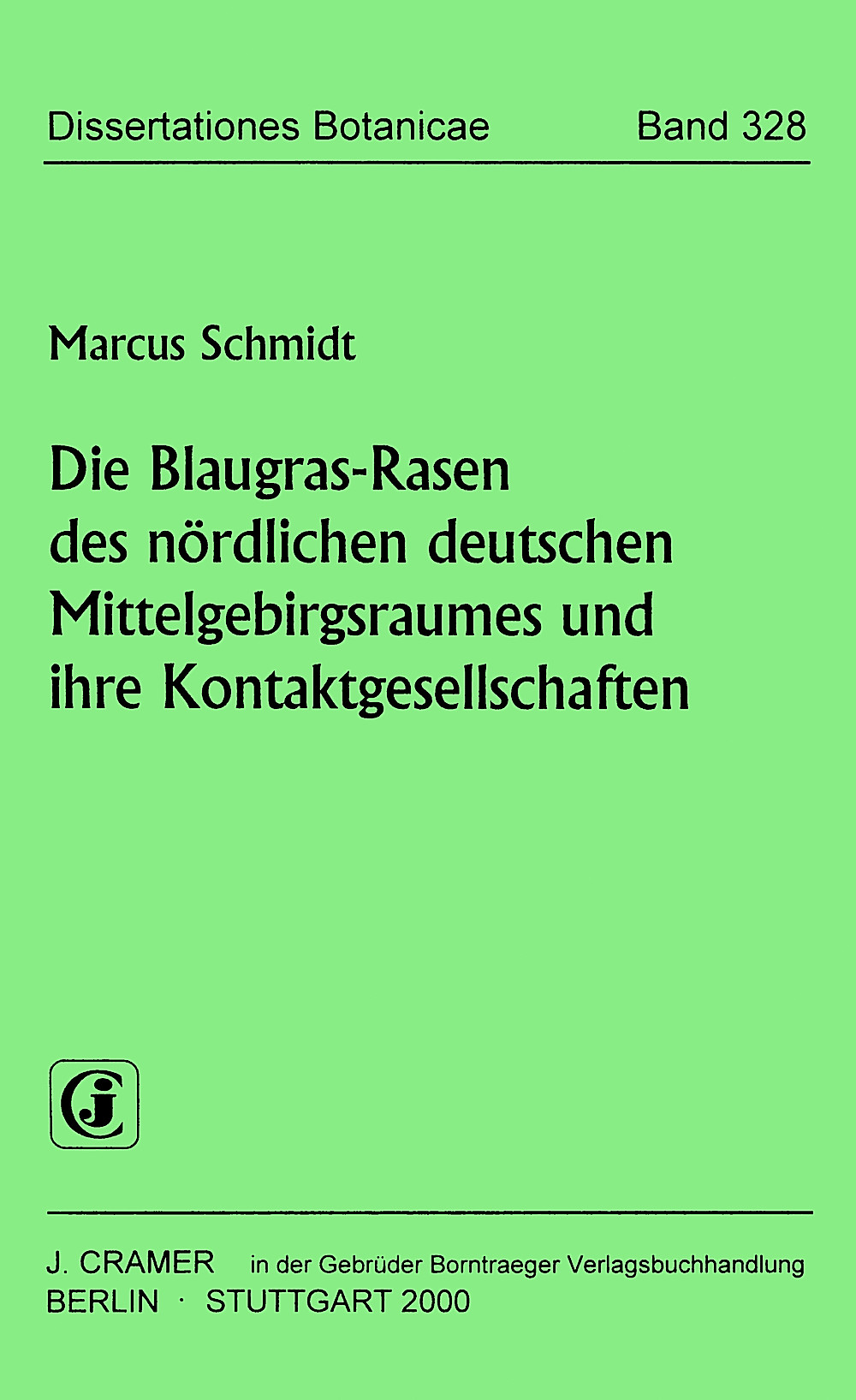Blaugrasrasen sind im außeralpinen Mitteleuropa aufgrund ihrer
Seltenheit und des Vorkommens bemerkenswerter Pflanzenarten für
Floristen, Vegetationskundler und Naturschützer gleichermaßen
faszinierend. Besonders spannend ist die Beschäftigung mit diesen
Rasen, weil sie oft Geländeformen besiedeln, die mit ziemlicher
Sicherheit Waldgrenzstandorte darstellen.
Der vorliegende Band beinhaltet eine monographische Bearbeitung
Seeferia albicans-reicher Kalkmagerrasen des gesamten nördlichen
deutschen Mittelgebirgsraumes. Daneben werden die Kontaktgesellschahen
der Rasen ausführlich dargestellt, wobei für das Geranio-Peucedanetum,
das Lithospermo-Quercetum und das Carici-Fagetum die erste
ausschließlich auf Originalaufnahmen basierende Gesamtübersicht des
bearbeiteten geographischen Raumes vorgelegt wird. Nur durch die
Berücksichtigung der Kontaktgesellschaften der an Blaugras reichen
Rasen kann nach den Worten des Autors "ein abgerundetes Bild dieser
Vegetationstypen entstehen und darüber hinaus ein Beitrag zum
Verständnis der Lebensbedingungen an Waldgrenzstandorten des
nördlichen deutschen Mittelgebirgsraumes geleistet werden". Neuartig
ist in diesem Zusammenhang, dass der Autor vorschlägt, die auf
flachgründigen, trockenen Karbonatböden des Untersuchungsgebietes
vorhandenen Wald- und Schwarzkiefernwälder zum Verband des
Erico-Pinion der Klasse der Erico-Pinetea zu stellen. Diese Wälder,
die zumeist durch Aufforstung oder Kiefernanflug aus Kalkmagerrasen
hervorgegangen sind, wurden im nördlichen Mittelgebirgsraum, anders
als in Süddeutschland, von Pflanzensoziologen bisher wenig
beachtet. Auf eine Beschreibung neuer Assoziationen ist jedoch
verzichtet worden.
Die Darstellung der im Zentrum der Arbeit stehenden Seeferia
albicans-reichen Kalkmagerrasen basiert auf der Grundlage eines sowohl
der Literatur entnommenen als auch selbst erhobenen, umfangreichen
Aufnahmematerials. Dabei wird von der klassischen Untergliederung der
Klasse Festuco-Brometea in die Vikartierenden Ordnungen der Brometalia
erecti und Festucetalia volesiacae ausgegangen. Dass dieses
Gliederungsschema in den Trockengebieten Mitteleuropas, besonders in
Mitteldeutschland, durchaus nicht ganz unproblematisch ist, lässt der
Autor anklingen, indem er betont, dass dort häufig Arten der
Festucetalia valesiacae in Brometalia erecti-Beständen auftreten und
umgekehrt. Ausgehend von diesen Voraussetzungen wird gezeigt, dass
alle Seeferia albiconsreichen Festuco-Brometea-Gesellschahen im
Bearbeitungsgebiet zur Ordnung der Brometalia erecti zählen. Dabei
sind an Blaugros reiche Rasengesellschahen sowohl in den Trockenrasen
des Xerobromion als auch in den Halbtrockenrasen des Mesobromion
vertreten.
Ein relativ eigenständiger Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den
Beziehungen zwischen Lichtgenuss und Vegetation an
trockenheitsbedingten Waldgrenzstandorten. Als Ergebnis seiner
Untersuchungen kann der Autor für ausgewählte Arten der
halbnatürlichen Kalkmagerrasen sowie der Pflanzenarten, die heute noch
in ihrer Verbreitung weitgehend auf natürlich waldfreie Standorte
beschränkt sind, zeigen, welche davon für eine Überdauerung einerseits
auf kleinflächig wald freie Standorte oder andererseits zumindest auf
trockenheitsbedingt sehr lichte Wälder angewiesen
sind. Interessanterweise ist die zu beobachtende Bindung mancher
Pflanzenarten an Waldgrenzstandorte und deren unmittelbare Umgebung
nach den Ergebnissen des Autors nicht allein durch das Lichtangebot
erklärbar.
Sehr aufschlussreich sind die dargestellten Transektuntersuchungen zu
Vegetationsabfolgen und Sukzession an trockenheitsbedingten
Waldgrenzstandorten. Im Gegensatz zu der vielfach vertretenen Meinung,
dass für natürliche Waldgrenzen die Vegetationsabfolge Rasen - Saum -
Mantelgebüsch) - Wald charakteristisch sei, fand der Autor diese Folge
in keinem der zehn untersuchten Transekte. Im Einzelfall kann der
Übergang vom Wald zum Rasen sehr unterschiedlich ausgebildet sein.
Die Abfolge Rasen - Saum - Wald wurde dabei am häufigsten gefunden,
sie wird als offenbar typisch für stabile, weitgehend natürliche
Waldränder angesehen.
Bei der Sukzession wird zunächst die regressive Sukzession behandelt,
ausgehend von historischer) intensiver anthropogener Beeinflussung der
Waldgrenzstandorte u.a. durch Weidegang und Niederwaldbetrieb. Nicht
selten sind dadurch nachhaltige Standoriveränderungen eingeleitet
worden. Solche Erscheinungen, etwa ein erosionsbedingter
Oberbodenabtrag, beeinflussen noch in der Gegenwart, da die meisten
der betreffenden Flächen längst aus der Nutzung gefallen sind, die
Dynamik der Vegetation. Die aufgrund des teilweise schon viele
Jahrzehnte zurückliegenden Brachfallens heute vielerorts zu
beobachtende, sekundär progressive Sukzession zeigt sich in den
verschiedenen Vegetationsformen der Waldgrenzstandorte in
unterschiedlichem Maße. So hat in den Lithospermo-Querceten die Buche
an Bedeutung gewonnen. Die Sukzession auf erodierten, heute von
Blaugras-Trockenrasen beherrschten Hangbereichen ist abhängig von der
Möglichkeit einer Bodenentwicklung. Wohl nur an steilen
Mittelhang-Standorten garantiert der ständige Boden-Abtrag die
Stabilität der hier als Dauergesellschaft anzusehenden
Trockenrasen. Anhand der Vergleiche historischer und aktueller
Landschabs-Fotografien kann der Autor belegen, dass die ehemals
nutzungsbedingt großflächig vorhandenen offenen Rasen der von den
Oberhängen und den Hangfüßen aus fortschreitenden Gehölzentwicklung
bereits an manchen Standorten gewichen sind. Ausgehend von den für
die einzelnen Pflanzengesellschaften getrennt angeführten Gefährdungs-
und Rückgangsursachen entwickelt der Autor
Naturschutz-Zielvorstellungen. Für den Bereich natürlicher
Waldgrenzstandorte wird ein uneingeschränkter Prozessschutz bei
völligem Verzicht auf Pflegemaßnahmen vorgeschlagen, auch wenn damit
für einige Pflanzengesellschaften ein Flächenverlust verbunden
ist. Gleichfalls wird für die Erhaltung von Pinus
sylvestris-Beständen an natürlichen Waldgrenzstandorten plädiert, eine
Aussage, die weniger für die Naturschutzarbeit in Sachsen-Anhalt als
in Thüringen bedeutungsvoll sein dürfte. Für halbnatürliche Trocken-
und Halbtrockenrasen werden eng an der historischen Nutzung
orientierte Erhaltungsmaßnahmen befürwortet.
Ohne hier eine abschließende Wertung vornehmen zu wollen, ist der
Rezensent der Meinung, dass ein völliger Verzicht auf Pflegemaßnahmen
an allen Waldgrenzstandorten wohl nicht nur zum Flächenrückgang
sondern dort auch zum vollständigen Verlust einiger
Pflanzengesellschaften führen dürfte. Gleichzeitig ist es zumindest
wahrscheinlich, dass mit sinkender Größe der Bestände verschiedener
Pflanzengesellschahen auch ein nicht unbeträchtlicher Artenverlust,
insbesondere der Fauna, verbunden ist. Da aktuell ohnehin die Mehrzahl
der Waldgrenzstandorte keiner Nutzung mehr unterliegt und dies für
manche Flächen in Naturschutzgebieten zusätzlich durch Verordnung
festgeschrieben ist, könnten einige wenige andere Standorte, besonders
wenn sich in deren Umfeld halbnatürliche Trocken- und Halbtrockenrasen
befinden, doch in Pflegemaßnahmen einbezogen werden.
Die Fülle des dargebotenen Stoffes, der auf einer soliden
Datengrundlage beruht, die Vielzahl der behandelten Aspekte und nicht
zuletzt die sehr gefällige und flüssige Darstellung machen das Werk
nicht nur für speziell an pflanzensoziologischen Fragestellungen
interessierte Leser sondern auch für Floristen sowie Praktiker des
Naturschutzes und der Forstwirtschah sehr empfehlenswert. Das Buch
kann zum Preis von 120,00 DM über den Buchhandel bezogen werden.
J. Peterson
Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 38. Jg., H. 1 2001