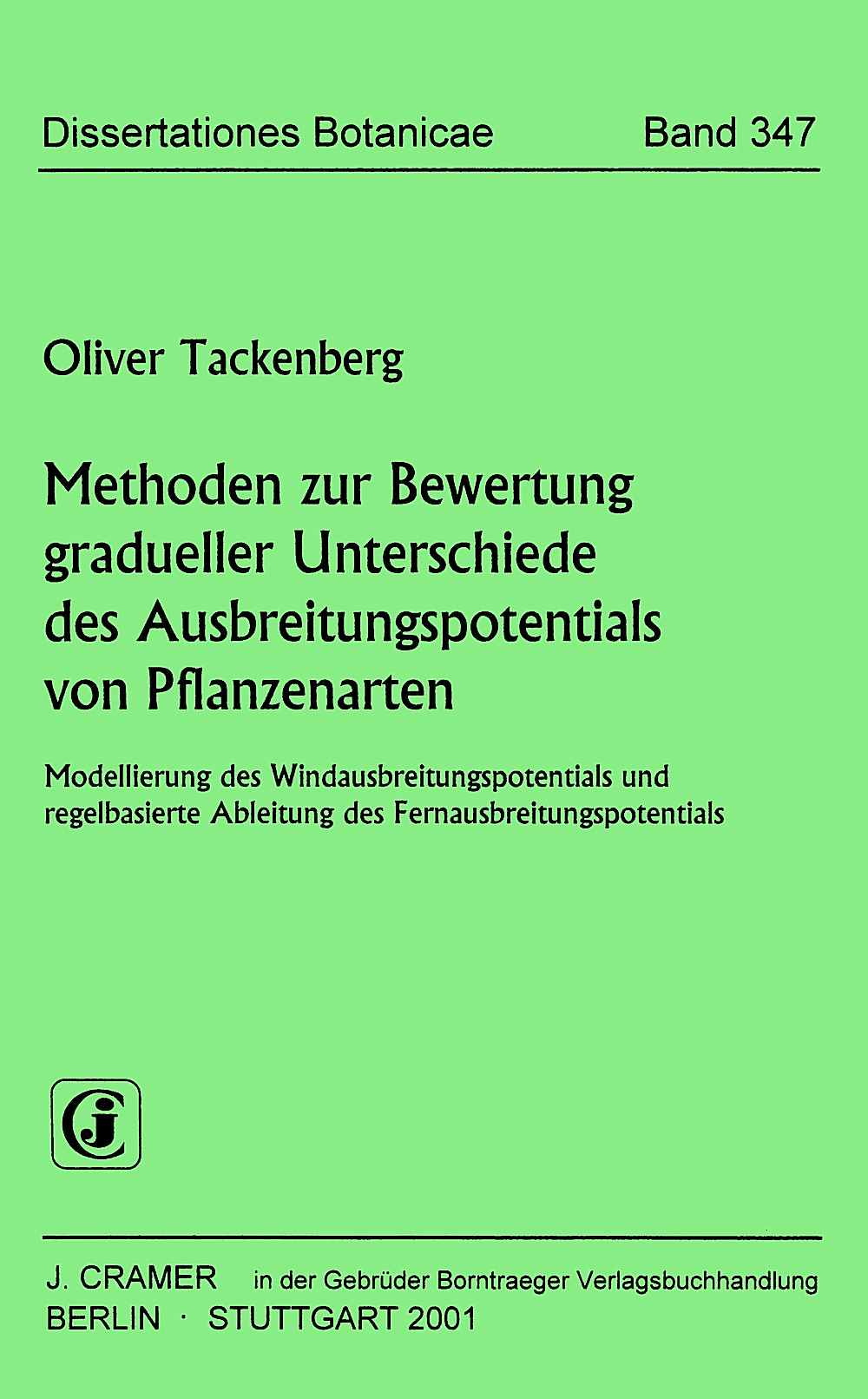Die existierenden ausbreitungsbiologischen Klassifikationssysteme
wurden originär nicht entwickelt, um ökologische oder
populationsbiologische Fragestellungen zu beantworten, sondern um die
Vielfalt der vorgefundenen Diasporentypen zu beschreiben und daraus
den Ausbreitungstyp abzuleiten. Sie benutzten dabei eine einfache
binäre Zuordnungslogik, in der eine Art entweder einem bestimmten
Ausbreitungstyp zugeordnet wird oder nicht. Allerdings erscheint die
von diesen Klassifikationssystemen erzwungene Zweiteilung z. B. in
anemochore Arten und nicht-anemochore Arten künstlich, weil das
Windausbreitungspotential von Arten mit extrem hohem hin zu Arten mit
extrem niedrigem Windausbreitungspotential reicht. Anhand von
Beispielen wurde verdeutlicht, dass diese vektorbasierten
Klassifikationssysteme bei Fragestellungen, füir die graduelle
Unterschiede im Ausbreitungspotential der Arten von Bedeutung sind,
nur selten zu sinnvollen Ergebnissen führen können.
Um die graduellen Unterschiede im Windausbreitungspotential zu
quantifizieren, wurden Simulationsrechnungen mit Hilfe eines eigens
dazu entwickelten Windausbreitungsmodells namens PAPPUS
durchgeführt. Herkömmliche Windausbreitungsmodelle berücksichtigen die
Effekte von thermischen Turbulenzen und Aufwinden sowie die
Auswirkungen unterschiedlicher Topographie auf die
Ausbreitungsdistanzen nicht, obwohl diese die Fernausbreitung von
Diasporen durch Wind wesentlich beeinflussen. Bei der
Modellentwicklung wurde deshalb besonderes Augenmerk auf die
Modellierung dieser beiden Aspekte gelegt. Die Pflanzenarten werden in
PAPPUS anhand der Fallgeschwindigkeit der Diasporen und der
Anfangshöhe der Ausbreitung charakterisiert, aus denen sich das
artspezifische Windausbreitungspotential von Pflanzenarten ableiten
lässt.
Die von PAPPUS simulierten Ausbreitungsdistanzspektren wurden mit
solchen verglichen, die in Flugversuchen unter Freilandbedingungen bei
verschiedenen Wetterlagen und in Landschaften unterschiedlicher
Topographie beobachtet wurden. Dabei konnte bis zu Entfernungen von
etwa 150 m (Fernausbreitung) eine gute Übereinstimmung zwischen den
von PAPPUS vorhergesagten und den beobachteten
Ausbreitunngistanzspektren nachgewiesen werden. Eine Validierung des
Modells für größere Entfernungen war aufgrund von Problemen, weit
fliegende Diasporen im Gelände zu verfolgen, nicht möglich.
Außerdem wurden die beobachteten Ausbreitungsdistanzspektren mit den
Prognosen eines Diffusionsmodells und eines Flugpfadmodells
verglichen, die als typische bisher auf die Windausbreitung von
Pflanzendiasporen angewandte Modelle gelten können. PAPPUS war als
einziges Modell in der Lage, den beobachteten Anteil
fernausgebreiteter Diasporen (Ausbreitungsdistanzen > lOO m)
vorherzusagen, während die anderen Modelle diesen Anteil deutlich
unterschätzten. Dies gilt insbesondere für sonnige Wetterlagen mit
thermischen Turbulenzen und Aufwinden, die günstig für die
Fernausbreitung von niedrigwüchsigen Arten sind, selbst wenn die
Windgeschwindigkeit nur gering ist. Die herkömmlichen
Windausbreitungsmodelle überschätzen hingegen die beobachteten
Ausbreitungsdistanzen bei stürrnischem Wetter und vorwiegend
mechanisch erzeugten Turbulenzen, weil sie die mit diesem Wetter
assoziierten permanenten Abwinde, im Gegensatz zu PAPPUS, nicht
berücksichtigen. Aufgrund dieser Abwinde scheint stürmisches Wetter
für die Windausbreitung von Diasporen weniger günstig als bisher
angenommen.
Windausbreitungsmodelle, welche die Topographie nicht berücksichtigen,
unterschätzen in hügeligem Gelände die Ausbreitungsdistanzen häufig,
wie Simulationsrechnungen von PAPPUS zeigten. Eine abschließende
Beurteilung des Einflusses der Topographie auf die Windausbreitung von
Pflanzenarten wird allerdings dadurch erschwert, dass die von der
Topographie beeinflusste Vertikalkomponente des Windes derzeit nur
grob abgeschätzt werden kann.
Aufgrund des starken Einflusses von Wetter und Topographie auf
Ausbreitungsdistanzen und Anteile femausgebreiteter Diasporen, können
einmalige Beobachtungen oder Messungen von Ausbreitungsdistanzen kaum
auf andere Pflanzenarten, Wetterlagen oder auf Landschaften anderer
Topographie übertragen werden. Dies gilt in verstärktem Maß für
Windtunnel-Experimente. Die dort gemessenen Distanzen können wegen der
unberücksichtigt bleibenden (thermischen) Turbulenzen nicht auf
Freilandbedingungen übertragen werden.
Um graduelle Unterschiede im Windausbreitungspotential von
Pflanzenarten quantifizieren zu können, wurden mit PAPPUS
Ausbreitungsdistanzspektren füir verschiedene Wetterlagen und
Landschaften modelliert. Aus diesen wurde der Anteil der Diasporen,
der eine vorab definierte Referenzdistanz erreicht, als Maß für das
Windausbreitungspotential der betrachteten Pflanzenart berechnet. Mit
Hilfe der vorgeschlagenen Methode kann für alle Pflanzenarten ohne
weitere Berechnungen ein „Zeigerwert des Windausbreitungspotentials“
abgeleitet werden, wenn die Fallgeschwindigkeit der Diasporen und die
Anfangshöhe der Ausbreitung bekannt sind. Im Anhang dieser Arbeit sind
die Fallgeschwindigkeiten der Diasporen von 502 Pflanzenarten
aufgelistet.
Der Vergleich des Windausbreitungspotentials von 335 Pflanzenarten mit
ihrer Diasporenmorphologie zeigte eine beträchtliche Variabilität des
Windausbreitungspotentials innerhalb eines morphologischen
Typs. Beispielsweise haben die meisten Arten mit behaarten Diasporen
zwar - wie erwartet - ein hohes Windaus- breitungspotential, aber
immerhin 10 % dieser Arten besitzen nur ein niedriges
Windausbreitungspotential. Bei anderen morphologischen Typen ist die
Variabilität wesentlich höher, so dass aus der Angabe „kleine
Diaspore“ oder „geflügelte Diaspore“ kaum Rückschlüsse auf das
Windausbreitungspotential der betreffen- den Art möglich sind.
Die Bedeutung der beiden Pflanzenmerkmale "Fallgeschwindigkeit der
Diasporen" und "Höhe des Fruchtstandes" für das
Windausbreitungspotential unterscheidet sich je nach betrachteter
Referenzdistanz. Je größer die Referenzdistanz und je kleiner im
Verhältnis dazu die Höhe des Fruchtstandes ist, desto wichtiger wird
eine geringe Fallgeschwindigkeit für ein hohes
Windausbreitungspotential.
Um räumliche Aspekte der Diasporenausbreitung zu modellieren, reicht
es nicht aus, nur die Artmerkmale "Fallgeschwindigkeit der Diasporen"
und "Anfangshöhe der Ausbreitung" zu betrachten, ergänzend muss auch
die Lage und räumliche Anordnung der Diasporenquellen und die Anzahl
der durch Wind ausgebreiteten Diasporen (in Abhängigkeit von der
Diasporenproduktion) berücksichtigt werden.
Unterschiede in der Diasporenproduktion zwischen Pflanzenarten können
so groß sein, dass sie die Unterschiede im Windausbreitungspotential
der Arten aufheben bzw. sogar in ihr Gegenteil verkehren können. Bei
einer Simulation der Windausbreitung in der Porphyrkuppenlandschaft
bei Halle/Saale wurde gezeigt, dass eine Art (Festuca pallens) mit
mäßig-niedrigem Windausbreitungspotential und hoher
Diasporenproduktion 100 m bis 200 m entfernte Porphyrkuppen häufiger
erreichte, als eine Art (Biscutella laevigata) mit um eine Klasse
höherem Windausbreitungspotential, aber wesentlich niedrigerer
Diasporenproduktion.
Um die Ausbreitungsfähigkeit einer Pflanzenart für ökologische oder
evolutionsbiologische Anwendungen zu beurteilen, reicht es allerdings
nicht aus, nur einen Ausbreitungsvektor zu betrachten, weil
Pflanzenarten in der Regel durch mehrere Ausbreitungsvektoren
ausgebreitet werden. Deshalb wurden für drei weitere
Ausbreitungstypen, die ein hohes Potential für Femausbreitung besitzen
(Epizoochorie, Endozoochorie und Hemerochorie), Ausbreitungspotentiale
nach regelbasierten Methoden abgeleitet. Aus diesen Werten und dem
Windausbreitungspotential wurde das Femausbreitungspotential der Arten
berechnet. Obwohl diese Ableitungen nur grob und mit Unsicherheiten
behaftet sind, liefern sie doch interpretierbare und mit den
theoretischen Erkenntnissen übereinstimmende Resultate.
So konnte in einer Analyse von 142 Pflanzenarten des Grünlands gezeigt
werden, dass Arten, deren Bestandesentwicklung deutschlandweit
rückläufig ist, überdurchschnittlich häufig nur geringe
Femausbreitungspotentiale besitzen. Hingegen haben Arten, die eine
gleichbleibende oder zunehmende Bestandesentwicklung aufweisen,
überdurchschnittlich häufig hohe Femausbreitungspotentiale.
In der Porphyrkuppenlandschaft bei Halle/Saale wurde ein Zusammenhang
zwischen der Häufigkeit von 15 ausgewählten Arten (gemessen als Anzahl
der Populationen auf isolierten Porphyrkuppen) und dem
Femausbreitungspotential der jeweiligen Art aufgezeigt. Arten mit
hohem Femausbreitungspotential kommen dort häufiger vor, als Arten mit
geringem Femausbreitungspotential.
Die beiden Anwendungsbeispiele haben gezeigt, dass graduelle
Unterschiede im Ausbreitungspotential nicht nur aus theoretischen
Erwägungen heraus für das Überleben von Pflanzenpopulationen von
großer Bedeutung sind, sondern dass dies mit Hilfe der vorgestellten
Methoden auch anhand von Freilanddaten nachgewiesen werden kann.