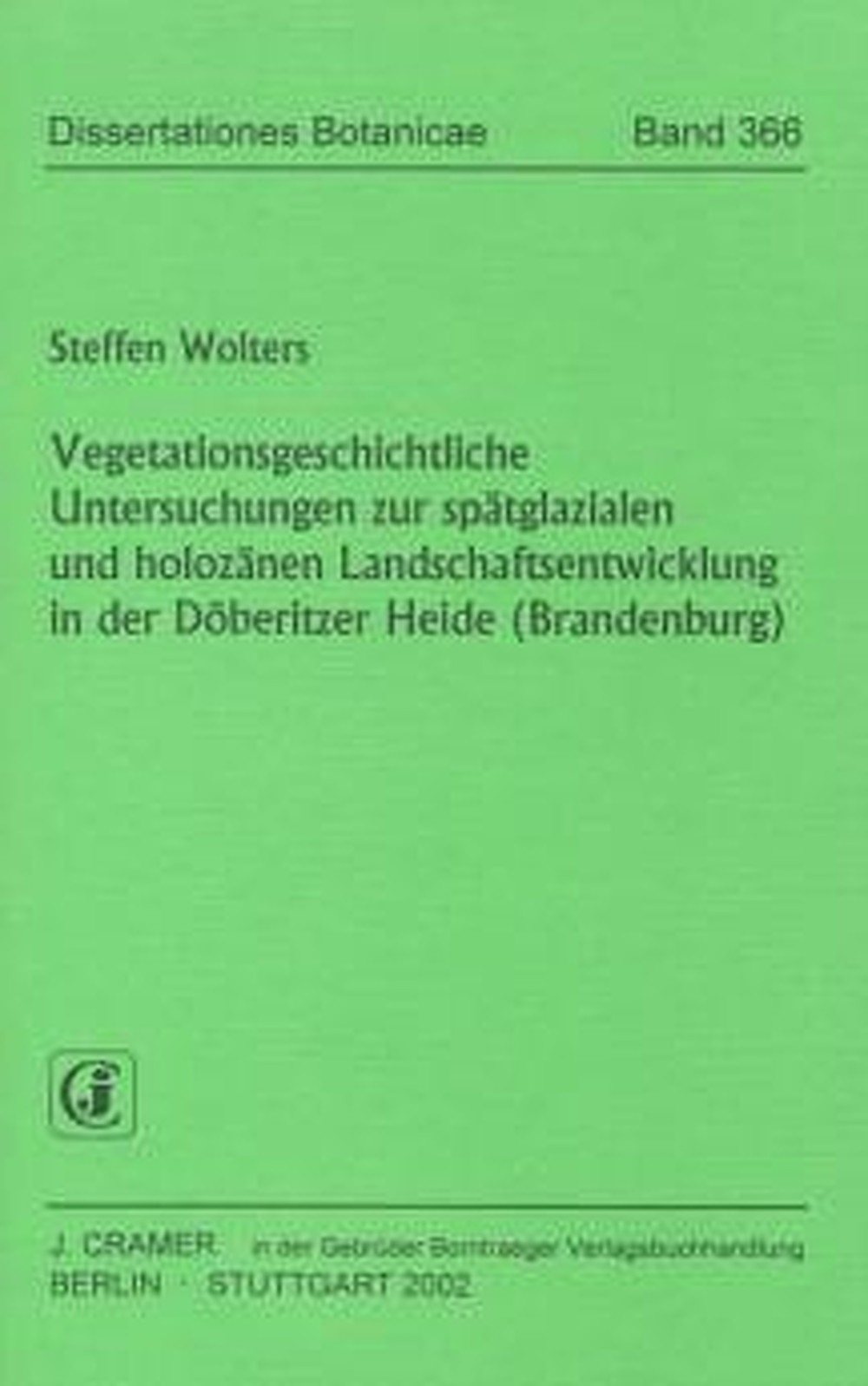Die Döberitzer Heide nordwestlich von Potsdam inmitten der
Brandenburger Jungmoränenlandschaft gelegen, wurde schon zu Zeiten
Friedrich des Großen als Truppenübungsplatz genutzt und zählt somit zu
den ältesten militärisch genutzten Flächen Deutschlands. In den 90iger
Jahren sind einige ehemalige Truppenübungsplätze im Gebiet der Neuen
Bundesländer durch die Aufgabe der militärischen Nutzung freigeworden
und wurden, wie der Truppenübungsplatz Döberitz, in Teilflächen zu
Naturschutzgebieten umgewidmet. Die unterschiedliche Inanspruchnahme
der Landflächen in den Übungsgebieten führte im Verlaufe der Nutzung
zu einem Landschafts- und Vegetationsmosaik, das Heimat für eine
Vielzahl bedrohter Tier- und Pflanzenarten bietet. Hierdurch nehmen
diese Flächen eine herausragende Stellung im Arten- und Biotopschutz
ein. Durch die vorliegende Arbeit werden die bisher erschienenen
Veröffentlichungen zur Geschichte, Vegetation und zum Naturschutz
dieses Naturraumes nun durch eine vegetationsgeschichtlich orientierte
Untersuchung bereichert.
Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden an 6 Kleinstmooren
durchgeführt, die alle pollenanalytisch und makrorestanalytisch
untersucht wurden. Die relative zeitliche Einstufung der
Pollendiagramme wurde durch 20 Radiocarbondatierungen abgesichert. Im
Vordergrund der vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen standen die
Klärung und chronostratigraphische Neugliederung der spätglazialen
Vegetationsentwicklung Brandenburgs im Vergleich mit regionalen und
überregionalen Referenzprofilen sowie die Herausarbeitung der
natürlichen Vegetation der anstehenden Grundmoränenplatten vor der
mittelalterlichen Besiedlung. Die dargelegten Ergebnisse liefern einen
wertvollen Beitrag der Paläoökologie zu naturschutzfachlichen
Fragestellungen, denn das vielfach postulierte natürliche Vorkommen
lindenreicher Wälder (Tilio-Carpinetum) im Untersuchungsgebiet konnte
palynologisch nicht bestätigt werden. Neben siedlungsgeschichtlichen
und moorstratigraphischen Aspekten wird in der vorliegenden Arbeit
auch dem Döberitzer Lindenwald ein Kapitel gewidmet. Das reiche
Vorkommen der Linde im Untersuchungsgebiet dokumentiert die potenziell
günstigen edaphischen und lokalklimatischen Wuchsbedingungen,
allerdings zeigt sich auch hier, dass der Döberitzer Lindenwald nicht
auf eine jahrtausende andauernde Geschichte zurückblicken kann,
sondern erst etwa 100 Jahre alt ist und auf aufgelassenen
Ackerstandorten stockt. Untermauert werden diese Ergebnisse durch
dendrologische Untersuchungen, die an ausgewählten Bäumen im
Lindenwald durchgeführt wurden.
Insgesamt ist die hervorragend geschriebene Arbeit ein weiterer
Mosaikstein in der vegetationsgeschichtlichen Erforschung Brandenburgs
und weiterhin ein Beleg dafür, dass paläoökologische Untersuchungen
über die Grenzen der Vegetations- und Siedlungsgeschichte hinaus,
interessante und wertvolle Aspekte zum Beispiel für die
Vegetationskunde und den Naturschutz liefern können.
H. FREUND
TELMA 33 (2003)