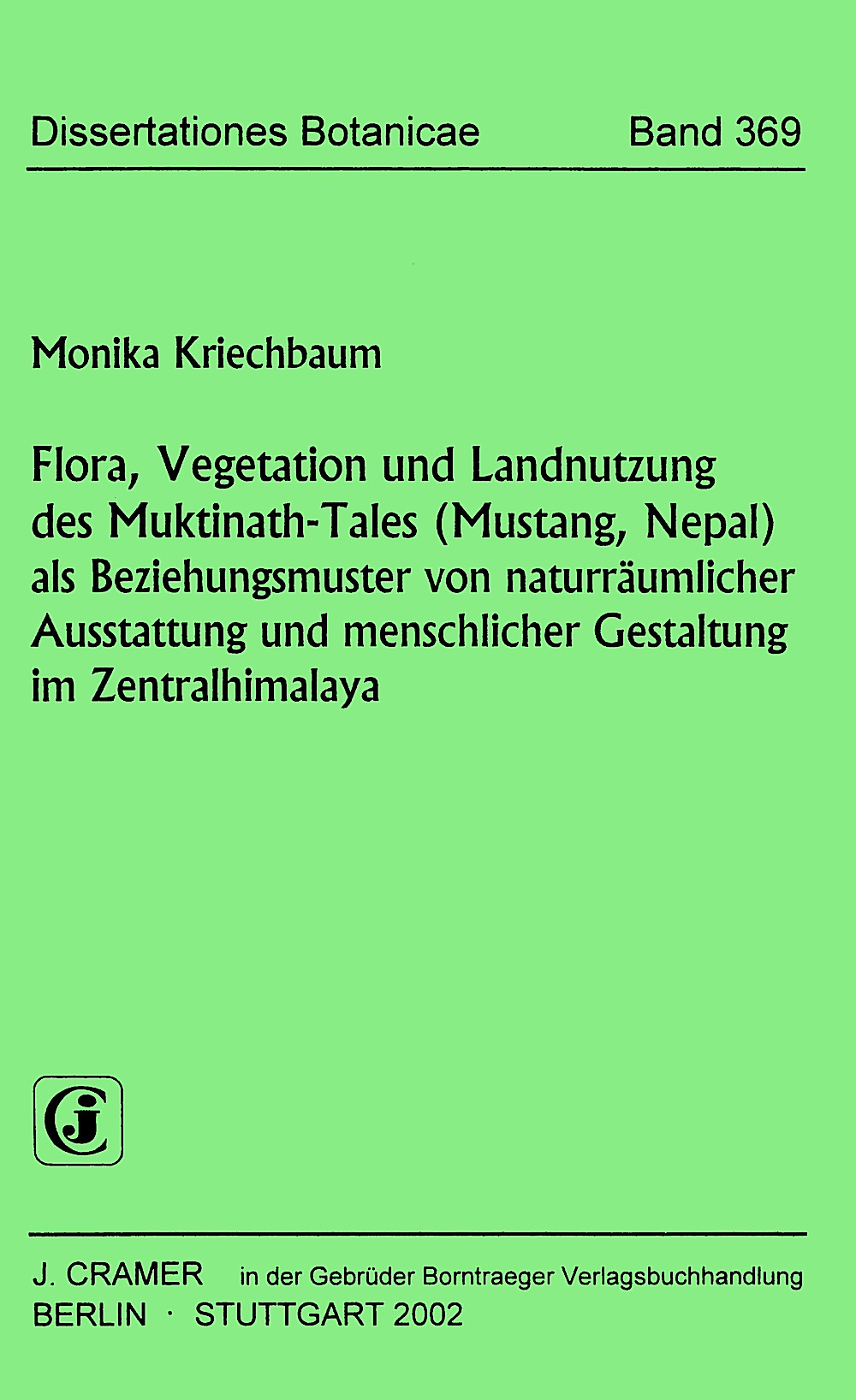Bespr.: Feddes Repertorium, Weinheim 115 (2004) 3-4 Haut de page ↑
Die vorliegende Dissertation schließt einen Teil dieser Lücke. Das Untersuchungsgebiet liegt in Zentral-Nepal hinter der Himalaya-Hauptkette im Norden der Annapurna. Das Muktinath-Tal ist in vielerlei Hinsicht Übergangs- und auch Durchgangsgebiet. Klimatisch gehört es mit wenig mehr als 300 mm Jahresniederschlag zum Südrand des tibetischen Trockengebietes und vermittelt zu den feuchteren Regionen im Himalaya-Hauptkamm. Die Vegetation ist von Grasländern und weitgehend trockenresistenten Gebüschen geprägt, in denen aber gelegentlich Vorposten der südlicher verbreiteten Waldvegetation zu finden sind. Muktinath beherbergt eines der wichtigen Heiligtümer des Himalaya, darüber hinaus wird das Tal seit Jahrhunderten intensiv landwirtschaftlich genutzt. Auch heute noch zieht sich durch das Becken eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen tibetischer Bevölkerung im Norden und Nepali im Süden; die neuzeitlichen Touristen erhöhen den Nutzungsdruck zusätzlich. Es handelt sich also um ein in mehrfacher Hinsicht kompliziertes Gebiet, das MONIKA KRIECHBAUM entsprechend unter verschiedenen Aspekten behandelt hat. Als Basis schien in einem ersten Schritt eine kritische Inventarisierung der Flora erforderlich zu sein. Darauf baut eine Erfassung der Vegetationseinheiten und der Gesamtheit der sie beeinflussenden ökologischen Faktoren auf, die dann schließlich zu einer Einschätzung der Intensität des anthropogenen Einflusses auf das Muktinath-Tal genutzt wird. Kernstück des Datensatzes sind ca. 2000 Herbarbelege und etwas mehr als 200 Vegetationsaufnahmen. Die Aufnahmen wurden nach der Methode von Braun-Blanquet angefertigt, die dazu notwendigen Geländearbeiten umfassten insgesamt 15 Wochen in den Jahren 19921994. Die vorliegende Arbeit wurde 1997 als Dissertation an der Universität Wien verteidigt. Der Text folgt einer klaren Gliederung. Eingangs wird die Aufgabenstellung formuliert, es schließt sich eine Übersicht der verwendeten Methoden an. Diese sind Standardverfahren, allerdings ist bei der Auswertung nicht auf die pflanzensoziologische Tabellenarbeit zurückgegriffen worden. Stattdessen werden die im Text als Gesellschaft bezeichneten Einheiten auf Basis der dominanten Arten beschrieben, eine Methode, die ja auch in den Trockengebieten Asiens weite Verwendung gefunden hat. Die Einführung schließt mit einer Übersicht zur Geschichte der Erforschung des Untersuchungsgebietes und zum aktuellen Kenntnisstand. Das zweite Kapitel beschreibt die naturräumliche Ausstattung. Die wichtigen abiotischen Umweltparameter werden unter Verwendung zentraler Quellen kurz beschrieben; der Hauptteil des Kapitelsaber ist der Siedlungsgeschichte und der aktuellen Landnutzung gewidmet. Es handelt sich auch hier weitestgehend um eine Zusammenstellung der vorhandenen Literatur, aber hier findet selbst der mit dem Himalaya vertraute Leser interessante neue Aspekte. Das vierte Kapitel behandelt dann die Flora des Untersuchungsgebietes, wobei der Schwerpunkt auf den phytogeographischen Beziehungen liegt. Alle Taxa werden den regional relevanten Arealtypen zugeordnet, diese werden dann quantitativ verglichen. Vier von B. DICKORÉ (Göttingen) angefertigte Arealkarten dienen der Illustration. Das Kapitel schließt mit einer groben Übersicht der floristischen Höhenstufen.
Das fünfte Kapitel stellt nun die im Gebiet vorkommenden Dominanzgesellschaften vor. Die Gesellschaften werden kurz beschrieben, dabei finden die wichtigsten Faktoren, insbesondere der anthropo-zoogene Einfluss, ausführlichere Behandlung. Schließlich werden die eigenen Einheiten soweit möglich den Arbeiten von anderen Vegetationskundlern zugeordnet, wobei aber keine formalen tabellarischen Vergleiche gezogen werden. Die Autorin betont bei vielen Gesellschaften immer wieder, dass es sich um stark vom Menschen beeinflusste Vegetationstypen handelt. Entsprechend ist das letzte und umfangreichste Kapitel dann dem menschlichen Einfluss gewidmet. Hier werden die eigenen Daten mit den bereits vorhanden Quellen verglichen und abschließend die zentrale Kernaussage formuliert, dass es sich bei dem heute weitgehend baumfreien Muktinath-Tal um eine ehemals zumindest locker bewaldete Region gehandelt haben muss, die ihr heutiges Gesicht der Jahrtausende währenden Landnutzung verdankt. Neben den eigenen vegetationskundlichen Befunden wird diese Behauptung aber vor allem durch die archäologischen und paläobotanischen Arbeiten anderer Autoren gestützt. Auch bei unter 400 mm Jahresniederschlag scheint also grundsätzlich Baumwuchs möglich zu sein, was weitreichende Implikationen für andere Regionen Hochasiens hat. Die vorliegende Arbeit macht sehr deutlich, welchen Schwierigkeiten vegetationskundliches Arbeiten in Regionen mit einer komplexen und nicht vollständig bearbeiteten Flora unterliegt. Schon das Erstellen wirklich vollständiger Vegetationsaufnahmen ist aufwändig, da zahlreiche Arten herbarisiert werden müssen. Für quantitative Erhebungen weiterer Umweltparameter bleibt oft keine Zeit mehr, so dass wie auch in vorliegendem Fall die Interpretation letztlich qualitativ-beschreibend bleiben muss. Dieses Problem kennen alle in entlegenen Regionen arbeitenden Vegetationskundler. Im Hinblick auf die Gliederung der Vegetationstabellen lässt sich allerdings anmerken, dass pflanzensoziologische Ansätze keinesfalls grundsätzlich in Trockengebieten zum Scheitern verurteilt sind. Das zeigen z. B. viele neuere Arbeiten aus Zentralasien. Auch im Himalaya wurde und wird durchaus pflanzensoziologisch gearbeitet, und schon aus
Gründen der Vergleichbarkeit wäre eine auf Charakterarten basierende Gliederung zumindest einen Versuch wert gewesen. Andererseits ist der Datensatz für einige Gesellschaften sicher auch zu klein, so dass sich eine unsortierte Tabelle wie die Vegetationstabelle 3 (alpine Rasen) auch mit anderen Methoden wohl nur schwer differenzieren ließe. Dennoch ist die vegetationskundliche Arbeit eine wichtige Bestätigung der bestehenden Hypothesen zur Waldfähigkeit des Muktinath-Tales.
Darüber hinaus hat die Dissertation aber große Bedeutung als Standardliste zur Flora des Gebietes. Die kommentierte Artenliste ist zwar formal nur ein Anhang, macht aber mit über 100 Seiten den eigentlichen Hauptteil der Arbeit aus. Es handelt sich um eine taxonomisch soweit möglich aktuelle Liste, die auch auf Synonyme eingeht und Probleme kommentiert. Allein die Erstellung dieser Liste durch die Autorin und ihren Kollegen B. DICKORÉ hat vermutlich Jahre gebraucht. Da es sich aber natürlich nicht um eine Revision im eigentlichen Sinne handelt, ist allerdings zu hoffen, dass die systematischen Fortschritte an anderer Stelle gesondert publiziert werden.
Diese Bedeutung der Florenliste ist anscheinend auch der Autorin bewusst gewesen, denn dieser Teil ist in englischer Sprache verfasst worden, während die eigentliche Arbeit leider Deutsch geschrieben wurde. Insgesamt wird man sagen können, dass die Dissertation von M. KRIECHBAUM in die Bibliothek all jener gehört, die spezielleres Interesse an der Vegetation des Himalaya haben.
K. WESCHE, Halle (Saale)
Feddes Repertorium, Weinheim 115 (2004) 3-4
Wiley VCH