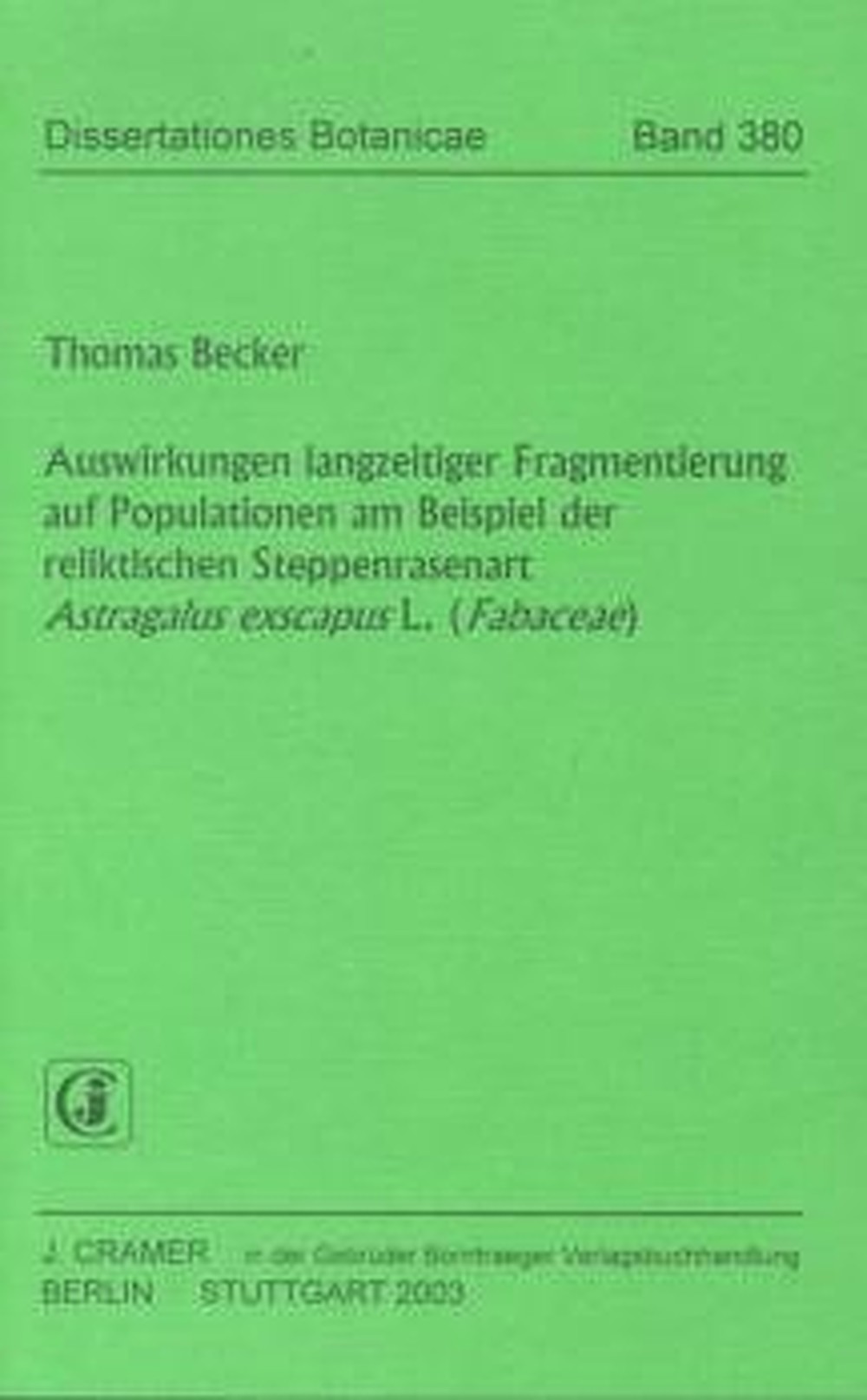Astragalus exscapus gehört zu den kontinental verbreiteten
Xerothermrasenarten, die ein stark disjunktes Gesamtareal besitzen,
wobei die Art innerhalb Deutschlands ausschließlich auf das
Mitteldeutsche Trockengebiet beschränkt ist. Astragalus exscapus weist
im genannten Raum nur noch 68 Populationen auf, wobei in den letzten
200 Jahren nachweislich erhebliche Verluste eintraten und zumindest in
den zurückliegenden 50 Jahren keine Neugründungen von Populationen
stattfanden. Auf Grund des reliktären Charakters der Vorkommen wurde
die Art in ihrer Existenz als entsprechend gefährdet eingestuft.
Das Anliegen des Verfassers war es, am Beispiel von Astragalus
exscapus die Auswirkungen langzeitlicher Fragmentierung für deren
Populationsstrukturen zu analysieren, d. h., die Prozesse zu
hinterfragen, die für das langfristige Überleben ihrer Populationen
entscheidend waren bzw. sind.
Dabei geht der Verfasser von der Verbreitung der Art in Deutschland
aus, analysiert Vegetation und Standortsbedingungen und befasst sich
mit der Blütenbiologie und populationsgenetischen Struktur
ausgewählter Populationen. Weitere Analysen beschäftigen sich mit den
Beziehungen der genetischen Variabilität der Populationen und deren
reproduktiver Fitness zu bestimmten Habitatparametern sowie der
Stellung des mitteldeutschen Teilareals zum Gesamtareal. Eingebunden
in diese Analysen sind Fragen zu Grundlagen für ein
naturschutzrelevantes Gesamtkonzept zum Erhalt von Astragalus
exscapus.
Im Kapitel zur Verbreitung und Geschichte von Astragalus exscapus in
Deutschland werden sowohl die Vorkommen der rezenten wie erloschenen
Populationen vorgestellt als auch Fragen zum Mindestalter diskutiert.
Aus der aktuellen Verbreitung an Flusstalhängen und Bruchstufen im
Gelände leitet der Verfasser die hohe zeit-räumliche Konstanz der
einzelnen Populationen ab, für die seit 1687 Belege existieren. Seiner
Meinung nach haben in diesen natürlichen Refugien die Populationen die
postglaziale Wiederbewaldung des Gebietes überdauert, wobei er
annimmt, dass die Art bereits in einer steppentundrenartigen
Vegetation während des Weichselhochglazials in ihrem heutigen
Verbreitungsgebiet existieren konnte, wofür allerdings konkrete
Nachweise fehlen.
Im Kapitel zu Vegetation und Standortbedingungen werden 170
Vegetationsaufnahmen mit Astragalus exscapus vorgestellt und ihre
soziologische Stellung diskutiert. Erwartungsgemäß wird die Mehrzahl
der Aufnahmen Vegetationseinheiten der kontinentalen Festucetalia, ein
kleinerer Teil jedoch Beständen der Brometalia zugeordnet. Inwieweit
letzteres berechtigt ist, ist anzuzweifeln. So lassen sich die meisten
der dem submediterranen Trinio-Caricetum zugeordneten Bestände (in
denen Trinia glauca selbst völlig fehlt) zwanglos denen des
Adonido-Brachypodion anschließen. Der Ansicht, dass der Schwerpunkt
von Astragalus exscapus in den sekundären Halbtrockenrasen liegt, kann
zumindest überregional gesehen nicht zugestimmt werden. Die
Interpretation des Zustandekommens des fragmentarischen
Verbreitungsbildes der Art bezüglich dessen historischer Entstehung
ist einleuchtend, doch lassen sich hieraus allein Fragen zur
Nichtbesiedlung geeignet erscheinender Sekundärstandorte nicht
beantworten.
Aufschlussreich sind die intensiven Untersuchungen zur
Bestäubungsbiologie. Sie erbringen den klaren Nachweis dafür, dass
entgegen früheren Angaben die Art sowohl selbstkompatibel wie zugleich
obligat insektenbestäubt ist. Der Fruchtansatz steht dabei in
deutlicher Beziehung zur Höhe des Pollenangebotes. Allerdings konnte
kein eindeutiger Nachweis dafür erbracht werden, dass dessen
Limitierung in Beziehung zur Größe der Population steht.
Die genetische Variabilität und geographische Struktur von 37
ausgewählten Populationen wurde mittels Allozymloci untersucht. Es
wurde geschlussfolgert, dass die Art im Atlantikum mit Fortschreiten
der Wiederbewaldung stark fragmentiert wurde. Astragalus exscapus
zeigt eine moderate genetische Variabilität. Die Parameter für
genetische Variabilität sind hochsignifikant mit der Populationsgröße
korreliert. Entsprechendes gilt für die Korrelation
Samenansatz/Populationsgröße. Es wird daher der Populationsgröße eine
Schlüsselrolle für genetische Variabilität und reproduktive Fitness
der Populationen zugemessen.
Von Interesse sind auch die Ergebnisse der im letzten Kapitel
dargestellten Untersuchungen aus 24 Populationen von 4 europäischen
Teilarealen der Art. Die einzelnen Teilareale erwiesen sich dabei in
ihrer allelischen Ausstattung als eigene evolutive Einheiten, wobei
die allelische Diversität von NW nach SO zunimmt. Die relativ hohen
Werte genetischer Variabilität von Astragalus exscapus im
mitteldeutschen Teilareal widersprechen der allgemeinen Annahme von
einer genetischen Verarmung der zum Arealrand hin vorkommenden
Populationen. Der Forderung des Autors aus naturschutzfachlicher
Sicht, bei Wiederansiedlungen der Art keine Neubegründungen von
Populationen mit Saatgut aus weiter entfernten Reliktzentren
vorzunehmen, ist voll zuzustimmen.
Die vorgelegte Arbeit bringt auf Grund ihres breitgefächerten
Untersuchungsansatzes zahlreiche neue Erkenntnisse zur Biologie und
Ökologie von Astragalus exscapus und den Ursachen ihres reliktischen
Verbreitungsbildes innerhalb der aktuellen Xerthermrasenvegetation.
Neue Ergebnisse enthalten vor allem die Untersuchungen zur
Blütenbiologie und den Grundlagen der genetischen Diversität.
Die Arbeit hätte in einigen Punkten ohne Verlust gekürzt werden
können, wenn die jedem Kapitel vorangeschickten einleitenden
Abschnitte stärker komprimiert worden wären. Bei der breiten
Darstellung der Bestäubungs- und Fruchtbiologie hätte man sich
ergänzende Untersuchungen zur Fertilität der Diasporen gewünscht. So
bleibt unklar, inwieweit die Ursachen für fehlende Neubegründungen von
Populationen besonders an neuen Standorten in einer geringen
Keimfähigkeit bzw. spezifischen Etablierungschancen zu suchen sein
könnten.
Insgesamt ist die Arbeit sowohl aus Sicht der im Titel angesprochenen
Fragestellung wie aus der im einzelnen behandelten Komplexe als sehr
gelungen anzusprechen. Auch für aus den Ergebnissen abzuleitende
Vorhaben von naturschutzrelevanter Bedeutung wünscht man der Arbeit
ebenfalls entsprechende Beachtung. Ernst-Gerhard MAHN, Halle (Saale)
Ernst-Gerhard Mahn, Halle (Saale)
Hercynia, Band 38, 2005, S. 88/112