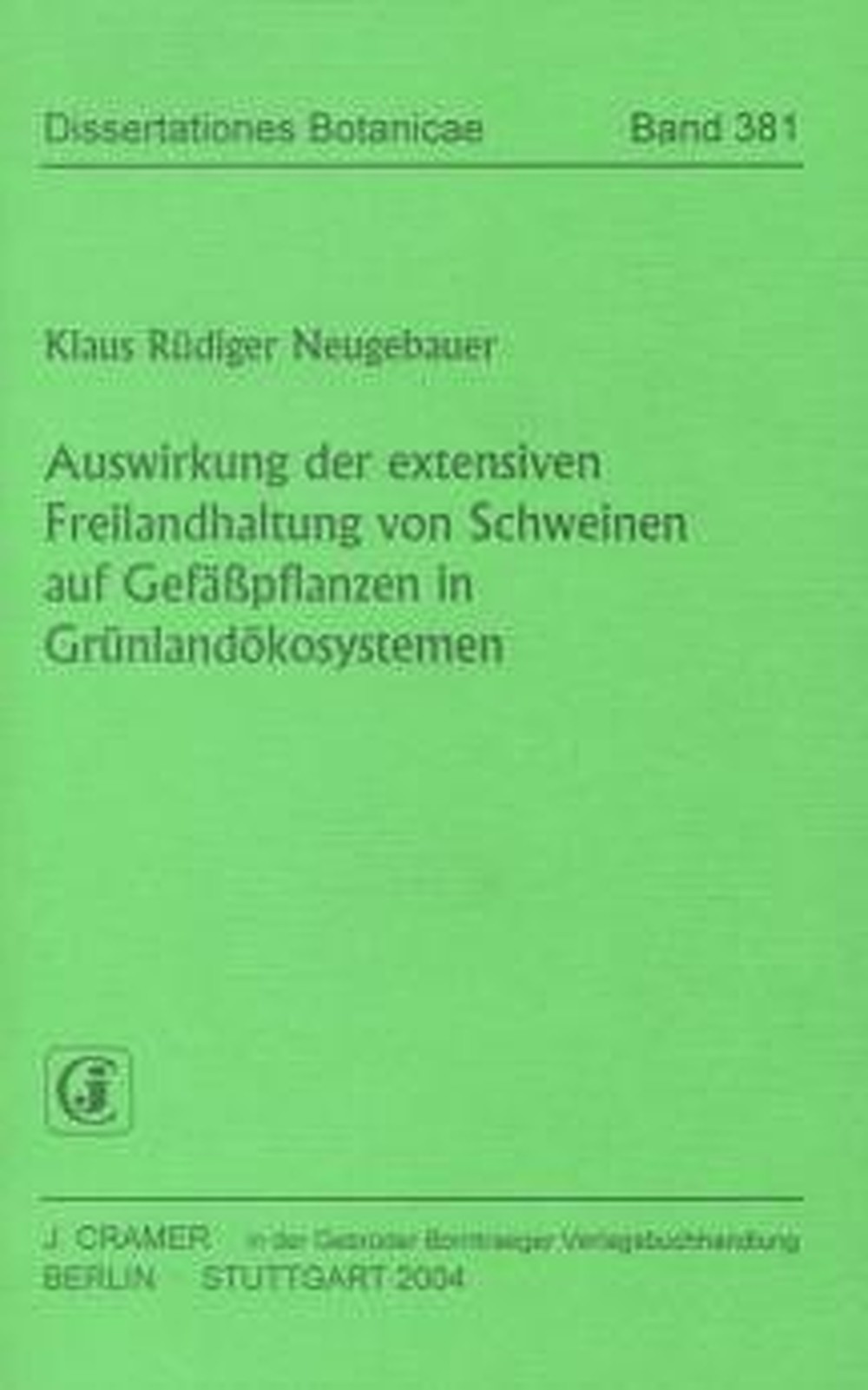Das Schwein in der Landschaftspflege? Knappe Kassen, freiwerdende
Flächenressourcen und zunehmende Berücksichtigung der
Vegetationsdynamik im Naturschutz fördern seit geraumer Zeit die
Rückbesinnung auf historische Weidepraktiken und Überlegungen, wie
diese mit den Ansprüchen an moderne und nachhaltige Landschaftspflege
in Einklang zu bringen sind. Der dazu notwendigen angewandt
vegetationsökologischen Forschung widmet sich der Autor im Rahmen des
BMBF-Projektes "Schweinefreilandhaltung im Rahmen der
Landschaftspflege". - Welche Vegetationsveränderungen verursachen im
Freien weidende Hausschweine in zuvor brach liegenden oder
konventionell beweideten Grünlandflächen? Lassen sich diese
Vegetationsänderungen mittels funktioneller Pflanzenmerkmale
verallgemeinern? In welchem Ausmaß und auf welche Weise vermögen
Schweine zur Ausbreitung von Pflanzenarten beizutragen? Woher kommen
Arten, die zuvor auf den Probeflächen nicht festgestellt worden waren?
Neugebauer folgt diesen miteinander verknüpften Fragesträngen in
voneinander unabhängigen Kapiteln, jeweils mit eigenen Methoden-,
Ergebnis- und Diskussionsteilen. Von den fünf Untersuchungsgebieten
liegen drei im Weserbergland und je eines in der brandenburgischen
Elbaue und auf der Schwäbischen Alb. Natürlich sind sie hinsichtlich
ihrer Vegetationsausstattung ganz verschieden. Die Wühltätigkeit der
Schweine führt aber im Untersuchungszeitraum 1999 - 2002 überall zu
erheblichen Anteilen offenen Bodens und damit zu mehr räumlicher wie
zeitlicher Dynamik. Es gibt mehr neu etablierte als lokal
ausgestorbene Arten, höhere Artenzahlen und Turnover-Raten als in den
jeweiligen brach liegenden oder konventionell beweideten
Referenzflächen. Im Gegensatz zu Schaf- oder Rinderweiden geht der
Trend zu mehr Kräutern, weniger Gräsern. Als Nutznießer der
Schweinebeweidung erweisen sich vorwiegend Potentillo-Polygonetalia-
und Stellarietea-Arten, während eine Förderung von Arten der Klasse
Isoeto-Nanojuncetea nur in sehr geringem Umfang nachgewiesen werden
konnte. Dabei sind es sind vor allem Vertreter dieser Klasse, die mit
der historischen Nutzungsform der Schweineweiden in Verbindung
gebracht werden. Offenbar sind sie aus den Artenpools einschließlich
der Diasporenbank der - wohl auch standortsökologisch wenig geeigneten
- Untersuchungsgebiete so weitgehend verschwunden, dass ihnen die
wühlenden Schweine nicht Keimbettbereiter sein konnten. Dabei können
alle Diasporen grundsätzlich von Schweinen ausgebreitet werden, sei es
epizoochor durch Schlammspritzer (die Diasporenbank von Suhlstellen
erwies sich als Abbild dieses Potenzials) oder endozoochor, wobei sich
Schweine bei der Nahrungsaufnahme beträchtliche Teile der örtlichen
Diasporenbank direkt einverleiben. Eine Folge der
Schweinefreilandhaltung ist daher eine Zunahme von Arten mit
langlebigen Samen. Neben Aussagen wie dieser lassen die Ergebnisse
durchaus weitere Prognosen zur Vegetationsentwicklung zu, zumal
Untersuchungsergebnisse aus den rezenten Modell-Schweineweiden der
kroatischen Save-Aue zur Verfügung standen. Offen bleibt für die
Praxis der Landschaftspflege die Beantwortung der Frage nach dem
günstigen Mittelweg der Störungsintensität, mithin nach der
Besatzdichte. Doch dies lag außerhalb des experimentellen Ansatzes der
anregenden Studie Neugebauers, die neben vielen Fakten und
Originaldaten auch ein 14-seitiges Literaturverzeichnis zu bieten hat,
unverzichtbar für alle, die die methodische Breite und Tiefe der
Arbeit (60 €) nachvollziehen wollen.
E. Bergmeier
Tuexenia 26, Göttingen 2006, S. 403-404