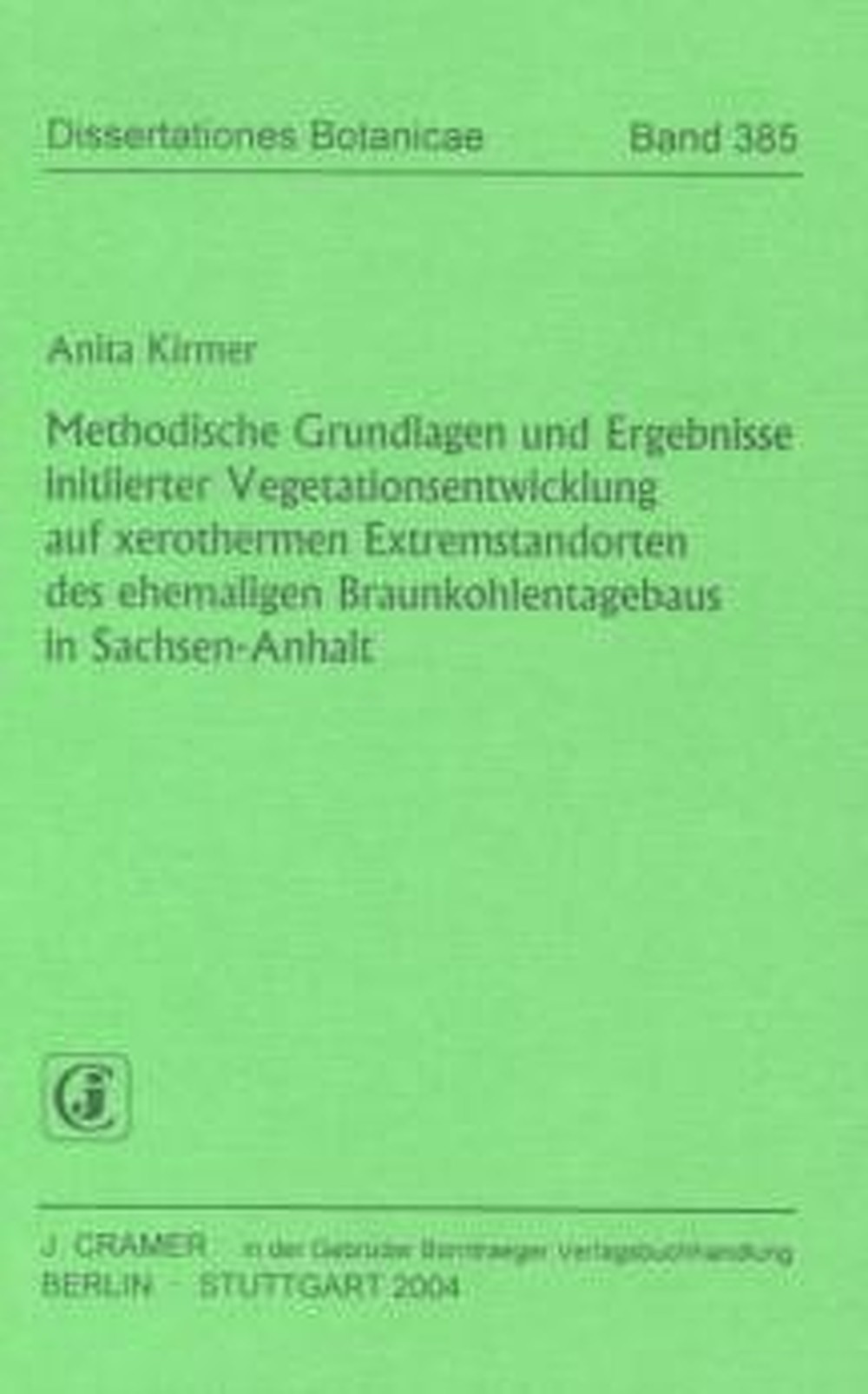In der Dissertationsschrift werden spontane und initiierte (gelenkte)
Sukzessionen auf tertiären und quartären Substraten in der
Bergbaulandschaft Goitsche zwischen Bitterfeld und Delitzsch
beschrieben. Dabei werden in Dauerbeobachtungsflächen und
Versuchsflächen sowohl primäre als auch initiierte
Vegetationsentwicklungen durch Mähgutverlagerung und Sodenschüttung
bzw. Sodensetzung untersucht.
Als Pionierart auf offenen Sanden tritt Corynephorus conescens auf,
der für die Keimung eine leichte Ubersandung (z. B. durch
Uberwehung) verträgt. Die extrem niedrigen pH-Werte (unter pH
3,o) beeinflussen die Keimung von Corynephorus conescens negativ,
wenngleich diese Art dennoch der Erstbesiedler bleibt. Hieracium
pilosella und Centaurea stoebe weisen diese Keimungshemmung
nicht auf, wandern aber dennoch erst später in Sielbergrasen ein
(Bodenentwicklung).
Der Diasporenfall auf unbesiedelten Flächen der Bergbaufolgelandschaft
ist dem anderer Pionierstandorte vergleichbar. Dieser Diasporenfall
und die Anreicherung von Diasporen ist wesentlich für die
Primärsukzession, da in den Substraten keine Diasporenbank vorhanden
ist. Die Autorin belegt den Aufbau und die Differenzierung der
Sporenbank.
Hinsichtlich der initiierten Vegetationsentwicklung erwies sich die
Mähgutverlagerung als besonders erfolgreich. Es entwickelten sich hier
artenreiche Sandtrockenrasen, die in ihrer Sukzession die
Silbergrasphase übersprangen. Dies begründet sich wohl in der
Humusakkumulation, die zur Verringerung der Luftkapazität im Boden
führt, was von Corynephorus conescens nicht vertragen wird
Gehölzaufkommen konnten sich trotz zeitweiliger Entwicklung von
GehölzLeimlingen nicht etablieren. Die Sodenschüttung bzw. -setzung
führte zur Ausbildung kryptogamenarmer Silberpioniergrasfluren. Diese
Fluren ermöglichen die Ansiedlung spätsukzessionaler Arten, bringen
sich selbst dabei jedoch in eine unvorteilhafte Lage. Die Ablösung der
Silbergrasfluren durch die Sandtrockenrasen setzt ein.
Die Dissertationsschrift enthält wichtige Hinweise für die
Naturschutzpraxis. Die Initiierung von Sandtrockenrasen kann
erfolgreich über Mähgutauftrag erfolgen, das z.B. bei Pflegeschnitten
in Naturschutzgebieten gewonnen werden kann. Dabei soll berücksichtigt
werden, dass das Arteninventar des Mähgutes standörtlich auf die zu
begrünende Fläche abgestimmt ist. Bei Sandtrockenrasen liegt der
günstigste Schnitttermin (Saatgutreife) zwischen Ende Juli und Mitte
August. Ggf. kann auch Mähgut zu verschiednen Terminen gewonnen
werden. Spätere Termine erhöhen den Anteil an Diasporen von
Calumgrostis epigejos. Grundsätzlich sollen die Zielarten gut im
Mähgut vertreten sein. Der Auftrag von frischem Mähgut verhindert das
Verwehen.
Die Sodenschüttung setzt die Sodenentnahme auf Spenderflächen voraus,
was zu deren Zerstörung führt. Deshalb sollten nur solche Flächen als
Spenderflächen verwendet werden, die sowieso einer Zerstörung z. B.
durch vorgesehenen Abbau unterworfen werden oder auf denen aus
naturschutzfachlichen Gründen ein Vegetationsabtrag erfolgen soll.
Die standörtlichen Verhältnisse der Spenderfläche müssen denen der zu
begrünenden Fläche entsprechen. Die Sodenversetzung ist
die aufwendigste Methode. Auf Substraten mit extrem niedrigen
pH-Werten, können durch diese Methode bessere Ergebnisse erzielt
werden als durch Sodenschüttung oder Mähgutauftrag. Die Versetzung
soll bei feuchter Witterung möglichst im Frühjahr oder im Herbst
erfolgen.
Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass Bergbaulandschaften aufgrund
ihrer standörtlichen Einzigartigkeit (Nährstoffarmut, Nischenreichtum)
und Großflächigkeit sowie der erfolgten Störung ein einmaliges
Potenzial zur Entwicklung naturschutzfachlich wertvoller
Vegetationsmosaike durch Sukzession bei konsequentem Prozessschutz
bieten. Hier sollte die Vegetationsentwicklung durch Initiierung nur
dort beschleunigt werden, wo dies durch die Folgenutzung erforderlich
erscheint (Ortsnähe, Erholungsnutzung, bergtechnische Notwendigkeit).
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen beschränken sich in
ihrer naturschutzfachlichen Anwendung keinesfalls auf
Bergbaulandschaften. Sie geben auch wertvolle Hinweise für die
Beetablierung und Entwicklung von Mager- und Trockenrasen in
geschützten Flächen, wo diese z.B. durch Aufforstunken, Verbuschungen,
Eutrophierungen u.a. zerstört wurden. Jüngstes Beispiel dafür ist die
laufende Entwicklung eines Sandtrockenrasen im Naturschutzgebiet
Saalberghau. Hier erfolgt auf der Fläche eines beseitigten
Kiefernforstes Mähgutübertragung von artenreichen Magerrasen (Heusaat)
bei Steuerung der Sukzession durch jährliche Mahd.
L. REICHHOFF
Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Heft 1/2005, S. 62-63