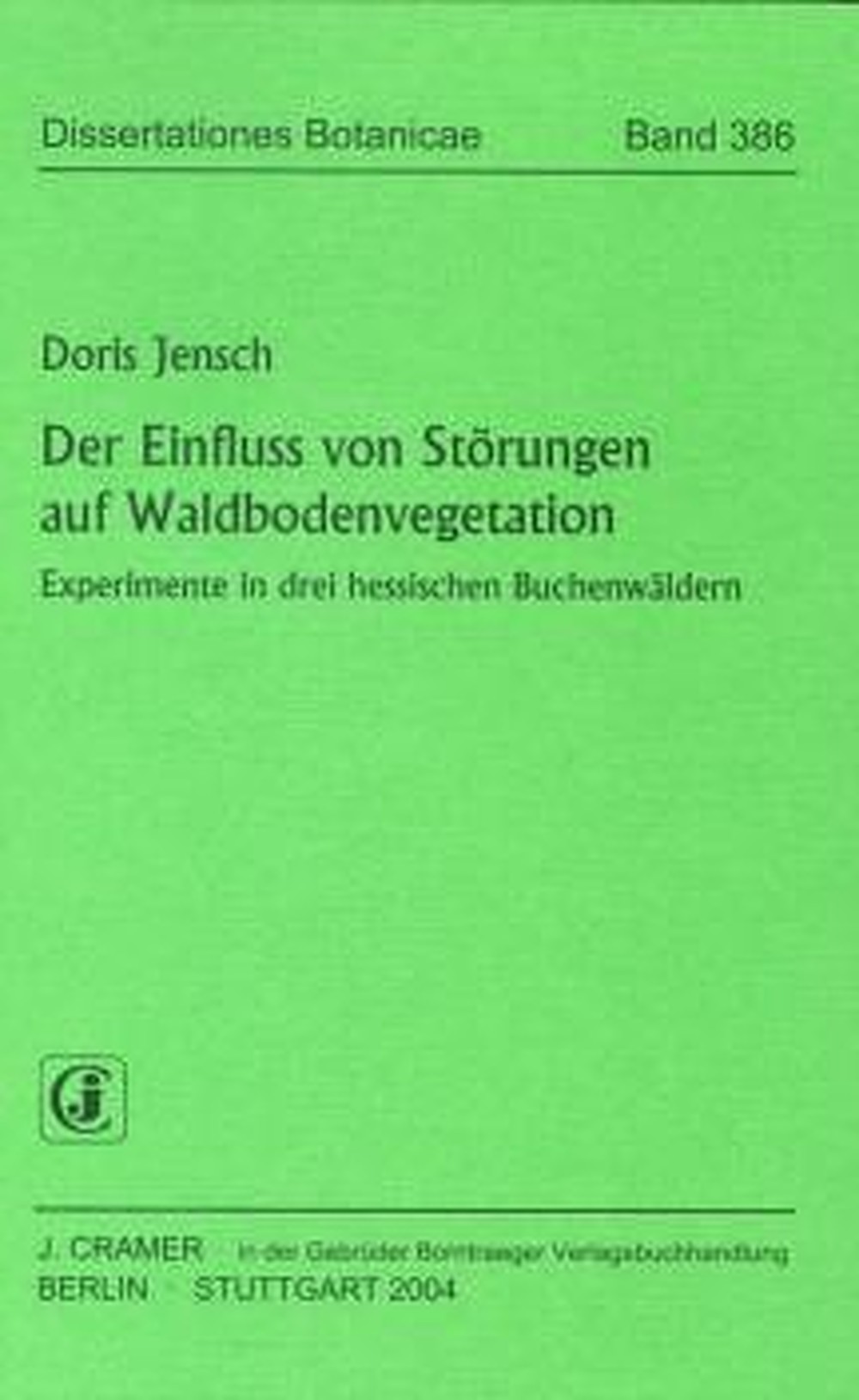Dieses opulente Werk zu einem vermeintlich nebensächlichen Thema steigt gleich groß ein: Ein Parforce-Ritt durch die in großen Teilen angelsächsisch orientierte Literatur zum Thema disturbance" macht den Anspruch der Autorin deutlich: Sie stellt ihre Arbeit in die Tradition einer durch Versuche verankerten, statistisch abgesicherten und verallgemeinernd kausal argumentierenden Naturwissenschaft. Verbindungen zu einem primär beschreibenden, naturgeschichtlich orientierten Ansatz, wie er sich in der Pflanzensoziologie Mitteleuropas manifestiert, werden lediglich bei der Beschreibung der
Untersuchungsflächen geknüpft: Diese liegen auf seit langem mit Wald bestockten Flächen bei Bad Wildungen auf Muschelkalk, bei Sontra auf Tonschiefer sowie im Vogelsberg auf Basalt. Während auf der ersten Fläche eine Cephalanthero-Fagion-Gesellschaft ausgeprägt ist, finden sich auf den beiden anderen Flächen Galio-odorati-Fagion-Gesellschaften, am Vogelsberg in einer farnreichen Ausprägung. Mit Hilfe entsprechender Flächenanteile aus kleinmaßstäbigen Kartierungen der Vegetation will die Autorin auf die
Flächenrepräsentanz für 16 % der potentiellen Waldfläche Deutschlands hinweisen. Ob eine pflanzensoziologische Zuordnung wirklich für ein up-scaling von kleinräumigen Störungsereignissen in große Räume taugt, soll dahin gestellt bleiben.
Fußend auf der Definition von Störung von Pickett und White begrenzt Jensch die
Dimension ihrer Versuche auf kleinere Störungsmuster wie sie durch Wildschweine und bei forstlichen Arbeiten verursacht werden. Vor allem die Wildscheinpopulationen sind in den letzten Jahrzehnten angewachsen, so dass die Relevanz entsprechender Störereignisse ebenfalls zugenommen haben sollte. Störungen, die mit einer Auflichtung der Kronenschicht einhergehen wie schlagweise Holzernte, Windwürfe, größere Waldbrände, sind nicht Gegenstand ihrer Untersuchung.
Um diese Störungsmuster zu untersuchen, simuliert die Autorin den zerstörerischen Aspekt entsprechender Störungen auf wildschweinsicher gegatterten Flächen indem sie auf 48 jeweils 1 × 2 m großen Parzellen 7 Störungs- und eine Kontrollvariante in jeweils 6 geblockten Wiederholungen durchführte. Innerhalb der durch ihre Vegetationsausprägung unterscheidbaren Blöcke waren die Kleinflächen zufällig verteilt. Die Störungsvarianten umfassten: jeweils eine Störung im April über drei Jahre (19971999), jeweils
eine Störung im Oktober über drei Jahre (19961998), jeweils eine Störung im April und im Oktober über drei Jahre, je eine Störung im April, Juni, August und Oktober, je acht Störungen pro Jahr, jährlicher Schnitt der Waldbodenvegetation drei cm über dem Boden im Mai (Schnittgut nicht auf der Fläche belassen) und schließlich einmaliges Durchsieben des gesamten Oberbodens und Entfernen der gesamten Vegetation (außer der Diasporen) zu Beginn der Untersuchungen.
Auf den Kleinflächen werden mit wenigen Ausnahmen alle neu aufgelaufenen
Keimlinge über drei Vegetationsperioden monatlich ebenso erfasst wie ihr Überleben. Die bereits vorhandene Vegetation wurde schon vor Beginn der experimentellen Störungen mittels einer Prozentskala erfasst und dann in monatlichen Abständen erneut erhoben. Von hemisphärischen Kronendachfotos jeder dieser Kleinflächen wurde mit einem Bildanalyseprogramm der Anteil direkten und indirekten Lichts am Waldboden errechnet. Ob dieses Verfahren bei dichtem Kronenschluss und hohen Anteilen diffusen Lichts verlässliche Werte liefert, erscheint fraglich. Weiterhin wurden der Eindringwiderstand
des Bodens für zwei Tiefen sowie der Wassergehalt des Ah-Horizonts und der Anteil streufreier Fläche ermittelt. Die Diasporenbanken wurden zu Beginn der Versuche durch je zwei Stechzylinderproben an 25 von den Parzellen unabhängigen Rasterpunkten pro Untersuchungsbestand, soweit es die im Anschluss durchgeführte Auflaufmethode ermöglicht, erfasst.
Die erfassten Daten wurden unter verschiedenen Aspekten deskriptiv und analytisch ausgewertet, wobei auch eine Vielzahl abgeleiteter Kennwerte wie Anteile von Arten historisch alter Wälder", das Verhältnis von Waldarten" zu Offenlandarten", Strategieanteile nach Grime, Zeigerwerte für Licht, Temperatur, Kontinentalität, Feuchte, Reaktion und Stickstoff nach Ellenberg sowie Diversitätsindices nach Shannon-Wiener oder die Evenness Verwendung fand. Die räumlichen Verteilungsmuster der Diasporenbanken häufiger Arten wurden durch die Verhältnisse der Varianzen zu den Mittelwerten zum Ausdruck gebracht. Zeitlich aufeinander folgende Zustände wurden durch Fluktuationsraten sowie mit Hilfe des Euklidischen Abstands charakterisiert; zudem wurden Korrespondenzanalysen durchgeführt. Für paarweise Vergleiche wurden Ein- und Zweiweg-Varianzanalysen verwendet, ansonsten kamen Korrelationsanalysen zum Einsatz, um Zusammenhänge zwischen Mess- oder Zähldaten zu untersuchen.
Dieser umfangreiche Methodenapparat lässt bereits erahnen, dass den Leser ein um
fangreicher Ergebnisteil erwartet, der mit einer Vielzahl an Textbeiträgen, Grafiken und Tabellen einen beachtlichen Teil der möglichen Verknüpfungen aufbereitet. In Anlehnung an den allgemeinen Entwicklungszyklus von Samenpflanzen beginnt Jensch mit der Deskription der Ergebnisse aus den Untersuchungen der Diasporenbanken und schreitet dann zu Keimung einschließlich ihrer Phänologie fort. Wie zu erwarten, werden beim Keimungsgeschehen bereits Unterschiede zwischen den Varianten, aber auch zwischen den Jahren unter anderem in Abhängigkeit vom Diasporeneintrag sowie zwischen den drei Untersuchungsflächen deutlich, was einfache Schlüsse hinsichtlich eines für die
Keimung optimalen Störungsregimes erschwert. Auch der Vergleich der Diasporenban
ken mit den Keimlingsaufkommen erweist sich als ein mehrdimensionales Unterfangen, allerdings wird deutlich, dass Offenlandarten" gegenüber den echten Waldarten" deutlich stärker in der Diasporenbank vertreten sind, als unter den Keimlingen.
Der Etablierung der Keimlinge wird ein weiteres umfangreiches Kapitel gewidmet,
was der populationsdynamischen Bedeutung dieses Prozesses in der Vegetationsent-
wicklung einer Fläche sicher gerecht wird. Auch hier überlagern sich art- und standortspezifische Einflüsse mit störungsbedingten Reaktionsmustern, was generalisierende Aussagen einschränkt, zumal der Untersuchungszeitraum von drei Jahren für eine prozessorientierte Modellierung zu kurz ist. So bleiben auch Zuordnungen zu Artengruppen auf Grund des Etablierungsverhaltens relativ vage.
Der Vegetation auf den Untersuchungsparzellen widmen sich jetzt zwei Kapitel.
Nach der kurz abgehandelten Dominanzstruktur werden Veränderungen der Waldboden-
vegetation im Versuchsverlauf ausführlich dargestellt. Neben Keimung und Etablierung von Pflanzen spielt hier natürlich auch das vegetative Expansions- und Regenerationsvermögen der beteiligten Arten eine große Rolle, insbesondere bei der Wiederbesiedlung der Variante Sieb", die sich hinsichtlich ihrer Entwicklung bei vielen Arten deutlich von der anderer Störungsvarianten absetzt. Auch die 8-mal pro Jahr gestörten Parzellen zeigten hinsichtlich der Gesamtdeckung einen Rückgang. Allerdings scheint auch die
Gatterung der Untersuchungsflächen durch ausbleibenden Wildverbiss einen Einfluss auf die Vegetationsentwicklung zu haben: So nehmen Gehölze in der Kontrollen und den wenig gestörten Varianten an Deckung deutlich zu. Vergleiche zwischen etablierter Vegetation und Keimlingszahlen ergaben, dass mit Ausnahme einiger Rhizompflanzen alle etablierten Arten auch auf die generative Fortpflanzung setzen, wenn auch unterschiedlich stark. So keimen störungsgeförderte Arten im Verhältnis zu ihrer vegetativen Prä-
senz häufiger als zum Beispiel eine dominante aber stark auf vegetative Vermehrung setzende Art wie Anemone nemorosa.
Die indirekte Messung der Einstrahlungsintensität ergab, dass sich im Wesentlichen nicht die Störungsvarianten, sondern die nach Dominanzmustern der Vegetation ausgeschiedenen Blöcke signifikant unterschieden. Zwischen den Keimlingssummen und der Einstrahlungsintensität wurden dementsprechend keine nennenswerten statistischen Zusammenhänge gefunden. Hinsichtlich des Eindringwiderstandes des Bodens unterschieden sich nicht nur die drei Untersuchungsflächen, sondern auch die Störungsvarianten. Auch der Anteil streufreier Fläche korreliert eng mit dem Eindringwiderstand. Interes-
santerweise keimen auf einer Fläche (Sontra) auf dem härtesten" Boden signifikant die meisten Keimlinge. Ansonsten variieren die Keimlingszahlen, aber auch die Etablierungsraten relativ unabhängig vom Eindringwiderstand, so dass diesem Faktor nicht allzu viel Relevanz beigemessen wird.
Die folgenden fünf Kapitel des Ergebnisteils greifen einzelne Aspekte der Vegetationsentwicklung oder aus der Vegetationszusammensetzung abgeleitete oder errechnete Größen auf und stellen sie in einen Zusammenhang mit der Vegetationsdynamik. Für den Arten-Turnover ist das überraschende Ergebnis, dass sich die unbeeinflussten Kontrollparzellen besonders bei den Einwanderungsraten kaum von den Störungsvarianten mit Ausnahme der gesiebten Parzellen unterscheiden. Bei einer qualitativen Betrachtung des Arten-Turnover durch entsprechende DCAs finden sich die stark gestörten Sieb"-Varianten stets an einem Extrem der ersten Achse wieder, was erwartungsgemäß auf einen deutlichen qualitativen Unterschied des Arten-Turnover auf diesen Parzellen hin-
weist. Generell sind echte Waldarten" unterproportional zu ihrer Deckung am Artenwechsel beteiligt. Ähnlichkeitsberechungen und Ordinationen der Artenbestände ergeben eher flächenspezifische Entwicklungen, was bei den unterschiedlichen Ausgangssituationen auch nahe liegt. Die Ergebnisse aus den Berechnungen zu den Anteilen einzelner Strategietypen am Artenbestand zeitigt nur auf zwei der drei Untersuchungsflächen (Sontra und Bad Wildungen) mit dem Anstieg von Störungszeigern auf der Sieb"-Variante ein deutliches Ergebnis, ansonsten bleiben die Ergebnisse eher vage. Ähnliches gilt für die Ellenbergschen Zeigerwerte, wobei sich bei der Wiedergabe von zwei Stellen
nach dem Komma bei den gewichteten Mittelwerten die Frage stellt, ob die Autorin die Aussageschärfe dieses Indikatorsystems nicht überschätzt. Vor allem die von den phyto-geographischen Arealen der Einzelarten abgeleiteten Temperatur- und Kontinentalitätszahlen sind sicher für die Indikation im Zusammenhang mit den applizierten Störungen auftretender mikroklimatischer Effekte ungeeignet. Wenn sich in weiteren Studien die Befunde der Autorin bestätigen ließen, dass nach einer Störung von der Keimung über die Etablierung zu den verschiedenen Stadien der Jungpflanzenentwicklung in der Regel eine stete Abnahme sowohl der Artendiversität nach Shannon-Wiener als auch der Evenness zu beobachten ist, könnten aus diesen Befunden weiterreichende Aussagen zur Sukzession nach Störungen abgeleitet werden.
Die Diskussion ist breit angelegt. Sie schließt zudem in Einschüben Methodendis-
kussionen mit ein, in denen das jeweilige Thema allerdings nicht umfassend dargestellt werden kann. Anders die Diskussionen zu den Ergebnissen. So wird zur Bewertung der Ergebnisse der Diasporenbank-Untersuchungen eine Vielzahl relevanter Arbeiten herangezogen und die Befunde kritisch gewürdigt. Letztlich werden unmittelbare Vergleiche durch Unterschiede in der Erfassungsmethodik sehr erschwert. Zudem weist Jensch auf die kleinräumige Differenzierung der Waldbodenvegetation und damit zusammenhängend auch der jeweiligen Diasporenbanken als eine Quelle von Variation und damit von
Unsicherheit hin. Der Vergleich mit Keimlingsdichten aus anderen Studien offenbart bei einzelnen Arten deutliche Unterschiede. Neben witterungsbedingten Differenzen in einzelnen Jahren oder an verschiedenen Orten sind sicher unterschiedliche biozönotische Einbindungen für unterschiedliche Keimlingsaufkommen ein und derselben Art in verschiedenen Waldtypen oder Waldgesellschaften verantwortlich. Wie die Autorin betont,
gibt es zu Etablierung kaum Vergleichsangaben in der Literatur, obwohl dies ein sehr risikoreicher Abschnitt der generativen Reproduktion ist.
Auch artbezogene Vergleiche zwischen den einzelnen Varianten und Ergebnisse an-
derer Studien zur Dynamik oder zum Arten-Turnover und zur Diversität sind auf Grund unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Skalen nur eingeschränkt möglich. Wichtig ist, dass in den dargestellten Untersuchungen auch die Kontrollvarianten eine beträchtliche Dynamik in der Zu- und Abwanderung von Arten aufweisen. Die unterschiedlich starke Bindung von Arten an Wälder wird von der Autorin wiederholt thematisiert. Die von ihr diskutierten Beispiele zeigen in den Diasporenbanken durchweg einen deutlich höheren Anteil von Arten, die auch im Offenland oder auf Lichtungen vorkommen, als dies bei den Keimlingen der Fall ist. Wie die Autorin schlussfolgert, ist hier ein Potential
für eine adäquate Antwort auf größere Störungen gespeichert.
Eine vergleichende autökologische Betrachtung häufiger Arten hat im Wesentlichen
das Ziel, Artengruppen auszuscheiden, die im Hinblick auf Störungen ähnliche Reaktionsmuster aufweisen. Dies gelingt nicht ohne Widersprüche und Fragezeichen, was andererseits die artspezifische Nischendifferenzierung der behandelten Taxa unterstreicht. Beispielsweise weist die Autorin eine Gruppe aus, die bienne oder perenne Arten mit kleinen Samen hoher Persistenz und von Störung abhängiger Keimung" umfasst: Moehringia trinervia, Digitalis purpurea, Taraxacum species, Poa nemoralis, Fragaria vesca und Rubus idaeus. Die Heterogenität einer solchen Gruppe stellt den Erfolg ähnlicher
Ansätze auch für zukünftige Arbeiten in Frage.
Das letzte eigenständige Diskussionskapitel widmet sich der Bewertung der unter-
schiedlichen Störungsregime. Während die verschiedenen Störungsvarianten sich auf die Keimung relativ wenig auswirken, nimmt mit Störungshäufigkeit der Einfluss auf die etablierte Vegetation zu. Der Einfluss der Umgebungsvegetation auf eine Störstelle hängt auch von deren Größe ab. Jensch gibt als Richtwert für die Mindestgröße einer von der Umgebung in Teilen unabhängigen Vegetationsentwicklung auf Störstellen eine Distanz über das drei- bis vierfache jährliche Rhizomwachstum dominanter Matrixarten an, plädiert aber auch dafür, verschiedene Störparameter hinsichtlich ihrer Wirkung getrennt zu untersuchen. Untersuchungen inwieweit stochastische oder deterministische
Effekte des Störereignisses selbst und bei der anschließenden Vegetationsentwicklung die konkrete Artenzusammensetzung steuern, werden sicher durch die von der Autorin vorgelegten Ergebnisse befruchtet. Die Arbeit trägt dazu bei, Vorstellungen zu relativieren, Sukzessionsvorgänge monokausal erklären zu wollen.
In einem eigenen Abschnitt möchte die Autorin die Relevanz ihrer Untersuchungen
für die Naturschutzarbeit, die Forstwirtschaft und die Waldforschung aufzeigen. Die Erhaltung von Eigenart und Diversität unserer Wälder sollte Motiv und Anreiz genug sein, sowohl grundlagenorientierte Studien als auch an einer Umsetzung entsprechender Erkenntnisse ansetzende Arbeiten zu fördern. Der Waldnaturschutz, häufig von Auseinandersetzungen verschiedener Glaubensbekenntnisse geprägt, kann davon nur profitieren. Das Buch ist vor allem dem grundlagenorientierten Vegetationskundler oder Pflanzenökologen zu empfehlen. Aber auch der mehr an naturschutzbezogenen Themen orientierte Leser erhält Anregungen für die Bewertung von Störungsmustern in Wäldern und auch in anderen Habitaten.
Walter Seidling
Botanik und Naturschutz in Hessen, Heft 18, 12.12.2005, S. 94-99