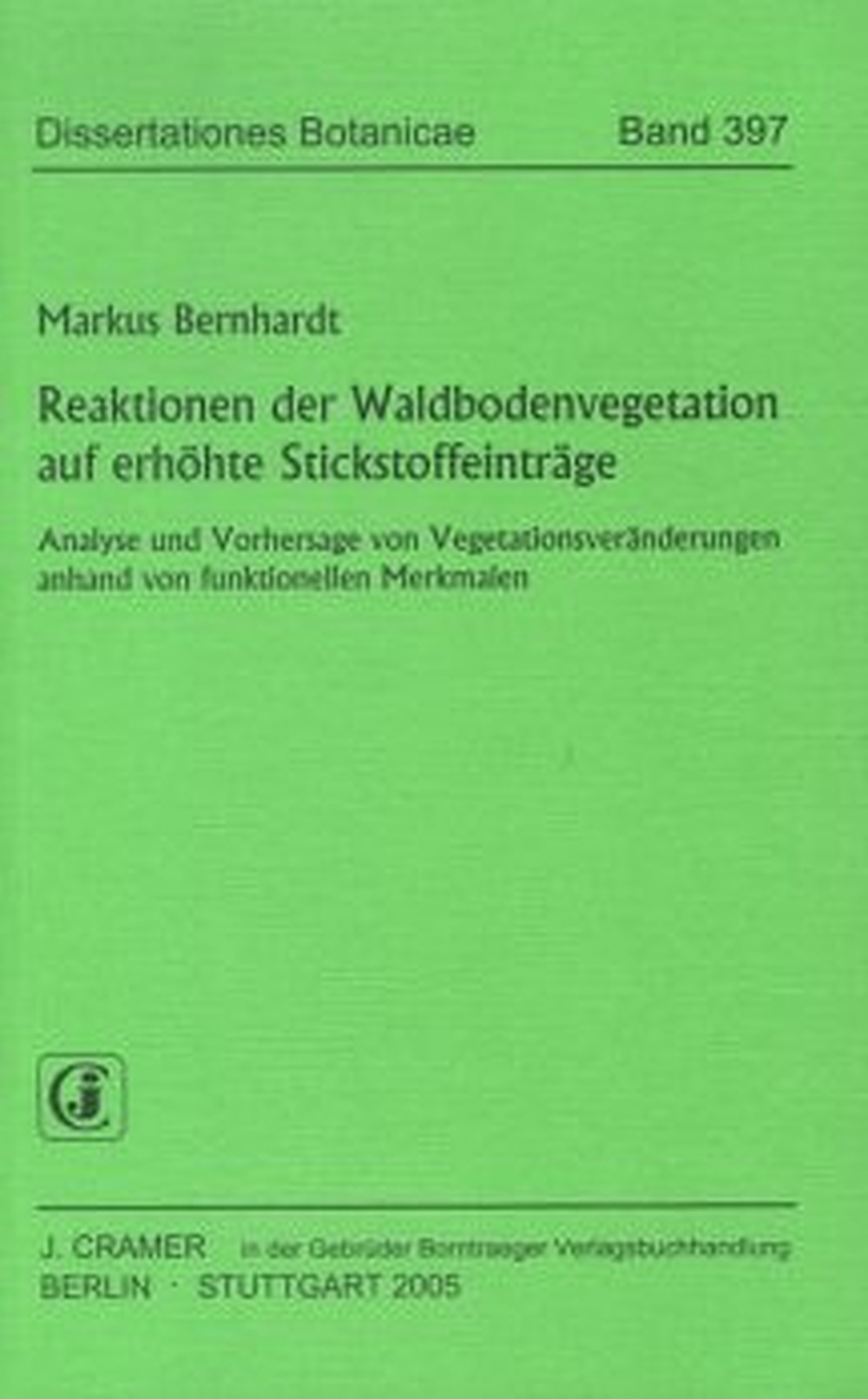Seit Jahrzehnten gelangen Stickstoffverbindungen aus der Luft in die
Waldökosysteme der Industrieländer. Wie reagiert die Vegetation auf
diese Stickstoffeinträge, bzw. wie verändern sich dadurch das
Pflanzenwachstum und die Artenzusammensetzung? Markus Bernhardt setzte
sich in seiner Dissertation das Ziel, mit verschiedenen Ansätzen
Vegetationsveränderungen ausgewählter Waldbestände in Bayern als Folge
von Stickstoffeinträgen nachzuweisen. Grundlage hierzu waren
Vegetationserhebungen und Bodenanalysen entlang von räumlichen und
zeitlichen Immissionsgradienten. In der hier vorgestellten Arbeit sind
vier Untersuchungsberichte zusammengestellt, umrahmt von einer
Einleitung und einer zusammenführenden Diskussion. Folgende Punkte zu
den vier Untersuchungen möchte ich hervorheben:
Ein ebener Fichtenforst neben einer Autobahn diente zur Ermittlung des
räumlichen Stickstoffeinflusses auf die Waldvegetation. Entlang eines
knapp 1 km langen Transekts wurden insgesamt 30 Quadrate
vegetationskundlich erhoben. Mit zunehmender Distanz zur Autobahn
verringerten sich die Nährstoffgehalte im Oberboden. Ebenso veränderte
sich die Artenzusammensetzung entlang des Gradienten. Sie
stabilisierte sich ab einer Distanz von 230 bis 520 m.
Am Beispiel eines isolierten Waldbestandes inmitten von Ackerland
(Echinger Lohe; Eichen-Hainbuchenwald) wurden landwirtschaftlich
bedingte Stickstoffeinträge entlang von Raum- und Zeitgradienten
analysiert. Vergleiche von älteren Vegetationskartierungen und
Dauberbeobachtungen mit aktuellen Erhebungen zeigten, dass sich
stickstoffanzeigende Gefässpflanzen und Moose innerhalb von rund 40
Jahren ausdehnten und Magerkeitszeiger wie Berg- und Weisssegge
abnahmen. Reichere Varianten der Waldgesellschaft entwickelten sich
von den Waldrändern her gegen das nährstoffärmere Waldinnere.
Anhand von funktionellen Pflanzenmerkmalen wurde die Wirkung der
Nährstoffeinträge in die Waldvegetation ökologisch interpretiert.
Hierfür wurden aus verschiedenen Datenbanken Pflanzeneigenschaften für
die Arten im isolierten Waldbestand der Echinger Lohe
zusammengestellt. Aufgrund übereinstimmender Merkmale wurden die
Arten zu funktionellen Gruppen (PFTs) aggregiert. Mit den PFTs wurde
gezeigt, wie räumliche und zeitliche Veränderungen der Vegetation sich
entsprachen: Nährstoffreiche Gesellschaftsvarianten enthielten
konkurrenzstarke Pflanzen mit grossen Blättern und frühblühende Arten,
welche der Konkurrenz zeitlich ausweichen.
In einem Düngungsexperiment wurden fünf Waldgesellschaften
Stickstoffmengen von 30 oder 60 kg/ha zugefügt. Die Effekte auf das
Pflanzenwachstum wurden bei 11 Kraut- und Grasarten an vegetativen und
generativen Pflanzenteilen gemessen. Mittels Metaanalyse von
Effektgrössen konnte der Autor zeigen, dass nur vegetative
Wachstumsparameter wie Blattanzahl, Blattlänge oder Sprosshöhe auf
zusätzlichen Stickstoffeintrag reagieren. Die Wachstumsreaktionen
hingen von der Stickstofflimitierung des Standorts ab. Auf basischem
Substrat waren die Reaktionen nicht signifikant.
Die gesamte Arbeit besticht durch die Kombination von Methoden zur
Darstellung und Prüfung der Resultate. So haben hier zwischen zwei
Deckeln diverse Anwendungen für die wesentlichen multivariaten und
heute publizierbaren Analysemethoden Platz. Gute Lesbarkeit und eine
reiche Bibliographie vervollständigen meinen sehr positiven Eindruck
von dieser Arbeit, die ich gerne weiterempfehle. Da es sich bei drei
der vier Untersuchungen um Fallbeispiele mit Pseudoreplikationen
handelt, kann ein Grossteil der Resultate allerdings nicht
verallgemeinert werden.
Dr. Thomas Wohlgemuth, Birmensdorf
Botanica Helvetica 116, 2006, S. 202-203