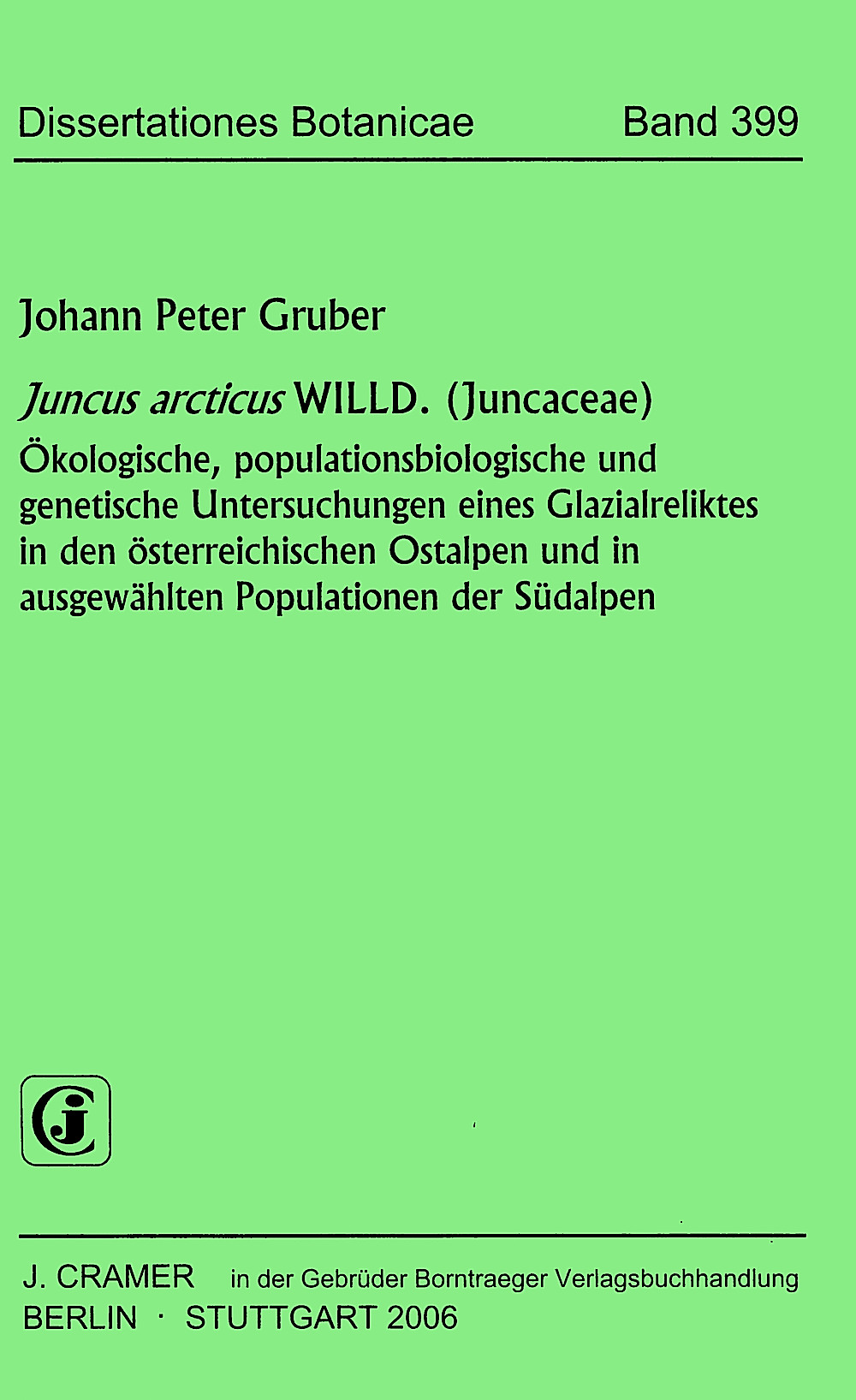Juncus arcticus ist eine zirkumpolar verbreitete Art der Arktis und
Subarktis mit wenigen Enklaven in den Alpen, die als eiszeitliches
Relikt gedeutet werden. In dem hier vorliegenden Werk gibt der Autor
einen Überblick über die interessante Ökologie von J. arcticus in den
Ostalpen.
Gut gefällt dabei der breite Methodenansatz, der von detaillierter
Geländearbeit, wie der Messung der Wassertemperatur an
Quellhorizonten, über die genaue Dokumentation verschiedenster
ökologischer Standortfaktoren, pflanzensoziologischen Untersuchungen
bis hin zu Kulturversuchen reicht. Bei aller Gründlichkeit in Bezug
auf das eigene Untersuchungsgebiet verliert der Autor aber nie die
weite Verbreitung der Art aus den Augen. Bei fast allen Aspekten
seiner Untersuchungen zieht er mittels Literaturauswertung Vergleiche
zu den Populationen in Skandinavien und den Westalpen.
In der Regel ist die Methodik gut erläutert, einzig das Kapitel über
die „Petrologischen und pedologischen Standortfaktoren“ (S. 49 f.) ist
für den Nicht-Geobotaniker etwas unverständlich. Hier wünscht man sich
ähnlich ausführliche Erläuterungen, wie sie beispielsweise im Kapitel
zur Morphologie der Juncaceae gegeben werden.
Dieses kleine Manko mag seinen Grund darin haben, dass der Schwerpunkt
der Arbeit eindeutig in der Ökologie der Art liegt und Methoden der
Pflanzensystematik nur gestreift wurden. Die genetischen
Untersuchungen beschränken sich auf die trnL-trnF-Region und auch die
morphologische Charakterisierung der Populationen allein aufgrund des
Verhältnisses von Hochblatt- zu Schaftlänge, sowie der mittleren Zahl
der Einzelblüten, erscheint in Bezug auf den Umfang der Datenlage ein
wenig dürftig (Kapitel 4.11 und 4.12.).
Umso mehr freuen dann wieder die ausführlichen ökologischen
Untersuchungen. So werden die rezenten Vorkommen in den Ostalpen genau
beschrieben. Diese Vorkommen wurden über viele Jahre beobachtet, so
dass beispielsweise die Lebensraumzerstörung durch den Skitourismus im
Komperdell-Gebiet gut dokumentiert ist (S. 74f). Aber auch erloschene
Vorkommen sind dokumentiert, wobei versucht wurde, die Ursachen für
ein etwaiges lokales Aussterben zu ergründen (S. 80ff), in manchen
Fällen scheinen jedoch auch die alten Fundortangaben falsch zu
sein. Eine solche Dokumentation, die eine zeitaufwändige und genaue
Geländearbeit voraussetzt, ist ein schätzenswerter Beitrag für
Vergleiche zwischen früherer und heutiger Verbreitung der Art.
Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Abgrenzung des
Lebensraum-Spektrums der einzelnen Teilpopulationen. Eine Pionierart
im Gelände zu beobachten, ist wegen der Dynamik ihrer Standorte
schwierig, zumal J. arcticus, wie andere Juncaceen auch, neben der
Vermehrung durch Samen auch auf klonale Vermehrung mittels Rhizomen
setzt. Durch (echte) Langzeitversuche mit kultivierten Pflanzen, die
über 11 Jahre liefen, erarbeitete sich der Autor Grundlagen, die dann
mit Geländebeobachtungen und pflanzensoziologischen Aufnahmen
abgeglichen wurden. So konnte er nicht nur zeigen, dass J. arcticus
eine ausgesprochene Pionierart ist, die Feinschluffplaiken bevorzugt
und mit zunehmendem Konkurrenzdruck anderer Arten auf weiter
entwickelten Böden verschwindet, auch eine Abschätzung des Alters der
Biotope ist so möglich.
Abschließend werden europäische Schutzbemühungen diskutiert, was
angesichts der festgestellten Bestandsverluste und der Bedeutung von
J. arcticus als reliktärer Art dringend angezeigt ist, zumal
Österreich noch keine Schutzbemühungen anstellt, obwohl die Art
IUCN-Kriterien erfüllt. Aber man ist es aus unserem Nachbarland
gewohnt, dass Naturschutzbelange häufig dem Ski-Tourismus geopfert
werden, wobei natürlich die dahinter stehenden wirtschaftlichen
Interessen von Deutschland aus kräftig mit bedient werden.
C. Köbele
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 2007