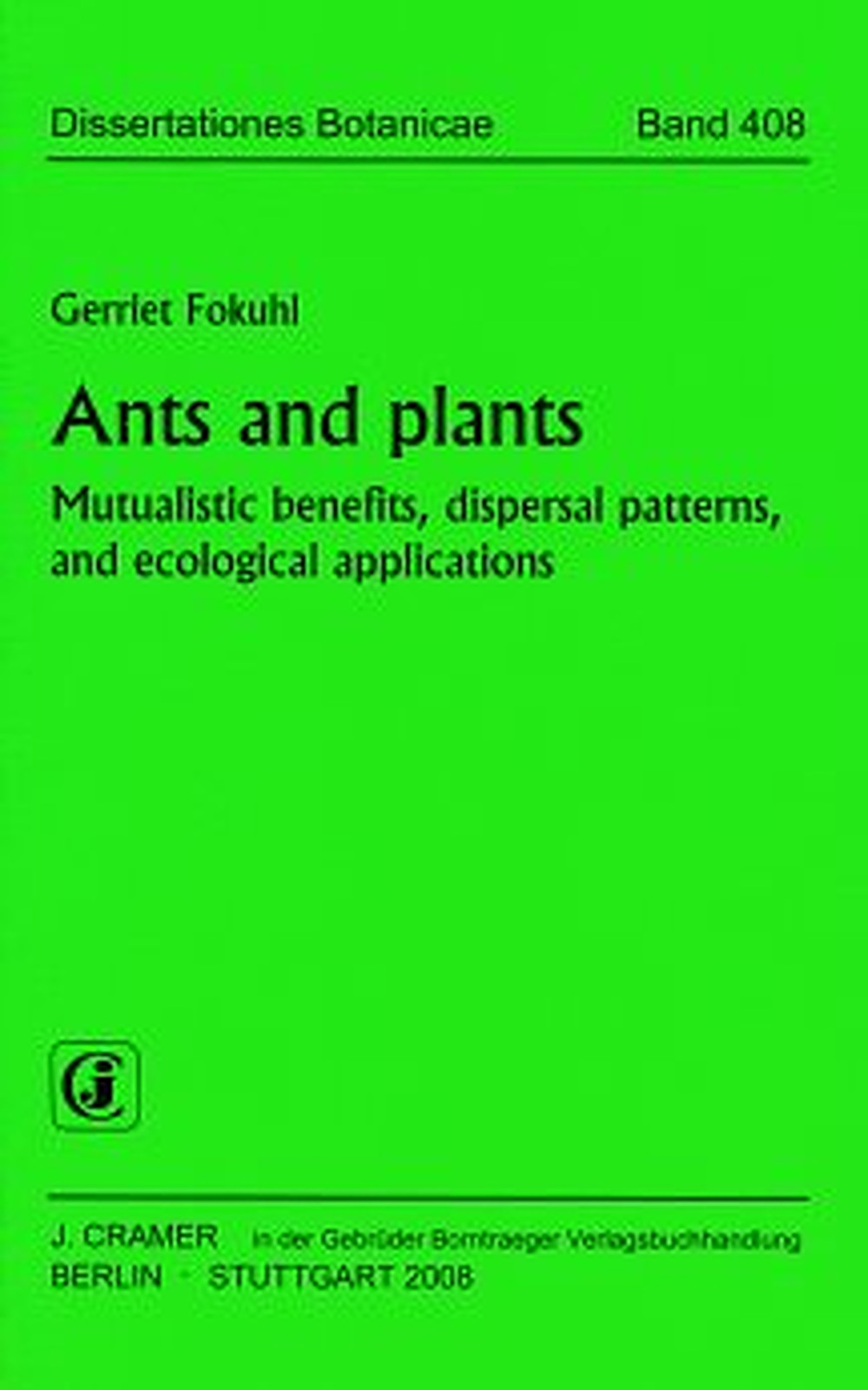Ameisen stellen einen erheblichen Anteil der terrestrischen Biomasse
und treten in beeindruckenden Individuenzahlen auf. Kein Wunder, dass
sich überall auf der Welt Interaktionen zwischen Pflanzen und Ameisen
entwickelt haben vom lockeren Zusammenleben bis hin zu erstaunlichen
Abhängigkeiten, die sich soweit verfeinert haben, dass weder die
Ameisenpflanzen noch die Pflanzenameisen alleine zu leben
vermöchten. In Mitteleuropa spielen sich Beziehungen zwischen Pflanzen
und Ameisen ganz vornehmlich als Myrmekochorie ab, also als die
Ausbreitung von Samen und Früchten durch Ameisen. Sie kommt bei
ungefähr 200 Samenpflanzen vor. Zum Syndrom der Ameisenausbreitung
gehört die Bildung von Elaiosomen an den Diasporen. Diese
nährstoffreichen Anhängsel locken Ameisen an und dienen als
Nahrung. Die Ameisen verschleppen die Ausbreitungseinheiten und
besorgen dabei die Ausbreitung der Pflanzen. Die Distanz ist freilich
mit durchschnittlich einem Meter gering. Seit Sernander 1906 erstmals
die europäischen Myrmekochoren umfassend erforschte, sind zahlreiche
einschlägige Arbeiten erschienen. Viele Fragen harren jedoch immer
noch der Klärung, zum Beispiel ob Pflanzen neben der reinen
Diasporenausbreitung weitere Vorteile genießen und welchen Gegenwert
die tierischen Partner für ihre Dienste erhalten.
Gerriet Fokuhl, betreut von einem Zoologen und einem Botaniker der
Universität Regensburg, hat in seiner Doktorarbeit versucht, wichtige
Fragestellungen experimentell zu lösen. Sieben von neun Kapiteln der
Arbeit behandeln die einzelnen Experimente, deren Anordnung und
Auswertung anschaulich und ausführlich dargestellt werden. Eine Studie
analysiert die Ausbreitungsmuster einiger myrmekochorer Pflanzenarten
auf besonders hergerichteten rund acht Quadratmeter großen Flächen
unter natürlichen Bedingungen. Es ergibt sich, dass die Myrmekochoren
bei Anwesenheit von Ameisen weiter ausgebreitet werden, als wenn man
sie fernhält. Die verminderte Keimlingskonkurrenz wird als weiterer
Vorteil angesehen. Fütterungsversuche mit elaiosomentragenden Samen
bestätigen die Annahme, auch Ameisen würden von der Samenverbreitung
profitieren. Ihre Nester enthalten signifikant mehr Puppen von
Arbeiterinnen als Kontrollkolonien. Es liegt also tatsächlich eine
mutualistische Beziehung vor. Ein anderer Versuch erforscht das
Keimungsverhalten der Samen nach Entfernen des Elaiosoms. Bei acht von
28 mitteleuropäischen Arten steigt die Keimungsrate daraufhin an. Die
Behandlung mit Myrmicacin hingegen beeinflusst die Keimung bei zwei
von acht getesteten Arten negativ. Mit dieser Substanz können Ameisen
die Samenkeimung in ihren Nestern verhindern. Bodenanalysen machen
wahrscheinlich, dass in der unmittelbaren Umgebung von
Waldameisennestern günstigere Bedingungen für myrmekochore Pflanzen
herrschen. Schließlich wird auch die Bedeutung von Ameisen als
Bioindikatoren beim Vergleich von alten mit jungen Kalkmagerrasen und
für Renaturierungsmaßnahmen untersucht. Die Arbeit bietet viele
Anregungen für weitere Experimente zu den faszinierenden Interaktionen
zwischen Pflanzen und Ameisen. Nicht zuletzt enthält sie direkt
umsetzbare Anregungen für den aktiven Naturschutz.
P. Döbbeler
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 78, 2008