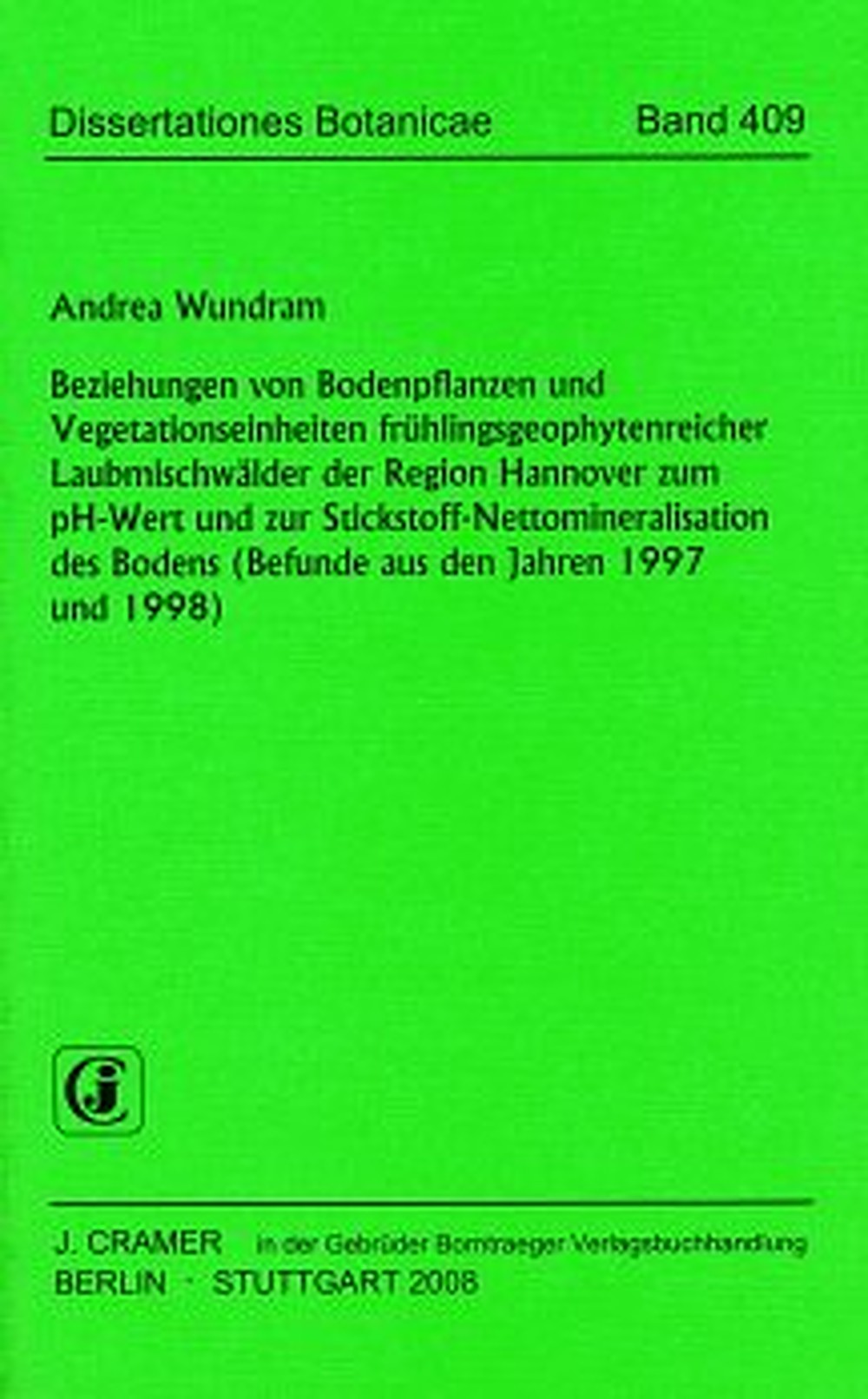Die Dissertation (49 €) wurde in der Arbeitsgruppe H. Möller am
Institut für Geobotanik der Universität Hannover erstellt. Der Titel
erinnert fast an Untersuchungen, die bereits in den 1930er Jahren von
H. Ellenberg in ähnlichem geografischem Rahmen durchgeführt wurden. In
der Tat wird hier auf Ellenberg Bezug genommen, nämlich auf seine
Zeigerwerte von 1992, zusätzlich auf die ökologischen Angaben in der
Oberdorfer-Flora von 2001. Verschiedene Angaben deuten darauf hin,
dass relativ anspruchsvolle Waldbodenpflanzen heute, bei neuzeitlicher
Bodenversauerung durch Immissionen, auch auf saureren Standorten
wachsen, als es die Zeigerwerte erwarten lassen, was hier überprüft
werden soll. Hierfür sind umfangreiche pH-Messungen in 83 Böden zu 6
über das Jahr verteilten Zeitpunkten und in vier Profiltiefen
(insgesamt etwa 5000 Messungen) ein Kernstück der Arbeit. Die im Titel
angesprochenen Stickstoffdaten wurden in 30 Böden ähnlich
differenziert im Brutversuch ermittelt. Voraus geht in der Arbeit eine
Vegetationsanalyse von 190 Aufnahmen verschiedener
Eichen-Hainbuchenwälder, die lokal sehr fein in 28 Untereinheiten auf
6 Hierarchieebenen gegliedert werden und teilweise mit weithin
ermittelten Untereinheiten des Stellario-Carpinetum im Groben
übereinstimmen. Die sehr detaillierte Auswertung richtet sich einmal
auf diese Einheiten in Bezug zu den ökologischen Daten, außerdem auf
50 ausgewählte Arten der Krautschicht. Die vergleichende Auswertung
ist sehr ausführlich, mit einem riesigen Tabellenteil, zwischen dem
der Text oft nur kleinen Raum füllt. Offenbar hat die Autorin eine
Abneigung gegen Grafiken, die der Arbeit völlig fehlen, aber sicher in
vielen Fällen für mehr Übersicht gesorgt hätten. Auch
Ordinationsverfahren hätten sich für eine zusammenfassende Betrachtung
angeboten. So muss sich der Leser durch eine nicht enden wollende Zahl
von Einzeldaten mühen, wobei der Überblick ziemlich verloren
geht. Letztendlich geht es um den Bindungsgrad der Arten und
Vegetationseinheiten an bestimmte (4) pH-Wertklassen, entsprechend
auch um Stickstoffversorgungsbereiche. Nach der vielseitigen
Einzeldarstellung hofft man auf eine übersichtliche zusammenfassende
Diskussion. Unerwartet steh man aber plötzlich schon bei der
Zusammenfassung. Ihr lässt sich in Kürze entnehmen, dass u. a. 15 der
37 häufigsten Arten heute unter saureren Bedingungen vorkommen, als es
die Zeigerwerte erwarten lassen, auch manche Vegetationseinheiten in
Bezug zu mittleren Zeigerwerten. Zumindest für das Untersuchungsgebiet
müssen diese also mit Vorsicht betrachtet werden. Ähnliche Ergebnisse
gibt es auch anderswo, worauf aber nicht eingegangen wird. Das
Literaturverzeichnis ist für eine Dissertation entsprechend kurz. Die
CD enthält einige Tabellen, wobei man die (hier weniger wichtigen)
Vegetationstabellen auf dem Bildschirm nicht lesen kann. Die Abbildung
der Untersuchungsgebiete hätte auch in den Text gepasst.
H. Dierschke
Tuexenia 29 (2009) S. 452-453