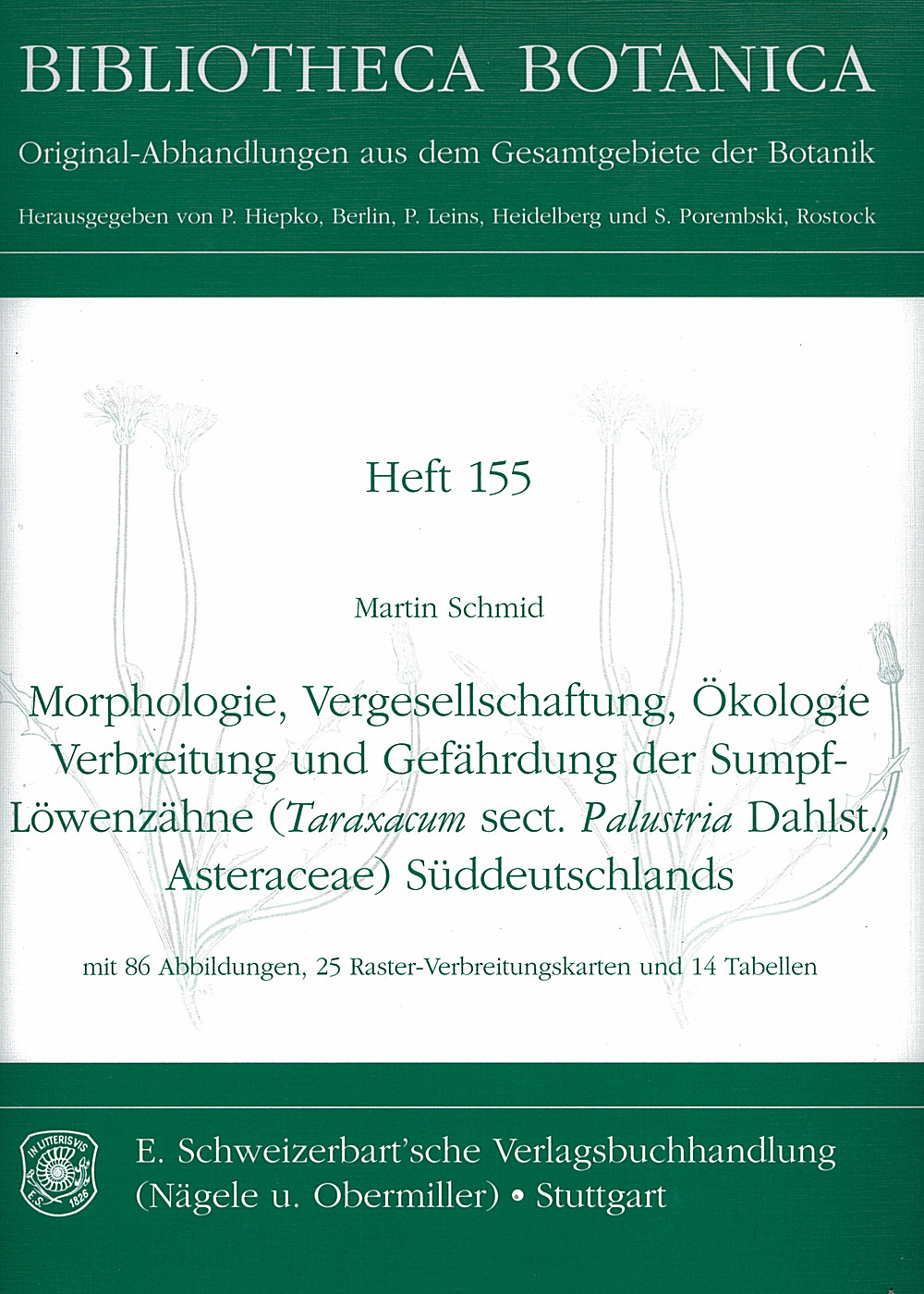Das vorliegende Werk entstand als Dissertation am Staatlichen Museum
für Naturkunde in Stuttgart und behandelt die 24 bislang in
Süddeutschland nachgewiesenen Taxa der Sumpf- Löwenzähne (Taraxacum
Sektion Palustria). Da somit auch die beiden unmittelbar an Österreich
angrenzenden bundesdeutschen Länder Bayern und Baden-Württemberg in
dieser Arbeit erfasst werden, ist die Darstellung auch für (West-)
Österreich interessant.
Die Arbeit, welche vorwiegend auf Feldstudien des Verfassers basiert,
widmet sich vor allem der Morphologie, der Ökologie, der Chorologie
und der Gefährdung der Sumpflöwenzähne. Nach einem kurzen Überblick
über die Forschungsgeschichte der Palustria in Süddeutschland, ihrer
Evolution sowie der Bedeutung der Apomixis für die Artbildung, folgen
eine ausführliche Darstellung aller im Gebiet vorkommender Arten
(inklusive ganzseitiger Strichzeichnungen des Autors) und eine ebenso
ausführliche Analyse der Vergesellschaftung der einzelnen Arten in
Süddeutschland. Weitere Kapitel widmen sich der vergleichenden
Chorologie, der Gefährdung der Sektion in Süddeutschland sowie der
Bedeutung der Erhaltung geeigneter Standorte innerhalb des
süddeutschen Teilareals für den Naturschutz.
Die vorliegende Publikation behandelt die untersuchte Sektion der als
bestimmungskritisch und daher als unterbearbeitet bekannten Gattung
Taraxacum in vorbildlicher Ausführlichkeit. 261 Insbesondere die
Abschnitte zur Morphologie und Vergesellschaftung lassen kaum Wünsche
offen. Für die Einarbeitung in die Sektion Palustria sind
insbesondere der Bestimmungsschlüssel der Sumpflöwenzahn-Arten
Süddeutschlands (pp. 13-16) sowie die darauf folgende Darstellung der
Morphologie der süddeutschen Vertreter (pp. 17-82) relevant. Wie der
Verfasser kritisch anmerkt ist allerdings mit diesem Schlüssel allein
nicht in allen Fällen eine sichere Bestimmung gewährleistet. Die im
chorologischen Teil abgebildeten Punktkarten sind leider recht
unscharf (große Punkte für die Vorkommen auf einer Karte mit grobem
Maßstab), dies wird jedoch z.T. durch weitere auf die Verbreitung in
Süddeutschland fokussierte Rasterkarten ausgeglichen.
Die an anderer Stelle kritisierte Verwendung der Zeigerwerte nach
Ellenberg im ökologischen Teil (Horn in Ber. Bayer. Bot. Ges. 2004,
73/74: 257-259) fällt meiner Ansicht nach nicht negativ ins Gewicht,
da diese Werte einen guten Einblick in die durchschnittlichen
Standortansprüche der Begleitvegetation bieten und da dem Verfasser
als Mitarbeiter eines Museums die notwendigen Gerätschaften für
weitere chemische Analysen nicht zur Verfügung gestanden haben
dürften.
Wer angesichts des astronomischen Preises [€ 178,- (D)] ein fest
gebundenes Werk mit zahlreichen kostenaufwändigen Farbabbildungen
erwartet wird erstaunt sein, dass es sich bei diesem 155. Heft in der
Reihe Bibliotheca Botanica um ein recht großformatiges (23 x 31 cm)
"Soft-Cover-Buch" handelt, in welchem farbige Abbildungen
vollständig fehlen. Der hochinteressante Inhalt des Buches, welches
die Einarbeitung in diese überschaubare und für den Naturschutz
besonders relevante Gruppe der Gattung Taraxacum wesentlich
erleichtert, machen jedoch eine Anschaffung für mit der botanischen
Systematik und dem Naturschutz befasste Institutionen und wohl
situierte Einzelpersonen dennoch interessant.
Ergänzend sei erwähnt, dass der Verfasser dieser Dissertation das
Erscheinen der Arbeit wegen seines tragischen Unfalltodes nicht mehr
erleben durfte. Ein Nachruf auf Martin Schmid ist in Band 72 (2002)
der Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zu finden.
Christian Zidorn (Innsbruck)
Ber. nat.-med. Verein Innsbruck, Bd. 93 (2006), S. 260-261