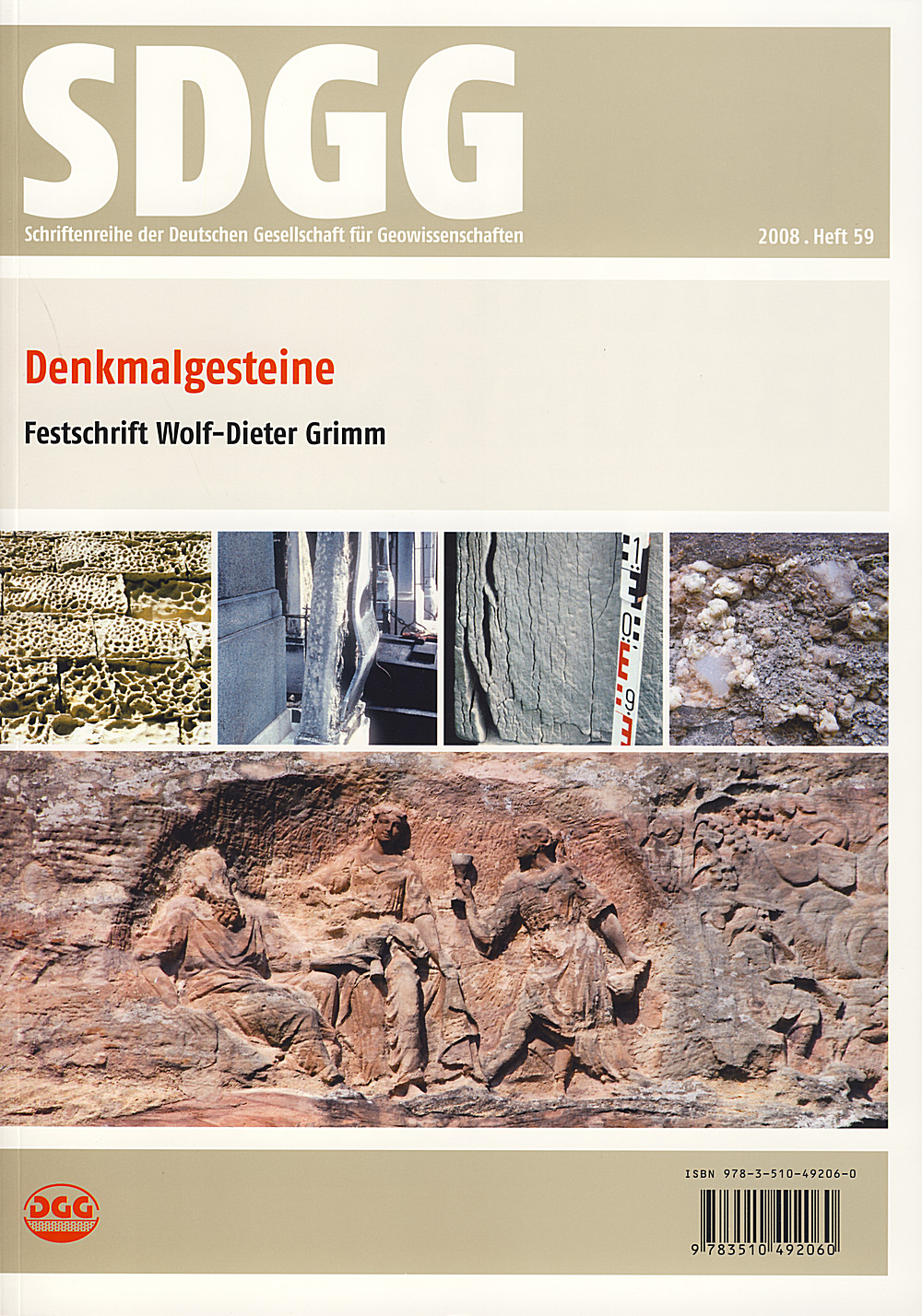Der Band „Denkmalgesteine“ in der Schriftenreihe der DGG ist dem
80. Geburtstag von Herrn Prof. Dr. Wolf-Dieter Grimm in Würdigung
seiner Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Natursteine gewidmet,
insbesondere der systematischen Erfassung und wissenschaftlichen
Untersuchung von Denkmalgesteinen. Nach einer von R. Snethlage
verfassten Würdigung des Jubilars, der ein umfassendes
Literaturverzeichnis wichtiger Arbeiten W.-D. Grimms angefügt ist,
enthält der Band 21 weitere Arbeiten, die aktuelle
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Denkmalgesteine widerspiegeln.
Die Themen sind dabei weit gespannt. So finden sich Publikationen, die
die Erforschung der Verwitterungsdynamik von Denkmalgesteinen und die
naturwissenschaftliche Begleitung von Denkmalinstandsetzungen zum
Gegenstand haben, um so Restauratoren Sicherheit bei der Auswahl von
Konservierungsmethoden zu geben. Objekte derartiger Studien sind
beispielsweise Grabmalinstandsetzungen in München (L. Sattler et al.),
Restaurationsarbeiten auf zwei jüdischen Friedhöfen in Berlin
(A. Ehling et al.), oder Untersuchungen zur Verwitterungsdynamik von
Marmorskulpturen im Schlosspark von Nymphenburg (W. Köhler).
Methodisch verschiebt sich der Schwerpunkt derartiger Untersuchungen
immer mehr von Verfahren, die eine Probenahme erfordern, hin zu
zerstörungsfreien Ultraschallmessungen, durch die tief in den Stein
hineinreichende Lockerungen der Kornstruktur detektiert und durch
Wiederholungsmessungen in ihrem zeitlichen Verlauf beobachtet werden
können.
Weitere Arbeiten haben die Beschreibung ehemals aktiver Steinbrüche
zum Gegenstand, aus denen Denkmalgesteine gewonnen
wurden. Hervorzuheben ist hier die Publikation über den Rosenheimer
Granitmarmor, der nur in einem sehr kurzen Zeitraum für
Werksteinzwecke gewonnen wurde und somit insbesondere in Südbayern ein
spezielles „Zeigergestein“ für Grabsteine, Denkmale, Fassadenelemente
und Dekorationsgesteine für Gebäudeinnenausstattungen in der Mitte des
19. Jahrhunderts darstellt (K. Poschlod). In diesem Zusammenhang ist
auch die Darstellung der Neugewinnung des Kaiserstühler
Tephrit-Pyroklastits für Restaurationsarbeiten am Breisacher
St. Stephans Münster zu nennen (W. Werner). Hier gelang es durch
intensive geologische Prospektion, in den ansonsten am Kaiserstuhl nur
vereinzelt anzutreffenden Bereichen pyroklastischer Gesteine mit
ausreichernder Verfestigung für eine Bearbeitung dennoch die
benötigten Mengen an witterungsbeständigem „Kaiserstühler Tuffstein“
zu finden und zu gewinnen. Der Beitrag zeigt exemplarisch, wie mit
vertretbarem Aufwand auch seltene historisch verwendete Gesteine aus
einheimischen Lagerstätten gewonnen und bei Restaurationsarbeiten
eingesetzt werden können.
Territorial größere Gebiete mit einer Vielzahl von betrachteten
Objekten überstreichen die Darstellungen der geologisch untersuchten
Gesteine historischer Bauwerke im Münsterland und angrenzender Gebiete
Nordwestdeutschlands von U. Kaplan sowie die Arbeiten über Natursteine
an Fassaden von Gebäuden der Leipziger Innenstadt (K. Raum &
H. Siedel) und Findlingskirchen in Norddeutschland (K.-D. Meyer).
Weitere methodische Beiträge schlagen den Bogen von der Entstehung,
über gesteinstechnische Eigenschaften und Verarbeitbarkeit bis hin zur
Verwitterung, Konservierung und Restaurierung – insbesondere für
Sandsteine (R. Koch & R. Sobott sowie E. Stadlbauer et al.).
Aus bauhistorischer Sicht als sehr wertvoll einzuschätzen ist die
Abhandlung über den Lahnmarmor (Nassauer Marmor), der über
Jahrhunderte einen international bekannten Naturstein aus Deutschland
darstellte, inklusive einer akribisch zusammengetragenen Auflistung
alter Steinbrüche, historischer Handelsnamen und deren zeitlicher
Einordnung (T. Kirnbauer).
Gegenstand von Beiträgen über Denkmalgesteine außerhalb Deutschlands
sind Bauwerkskartierungen des Schlosses zu Buda in Ungarn
(C. Schneider et al.), Betrachtungen zu antiken Marmoren in
Rom/Italien (H.-U. Cain & M. Pfanner) sowie Lagerstättenerfassung und
-bewertung von Marmoren in Tansania (S. Mosch & S. Siegesmund).
Die durch die verschiedenen Beiträge vermittelten Inhalte werden durch
eine sehr gute Ausstattung des Bandes mit vielen qualitativ
hochwertigen Fotos und sonstigen Abbildungen unterstützt. Aufgrund
des insgesamt abgehandelten weiten Spektrums der geowissenschaftlich
orientierten Denkmalsforschung sowohl in methodischer Breite als auch
in regionaler Streuung ist der Band jedem mit Natur- und
Denkmalgesteinen beschäftigen Fachmann zu empfehlen und bietet darüber
hinaus auch der interessierten Öffentlichkeit wertvolle Informationen.
Thomas Höding
Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge 1/2-2009, S. 62