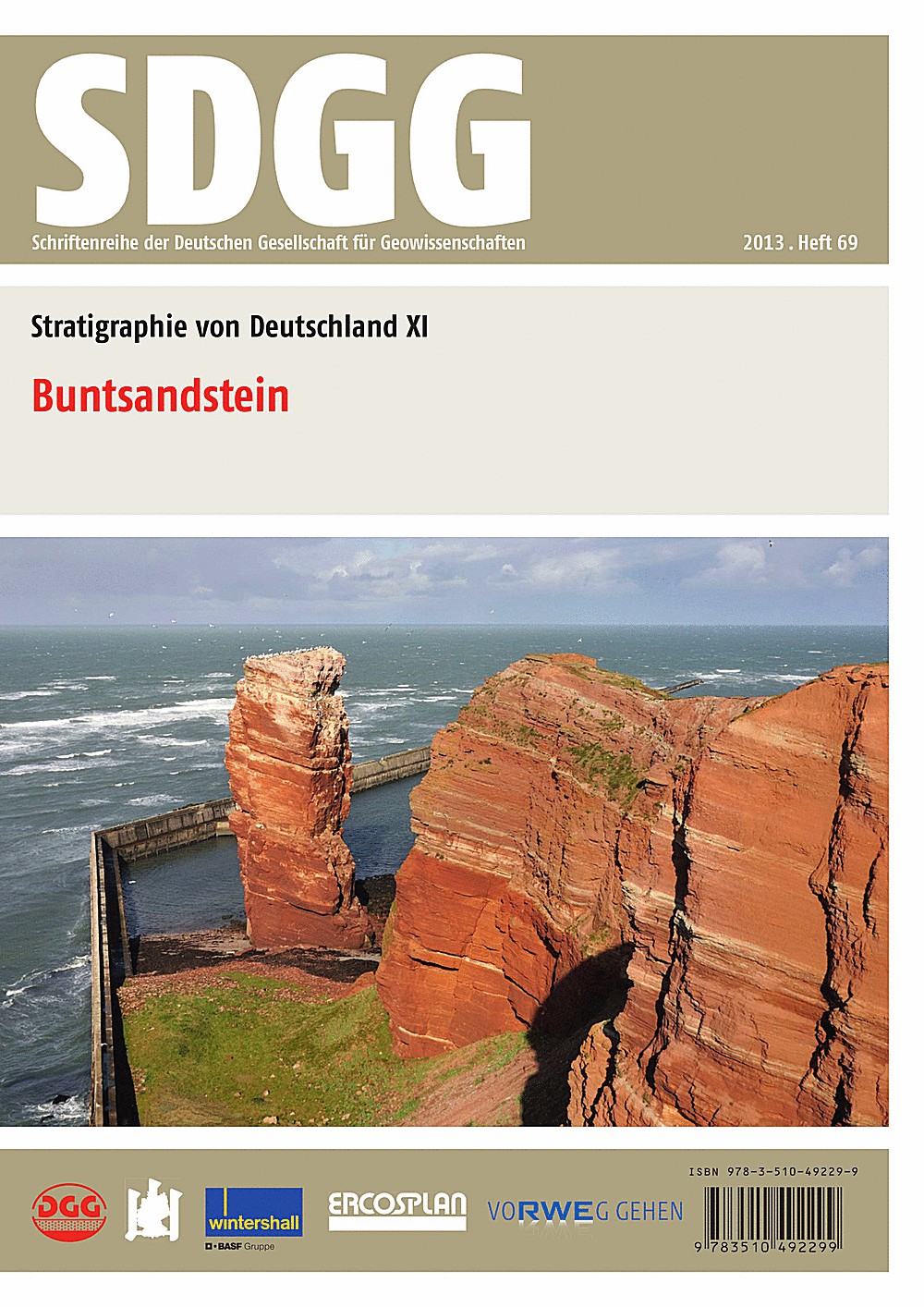Über 650 Seiten Buntsandstein! Die Beiträge von 27 Autoren refl
ektieren in diesem Band den Stand der Forschung. Sie gründen damit auf
25 Jahre währenden Diskussionen und Absprachen in den entsprechenden
Stratigraphischen Kommissionen. Stellvertretend für die vielen
Autoren, die Beiträge geschrieben haben, sollen hier zunächst nur
Jochen Lepper und Heinz-Gerd Röhling namentlich genannt sein, die mit
den vielen anderen zusammen ein aktuelles Who is Who des Buntsandstein
bilden. Sie alle haben dazu beigetragen, dass diese geologische
Einheit, die man stark vereinfacht früher einmal als Wüstenbildung
interpretierte und die vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus als
die größte Misere Deutschlands galt, zu einem höchst interessanten
Abschnitt mitteleuropäischer Erdgeschichte avanciert ist.
Als Einführung in die Lektüre empfiehlt es sich, zunächst das Kap. 3
Paläogeographie des Mitteleuropäischen Beckens (Röhling & Lepper),
sowie Kap. 7.3, den Statusbericht zu Sequenz-, Base-level- und
Zyklostratigraphie (Tietze & Röhling) zu lesen, der sich kritisch mit
den Sequenzen und Zyklen befasst und die Ansätze zu einer dynamischen
Stratigraphie im Vergleich mit der konventionellen Lithostratigraphie
thematisiert. Dennoch gibt es auch auf diesem Gebiet noch weiteren
Forschungsbedarf. Das betrifft unter anderem den Formationsbegriff ,
der nicht immer zweifelsfreie Abgrenzungen
sichert. Forschungsgeschichtlich vorausgegangen war die Gliederung in
Folgen, die man heute oft direkt als Einheiten im Sinne von
Formationen handhabt. Die den Folgen zugrunde liegenden Ansätze zu
einer zyklischen Gliederung werden unterschiedlich begründet:
Tektonik, die die Diskordanzen erklärt, oder Klimawandel im
Zusammenhang mit Milankovitch-Zyklen. Da am Anfang immer beobachtbare
Korngrößenwechsel in den vorwiegend siliziklastischen Ablagerungen
stehen, kommen als Erklärung auch die bereits im Perm angelegten
Senken und Schwellen infrage, die zyklische Faziesänderungen gesteuert
haben könnten; hier haben die Diskordanzen ihren Platz und auch die
Bodenbildungen.
Den Hauptteil der Einführung nehmen jedoch die Sequenzen und deren
Grenzen ein, wobei es offensichtlich noch kein genetisch begründetes,
einheitliches Modell gibt, mit dessen Hilfe man beckenintern
korrelieren und das auch auf die Nachbarregionen übertragen
könnte. Hier stellt sich dann sofort auch die Frage nach der
Angleichung der stratigraphischen Nomenklatur. Den gegenwärtigen Stand
fasst eine sehr gute Tabelle (7.3-1) zusammen, die im Verein mit der
Abb. 7.3.-3 zu den informativsten Illustrationen dieses Bandes
gehört; dort sind in einem schematischen Nord-Süd-Profil von der
Ringköbing-Fünen-Schwelle bis zum Schwarzwald die faziellen
Verhältnisse dargestellt.
Mit weit über 100 Seiten ist der Beitrag von Heinz-Gerd Röhling über
das Norddeutsche Becken und dessen regionale Besonderheiten der
umfangreichste. Der Autor hat sich dabei off ensichtlich nicht nur an
den dort in den lokalen Gräben vergleichsweise großen Mächtigkeiten
orientiert, sondern konnte, ausgehend von den Tagesaufschlüssen, die
vielen Bohrungen aus der Industrie für einen Vergleich heranziehen,
deren lange Zeit vertrauliche Daten erst allmählich zugänglich
wurden. Mit Helgoland wird hier auch der einzige Tagesaufschluss im
Beckenzentrum vorgestellt. Marine Einfl üsse während der Trias bringt
man gemeinhin mit der Tethys in Verbindung; mittlerweile scheinen aber
während des Unteren und Mittleren Buntsandstein marine Ingressionen
auch aus dem Borealen Bereich wahrscheinlich; da könnte das
Grabensystem im Zusammenhang mit dem Nordseerift und die in dessen
Folge entstandenen Viking-, Zentral-Graben und die weiter südlichen
Horn- und Glückstadt-Graben eine Rolle gespielt haben. Für die
Entwicklung und Gliederung des Buntsandstein im Norddeutschen Becken
wird schließlich auch die besondere Bedeutung von Karbonaten
thematisiert: Neben der im Subherzyn seit langem bekannten
„Hauptrogensteinbank“, „-zone“, der stratigraphische Bedeutung jetzt
nur noch im regionalen Rahmen zugebilligt wird, sind
oolithisch-karbonatische Horizonte im Unteren und bis in den Mittleren
Buntsandstein hinein entwickelt, die sich als Markerhorizonte auch
geophysikalisch verfolgen lassen. Inzwischen sind diese regional weit
verbreiteten Vorkommen auch petrographisch gut studiert und im
Hinblick auf die Paläogeographie des Bildungsraums interpretiert
worden: Oolithe und ihnen gelegentlich assoziierte Stromatolithe eines
flachen Binnensees gehen nach Süden in karbonatzementierte Sandsteine
über, die in Logs durch niedrige Gammastrahlung und hohe Schallhärte
geprägt sind. In den Bohrungen lassen sich auch sonst Schichtgrenzen
reflexionsseismisch erkennen und lateral verfolgen.
Aber die Feingliederung der klastischen Folgen basiert hier wesentlich
auf geophysikalischen Bohrlochmessungen, und die Profile sind anhand
der Logs beckenweit korrelierbar; das gilt auch für die tektonisch
bedingten Diskordanzen.
Für die praktische zeitliche Gliederung existiert mit den als s1 bis
s7 bezeichneten Folgen jetzt ein auch durch einige Diskordanzen
gegliedertes einfaches Schema für die Buntsandstein-Gruppe, das sich
sogar weit über die Grenzen des Beckens hinaus anwenden lässt (Lepper
et al. in Kap. 4, Lithostratigraphie). Die noch bestehenden
Unsicherheiten bezüglich der Zuordnung einzelner Schichtabschnitte
gehen auf die allgemeine Faziesentwicklung kontinentaler Rotsedimente
zurück, die durch laterale Faziesübergänge ebenso geprägt sind wie
durch vertikale Wiederholungen ähnlicher Fazies.
Nur Spezialisten sind meist in der Lage, selbst an größeren
Aufschlüssen sofort eine stratigraphische Zuordnung vorzunehmen; dabei
spielen dann auch die regionalen Sonderentwicklungen eine Rolle, die
jeweils in einzelnen Kapiteln behandelt sind. Jedem von uns ist noch
die stratigraphische Kleinstaaterei in Erinnerung, die sich immer da
gezeigt hatte, wo Messtischblätter unterschiedlicher Bundesländer auch
eine unterschiedliche Buntsandstein-Stratigraphie aufwiesen, Stichwort
„Blattrandverwerfungen“. Die o. a. Folgen sind durch Beschlüsse der
entsprechenden stratigraphischen Kommissionen als regionale
geochronologische Einheiten mit quasi-isochronen Grenzfl ächen defi
niert, während Formationen lediglich regionale und lokale
stratigraphische Einheiten darstellen. Damit ist auch die
Buntsandstein-Stratigraphie eine Sache von Absprachen, wobei in
Einzelfällen allerdings noch immer Diskussionsbedarf besteht.
Auch die internationale Klassifikation von supergroup über group,
subgroup, formation, member, bed, lamina ist auf den Germanischen
Buntsandstein nicht ohne weiteres übertragbar, weil z. B. die
entsprechende lithostratigraphische Supergruppe dem biostratigraphisch
defi nierten System Trias nicht ganz entspricht.
Kritisch wird auch angemerkt, ob man die letztlich von marinen
Ablagerungen abgeleiteten Sequenzen, die bisher erst ansatzweise auf
festländische Verhältnisse übertragen wurden, so direkt übernehmen
kann. Das gilt ähnlich auch für die Magnetostratigraphie. Erstmals
hatte ja bereits Johannes Wolburg anhand von Diskordanzen mit den
Sohlbankzyklen ein sequenzstratigraphisches Konzept entwickelt, dieses
aber mit epirogenetischen Prozessen begründet.
Auch die anfängliche Euphorie der VHs (Violetten Horizonte) als
Zeitmarker ist inzwischen einer kritischen Sicht gewichen; eine diff
erenziertere Betrachtung führt nun dazu, dass man sie heute nicht mehr
überall als geeignete Hilfsmittel für die stratigraphische Korrelation
ansieht.
Milankovitchzyklen im Buntsandstein? Der Beitrag von Menning & Käding
fasst den Stand zusammen, der – wie man einer einschränkenden Fußnote
des Koordinators entnehmen kann – noch nicht mit den mit der
Subkommision Perm/Trias abgestimmten Erkenntnissen im Einklang
steht. Er bringt aber eine möglicherweise wegweisende Methode ins
Spiel, die nach Ansicht des Rez. zu den interessantesten Ansätzen
zukünftiger stratigraphischer Korrelation innerhalb der gesamten Trias
führen könnte. Die zeitliche Gesamtdauer von etwa 8 Ma für den
Buntsandstein legt eine Aufl ösung in 85 Kleinzyklen von je 100 Ka im
Sinne von Milankovitchzyklen nahe. Hinweise kommen auch aus einer
Kombination von Gamma Ray und Sonic Log-Profi len vor allem in der
Beckensituation: Das betriff t dort Kleinzyklen 3. Ordnung, und die
Zyklen 4. Ordnung scheinen sogar die 20 Ka Präzessionszyklen
abzubilden.
Auch der meist etwas stiefmütterlich behandelten, und eher wenig
erfolgversprechenden Biostratigraphie ist ein Kapitel gewidmet: Was
man im Buntsandstein zunächst eher nicht erwartet, nämlich
stratigraphisch verwertbare Fossilien, wird hier vor allem anhand von
Conchostraken widerlegt, die für eine Feingliederung geeignet
scheinen. Conchostraken ermöglichen nämlich durch den äolischen
Transport ihrer Eier sogar eine Korrelation mit marinen Ablagerungen
der Tethys. Daneben scheinen vor allem Palynomorphen-Gesellschaften
(die sogar farbig abgebildet sind) bis in den faziellen Bereich hinein
erkennbare Gliederungsmöglichkeiten zu bieten – im Zechstein
vorwiegend Pollenkörner, im Buntsandstein dagegen Sporen.
Die Gliederung des Bandes folgt nach den methodischen Kapiteln
weitgehend regionalen Kriterien, wobei vor allem die in den einzelnen
Regionen jeweils bevorzugten stratigraphischen Gliederungsprinzipien
eine Rolle spielen. Dabei ist es unvermeidlich, dass die lokalen
Gegebenheiten immer wieder in die großräumigen Zusammenhänge
eingepasst werden müssen; das führt im gesamten Band notwendig auch zu
Redundanzen, bis hin zu einigen wiederholt gedruckten Abbildungen und
Tabellen.
Ein großer Vorteil des Bandes ist es, dass man darin auch regional
über die Vorkommen in Deutschland hinausgeht. Man erfährt etwas über
die Buntsandstein- Gebiete in Polen, deren Steuerung durch die
Tornquist-Tesseyre Zone und den Graben des Mittelpolnischen Beckens SW
der Osteuropäischen Tafel und den dort bereits stärkeren Einfluss der
Tethys-Verbindung erfolgt. Die Grenze Buntsandstein/Muschelkalk liegt
in Polen tiefer als in Deutschland, weil sie von der Transgression des
Tethysmeers gesteuert ist.
Der Blick richtet sich aber auch nach Dänemark und nach Westen, wo
über Luxemburg hinaus in die Niederlande, nach Belgien und Frankreich
einzelne Beiträge dann eine fast gesamteuropäische Sicht eröffnen.
Forschungsgeschichte: Schließlich ist es erfreulich, dass man sich in
einem solchen, von einer Fülle an Details beherrschten Großband auch
auf die Vorväter besonnen und ihnen von Abraham Gottlob Werner und
GeorgChristian Füchsel bis zu Ferdinand Trusheim 20 Seiten gewidmet
und deren Porträts abgebildet hat, darunter auch das von Heinz Boigk,
den Urvater der Sohlbankzyklen, die wir heute Folgen/Formationen
nennen.
Man sollte nun annehmen, dass dieser state of- the-art-report den
Buntsandstein in allen seinen Facetten erschöpfend behandelt
hätte. Zum Glück für kommende Forschergenerationen bleibt aber off
ensichtlich selbst regionalgeologisch (z. B. die Iberische Halbinsel)
noch immer Raum, diese auch ästhetisch ansprechenden Gesteinsfolgen
weiterhin zu studieren.
Offensichtlich hat eine Vielzahl von Sponsoren dazu beigetragen, dass
der Band auch ansprechend ausgestattet werden konnte: Es gibt
Farbabbildungen, was besonders einigen der paläogeographischen
Übersichtskarten und Profi le zu Gute kommt, und es gibt einige
Falttafeln, deren Detailreichtum sich in einem kleineren Maßstab so
nicht hätte darstellen lassen. Der Band bietet ohne Zweifel die länger
schon fällige Grundlage für weitere Arbeiten auch für die regionale
Geologie der mitteleuropäischen Trias. Der Verkaufspreis ist mit €
109,– zwar hoch, wegen der vorzüglichen Ausstattung jedoch angemessen.
Peter Rothe, Mannheim
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II Jg. 2015 Heft 1/2