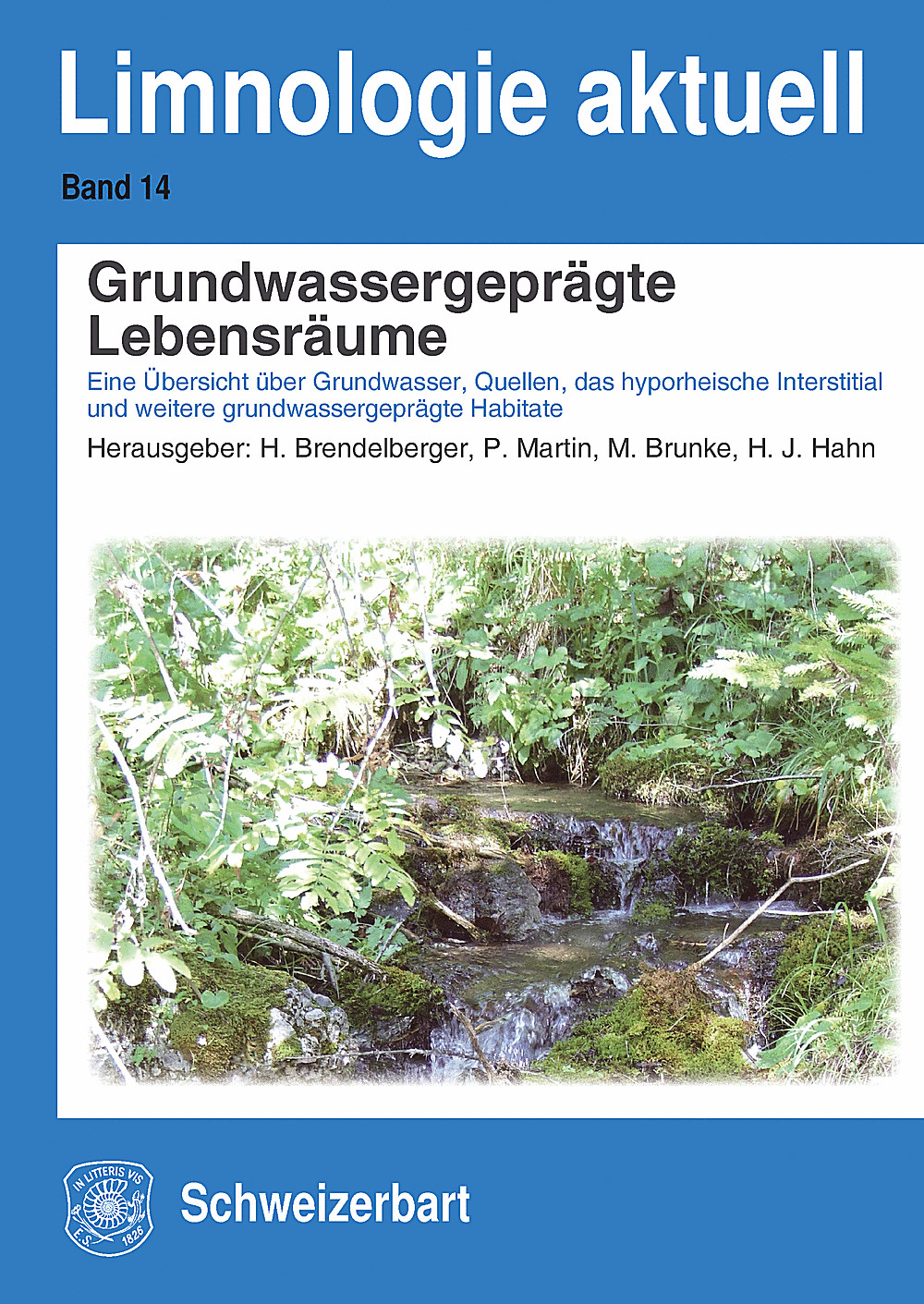Grundwassergeprägte Lebensräume entziehen sich weitgehend der
Bearbeitung durch interessierte Laien, da oftmals ein großer
apparativer Aufwand betrieben werden muss, um sich dem Lebensraum
anzunähern und sich die verborgenen Welten des Grundwassers zu
erschließen. Diese Schnittstelle zu den oberirdischen Lebensräumen
zeichnet sich durch ein intensive biologische Aktivität und
biogeochemische Umsetzung aus und weist nicht zuletzt einen großen
Artenreichtum auf (der taxonomisch allerdings oft sehr schwer zu
fassen ist). Grundwassergeprägte Habitate erfüllen zudem wichtige
Ökosystem-Dienstleistungen: Sie liefern unser Trinkwasser, bieten
Retentionsraum für Hochwässer und dienen als CO2-Speicher. Am ehesten
besteht die Möglichkeit sich im Bereich von Quellen dem Lebensraum zu
nähern. Hier werden z. T. Grundwasserbewohner wie Höhlenflohkrebse
(Niphargus sp.) oder Brunnenschnecken (Bythiospeum sp.) ans Tageslicht
gespült.
Das Buch gliedert sich in insgesamt vier übergeordnete Kapitel. Die
ersten 38 Seiten widmen sich dem Grundwasser: Strukturen, Prozesse und
Funktionen. In den Unterkapiteln geht es um Abiotik und Stoffumsätze,
die Mikrobiologie des Grundwassers, die Metazoen-Fauna des
Grundwassers und die Techniken zur Erfassung der Meiofauna im
Grundwasser sowie in Wasserwerken und Trinkwasserverteilungen. Der am
Buch beteiligte Autor Hans-Jürgen Hahn vom Institut für
Umweltwissenschaften der Universität Koblenz – Landau, Arbeitsgruppe
Grundwasserökologie, Spezialist für die Grundwasserfauna und die
jeweiligen Erfassungsmethoden, steuert hier sein Wissen zu dem Buch
bei. Leider sind die Texte recht allgemein gehalten, so dass wenige
Informationen mit Regionalbezug (z. B. faunistische Daten) gewonnen
werden können.
Kapitel 2 befasst sich, auf etwas mehr als 80 Seiten, mit den
Quellen. Aspekten des Naturschutzes wird hier relativ viel Raum
eingeräumt und auf die Problematik, dass Quellbereiche in der
aktuellen Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie nicht
berücksichtigt werden verwiesen. Da der ökologische Zustand nicht
bewertet werden muss, sind weder das Verbesserungsgebot noch das
Verschlechterungsverbot juristisch relevant. Aufgrund der meist sehr
geringen Größe von Quellen werden sie auch im klassischen Naturschutz
häufig „übersehen“.
Kapitel 3 widmet sich dem für den Laien vielleicht unbekanntesten
grundwassergeprägten Lebensraum: Unter der Überschrift Das
hyporheische Interstitial von Fließgewässern: Strukturen, Prozesse und
Funktionen werden, ebenfalls auf etwas mehr als 80 Seiten, die
Lückensysteme der Sohlensedimente von Fließgewässern vorgestellt.
Diese stehen in einem hydrologischen Austausch zum Oberflächenwasser
und häufig auch zum anliegenden Grundwasser.
Kapitel 4 behandelt auf etwas mehr als 40 Seiten Sonderhabitate. Hier
werden Flussauen, Gießen und Brunnenwasser, Qualmwassertümpel,
grundwassergeprägte Tieflandbäche, Niedermoore, Seen – Grundwasser –
Ökotone (+ Grundquellen in Seen), Baggerseen und binnenländische
Salzquellen vorgestellt. Jedes dieser Habitate hätte auch Thema für
ein eigenes Buch sein können.
Die vorliegende Abhandlung ist, wie bereits im Titel
angekündigt, als Übersichtswerk zum Thema gedacht.
Der Schreibstil ist sehr wissenschaftlich. Die zum Teil
ausufernde Zahl von Zitaten, das Kapitel zum hyporheischen
Interstitial umfasst alleine 20 Seiten Literatur,
lädt nicht unbedingt zum Lesen ein, man „stolpert“
von einer zitierten Untersuchung zur nächsten, ohne
dass die Zusammenhänge immer klar erkennbar sind.
Letztlich bietet dieser Band 14 von Limnologie aktuell
aber einen sehr guten Einstieg zur vertiefenden Beschäftigung
mit der Thematik und vermittelt einen umfassenden
Überblick über die unterschiedlichen Fragestellungen
und Forschungsansätze in Mitteleuropa.
Carsten Renker
Mainzer naturwissenschaftliches Archiv 53 (2016)