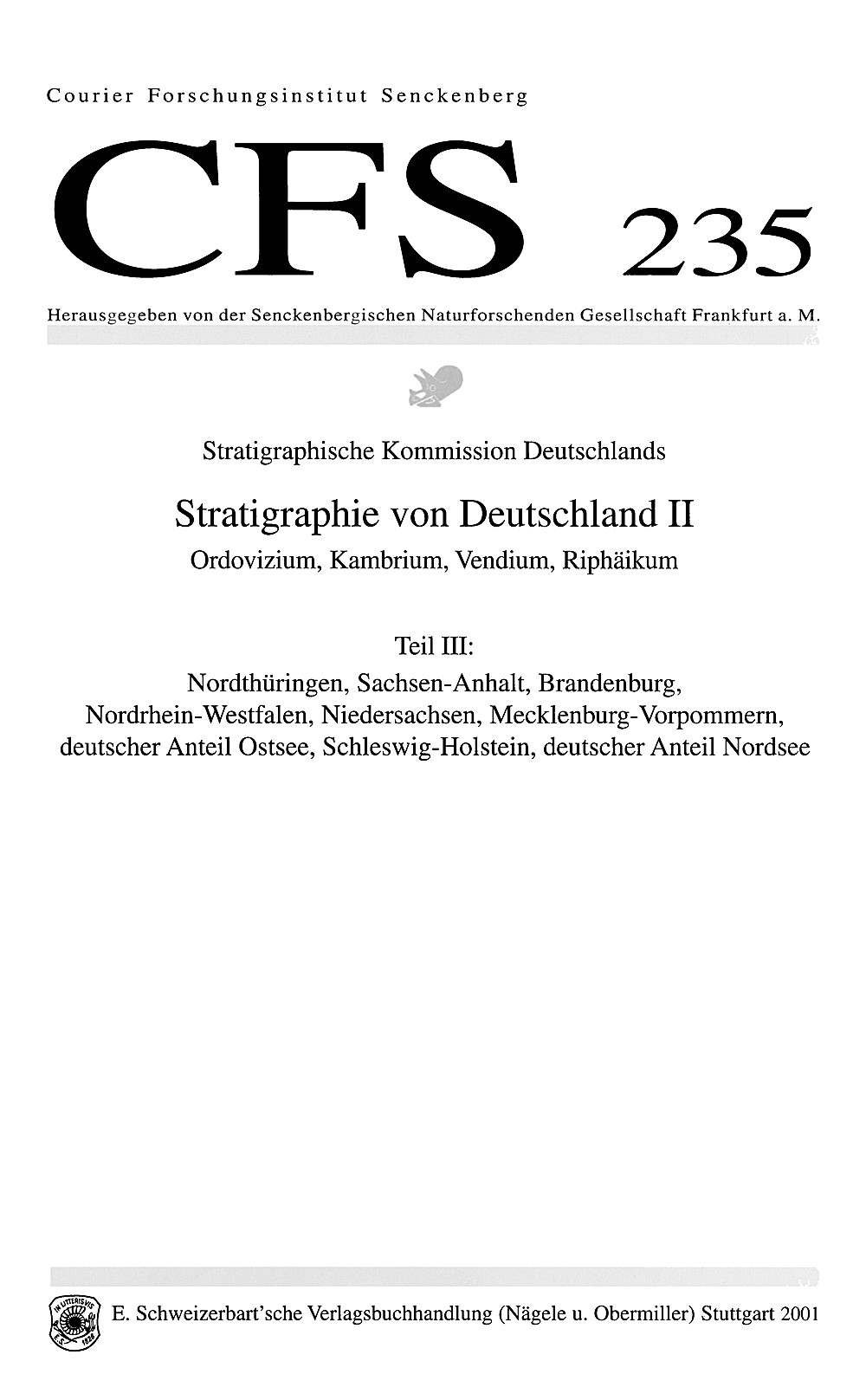Viele Jahrzehnte lang war für westdeutsche Stratigraphen mit dem Silur
das untere Ende der Zeittafel ihres Landes erreicht. Für alles Altere
gab es nur den lithostratigraphischen Vergleich und radiometrische
Datierungen magmattscher und metamorpher Ereignisse. Paläontologisch
datiertes Silur, Ordoviz oder Kambrium war auf wenige Einzelvorkommen
beschränkt und interessierte in der Regel nur die Spezialisten.
Das änderte sich, als 1990 das Thüringische Schiefergebirge und das
Sächsische Grundgebirge mit ihren schon klassischen altpaläozoischen
Schichtprofilen wieder allgemein zugänglich wurden. Schlagartig wuchs
das Interesse, das dort vorhandene lithostratigraphische und
biostratigraphische Know How in einen Vergleich des Silur und Präsilur
ganz Deutsch lands einzubringen. Unter dem Dach der Deut schen
Stratigraphischen Kommission wurde 1991 die Subkommission
Riphäikum-Silur gegründet, die als erstes ein regional gegliederte.
"Glossar" für alle räumlich weit verstreuten präsilurischen Bildungen
Deutschlands erarbeiten sollte. Kernstück sollten angesichts der oft
fehlenden biostratigraphischen Daten ausführliche Charakteristiken der
jeweils erschlossenen lithostratigraphischen Einheiten (Gruppen,
Formationen) sein. Wo bewährte stratigraphische Schemata fehlten,
sollten aus dem lithologischen Vergleich und aufgrund vorliegender
radiometrischer Altersdaten durchaus auch neue Einstufungen und
Gliederungen erarbeitet werden. Ein erster, bereits 1997 als Teil I
erschienener Band war den ausgedehnten und stratigraphisch auch wohl
am besten bekannten Vorkommen in Thüringen, Sachsen und Ostbayern
gewidmet. Als zweiter Teil sind jetzt zwei weitere Bände (Teil II und
III) erschienen: Teil II für das südwestliche und mittlere Deutschland
und Teil III für das westliche und nördliche Deutschland. In den
meisten dieser Regionen sind vorsilurische Bildungen jedoch
weitflächig von jüngeren Bildungen verdeckt und höchstens in
isolierten Grundgebirgsaufbrüchen oder - vor allem im Norden
Deutschlands - in einzelnen Bohrungen der direkten Beobachtung
zugänglich.
Beide Teilbände sind einheitlich gegliedert. Nach einigen
einleitenden Bemerkungen zur Entwicklung der heute vorgenommenen
stratigraphischen Gliederung des "präsilurischen Gebirges" und
Hinweisen zur Zielsetzung und zum Zustandekommen des Glossars folgt -
nach Einzelgebieten getrennt - die systematische lithologische und
fazielle Beschreibung aller heute dem Ordovizium, Kambrium, Vendium
oder Riphäikum zugeordneten Einheiten jeweils vom besser bekannten
Hangenden (Ordoviz) zum gewöhnlich unsicherer zuzuordnenden
Liegenden. Im Teil II werden als regionale Einheiten abgehandelt der
Schwarzwald. das Fundament der Süddeutschen Scholle, der Odenwald,
Spessart und Rhön, der Pfälzer Wald und die Haardt, Hunsrück und
Taunus, die Lindener Mark bei Gießen, das Ruhlaer Kristallin, der
Untergrund des Thüringer Beckens und östlich anschließende Teile der
Mitteldeutschen Kristallinzone und ihres Vorlandes. Im Teil III geht
es um die Nördliche Phyllitzone im Harz und ihre nordöstliche
Fortsetzung bis Frankfurt an der Oder. Es geht weiter um das
KamUroordoviz des linksrheinischen Stavelot-Venn-Massivs und die
Vorkommen von Altpaläozoikum im rechtsrheinischen Schiefergebirge und
im Harz sowie - besonders bemerkenswert in diesem Teilband - um die
Zusammenführung aller einschlägigen Daten aus den zahlreichen
Bohrungen Norddeutschlands und der deutschen Anteile der Nord- und
Ostsee, die das präsilurische Fundament der Norddeutschen Senke
erreicht haben. Für jede reginalgeologische Einheit werden die
Grundlagen der stratigraphischen Gliederung kurz skizziert. Dann folgt
jeweils die Beschreibung der einzelnen stratigraphischen Einheiten
nach immer dem gleichen Muster: Erforschungsund Namensgeschichte,
Lithologie, Verbreitung, Grenzen, Mächtigkeit, Fazies und
Sedimentationsbedingungen, Fossilführung, radiochronologische Daten
usw. Auch das regionalgeologische Umfeld wird mit Angaben zur
Deformation und Metamorphose beschrieben sowie durch Literaturhinweise
erhellt. Am Ende der beiden Glossar-Bände finden sich jeweils
Regionen-übergreifende Korrelationstabellen für das gesamte Präsilur,
u.a. auch mit den notwendigen Hinweisen auf noch bestehende
Unklarheiten oder Kontroversen bezüglich der Alterseinstufungen und
offenen Fragen.
Eine inhaltliche Zusammenfassung des präsilurischen Inventars der in
beiden Teilbänden beschriebenen Regionaleinheiten verbietet sich
natürlich an dieser Stelle. Nicht ohne Grund hatte die Kommission auf
die Darstellungsform einer für die jüngeren Systeme - Silur bis
Tertiär - ins Auge gefaßten Monographie verzichtet. Die räumlichen
Abstände der Aufschlußgebiete und die Verschiedenheit der
lithologischen Ausprägung ihrer Profile sind zu groß. Und nicht
zuletzt ist auch in vielen Fällen die altersmäßige Zuordnung ihrer
Gesteinsfolgen noch zu unsicher. Beide Teilbände stellen also keine
übergreifende Synopse des Präsilurs in Deutschland dar. Ihr großer
Wert offenbart sich vielmehr im exakt dokumentierten Detail.
In einer Zeit, in der eine hochspezialisierte stratigraphische
Forschung selbst bei fachnahen Geowissenschaftlern nur noch als Mittel
zum Zweck Anerkennung findet und erdgeschichtlich orientierte
Feldarbeit vor Ort zunehmend abgelöst wird von Versuchen eher pauschal
übergreifender Modellbildungen - in einer solchen Zeit stellt eine
Dokumentation wie die hier vorgelegte Bestandsaufnahme des Ordovizium,
KamUrium, Vendium und Riphäikum in Deutschland mehr dar als nur eine
wertvolle Erinnerung an ein in über 150 Jahren erworbenes gediegenes
stratigraphisches Wissen. Sie ist eine unverzichtbare Datenbank für
jede weitere Erforschung des tieferen geologischen Untergrunds
Mitteleuropas.
ROLAND WALTER, Aachen
Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. 153, Heft 1, 2002