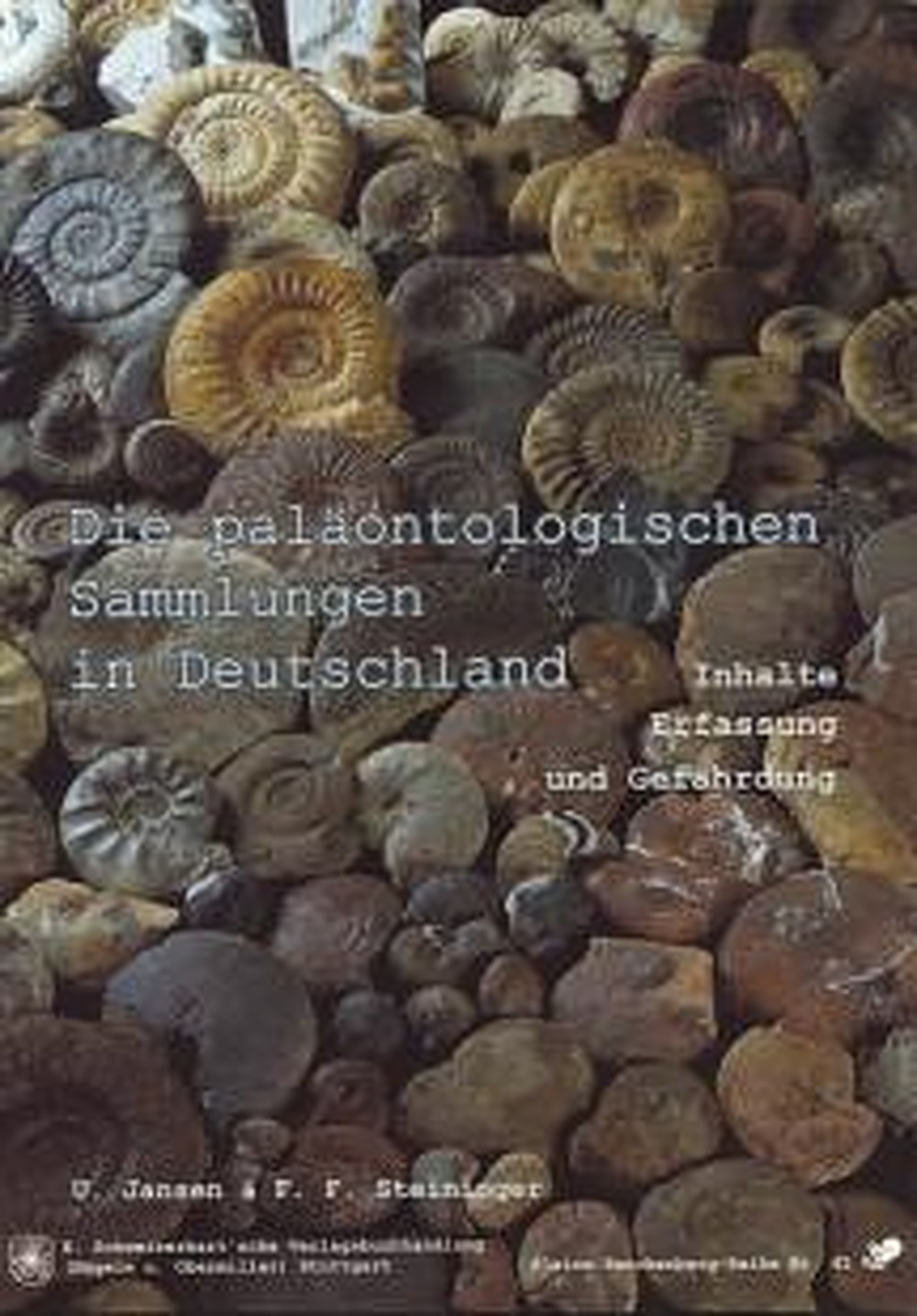Regelmäßig geformte Objekte haben von jeher die Neugier des Menschen
gefordert. Sie haben dazu geführt, diese Objekte aufzuheben, näher zu
betrachten, gegebenenfalls aufzubewahren und vielleicht auch für
bestimmte Zwecke zu nutzen, sei es als Amulett oder aufgrund des
ästhetischen Erscheinungsbildes als Schmuckstück, als
Meditationsobjekt und vielleicht auch als Gebrauchsgegenstand. Auch
und gerade Fossilien sind regelmäßig gestaltete Objekte; sie heben
sich somit von der Umgebung ab, ziehen die Blicke auf sich, zwingen
den Finder sich damit in irgendeiner Form auseinander zu setzen,
vordergründig oder danach trachtend, Zusammenhänge zu ergründen. Dies
ist seit frühester Zeit der Menschheitsentwicklung zu beobachten,
u. a. auch aus dem Grunde, weil der Finder die Objekte seinem Hab und
Gut zuführte und eine Überlieferung in die heutige Zeit damit möglich
machte.
Mit zunehmender Kulturentwicklung entstanden erste Sammlungen, die
nicht nur als Kuriositäten-Bewahrung fungierten, sondern durchaus auch
verstärkter geistiger Auseinandersetzung Grundlagen boten. Damit
wurden die Objekte dieser Sammlungen aber auch wichtige Belege für die
abgeleiteten Interpretationen und besonderer Obhut bedürftig,
erforderten sachgerechte Erfassung und Katalogisierung sowie
gesicherte Aufbewahrung an geeigneten Orten, beispielsweise in
Museen. Dies gilt in besonderem Maße auch für paläontologisches
Fundgut.
In einer Zeit, in der sich in nur kurzer Zeit unser Weltbild
grundlegend gewandelt hat, der Mensch aus der "Unwissenheit"
heraustrat in die Welt der "exakten Wissenschaft", erfuhr er auch sein
eigenes Dasein als eine Kontinuität des Lebens seit seinem Ursprung -
dessen Zeugen die Paläontologie geborgen, erforscht und in Sammlungen
als wichtige Beweisstücke, als unersetzliche Dokumente, hinterlegt
hat.
Die Komplexität unserer Welt und unseres Daseins lässt sich allein
verstehen aus dem Werdegang der Materie, der Entstehung des Alls und
der Erde und der Stellung letzterer im Wechselspiel des Sonnensystems,
aber auch aus dem Werdegang unseres Heimatplaneten selbst, seiner
diversen "Gemütsäußerungen", Wechselwirkungen, die zu ergründen eine
Vielzahl von Disziplinen bemüht ist, die aber ohne die Zeitzeugen,
Gesteine und Fossilien, kaum zu entschlüsseln sind. Geowissenschaften,
und damit vor allem auch die Paläontologie, nehmen somit eine
Schlüsselstellungen ein, und "Kaum eine der Disziplinen der
Geowissenschaften kommt heute noch ohne die Paläontologie und damit
ohne entsprechende Forschungssammlungen aus".
Somit gebührt entsprechenden Sammlungen auch der Status, Bestandteil
des Kulturerbes der Menschheit zu sein - wie dies in verschiedenen
Vereinbarungen nationaler wie internationaler Organisationen klar
postuliert wurde [durch die geistige Auseinandersetzung mit den
Objekten der Natur werden diese eo ipso zum Kulturgut!]. Dies setzt
dann aber auch voraus, dass nicht nur die Objekte, sondern auch die
Sammlungen selbst erfasst und nutzbar gemacht werden - nicht allein im
Interesse der Wissenschaften, sondern auch im Hinblick auf die
Öffentlichkeit bis hin zu den politischen Gremien. Nur so kann der
besondere Wert der Sammlungen und ihrer Inhalte wirklich in
allgemeinem Bewusstsein verankert werden. Hier darf indessen nicht
unerwähnt bleiben, dass in einer naturwissenschaftlich-technisch
orientierten Gesellschaft naturwissenschaftliche Museen - insbesondere
die kleineren - gegenüber den kulturgeschichtlichen und den
Gesellschafts-relevanten Museen vielfach zurückstehen müssen. Dies
trifft insbesondere kleinere Museen, die in ihrem Bestand bzw. in
ihrer Arbeit real gefährdet sind und teilweise dem Rotstift zum Opfer
fallen bzw. ausgesetzt sind. Gravierende Missstände konnten
hinreichend aufgedeckt werden [Schließungen von Museen
resp. Auflösungen von naturwissenschaftlichen Sammlungen sind
ebenfalls belegbar].
Nach einer ersten Erfassung in "Übersichtskarte der
Geowissenschaftlichen Museen in der Bundesrepublik Deutschland", durch
die Deutsche Geologische Gesellschaft in den siebziger Jahren des
20. Jahrhunderts initiiert und in den "Nachrichten der DGG" [erste
Karte 1977: Heft 16] in mehreren, nach Bundesländern gegliederten
Folgen publiziert, liegt jetzt eine von der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft herausgegebene, umfangreichere und
umfassendere Zusammenstellung vor, die nun auch die neuen Bundesländer
erfasst. Die Zusammenstellung folgt dem Standort in alphabetischer
Reihung.
Die Einleitung ist der Problemstellung und der "Bedeutung
paläontologischer Forschungssammlungen", der Art der Datenerfassung
per Fragebogen sowie auch einem Aufruf zur weiteren Datenübermittlung,
u. a. bisher nicht erfasster Museen, gewidmet. Das Kapitel
"Auswertung" befasst sich mit der Analyse der Sammlungen: "Der
Standorte in Deutschland", "Strukturen der paläontologischen
Sammlungen in Deutschland", "Umfang der paläontologischen Sammlungen
und ihre Verteilung auf Standorte", "Gravierende Defizite an den
Standorten der paläontologischen Sammlungen", "Zugänglichkeit der
paläontologischen Sammlungen", "Erfassungsstand der Sammlungen" sowie
"Paläontologische Sammlungen im Internet". Alle diese Themen sind
durch Graphiken bildlich erläutert, die derzeitige Situation der
Museen und ihre gravierenden Probleme klar vor Augen führend.
"Gesamtbetrachtung und Ausblick" ist eine eindringliche Mahnung, oder
- aus eigener Anschauung und Erfahrung - vielleicht doch eher als eine
(An)klage zu betrachten. Naturwissenschaftliche Sammlungen/Museen sind
noch immer Stiefkinder der Museumsentwicklung in unserer
naturwissenschaftlich-technisch geprägten Gesellschaft.
Die jeweiligen Institutionen sind durch Anschrift [inkl. eventuell
vorhandener E-Mail und Internet-Adresse] sowie hier dann durch
"hausspezifische" Angaben zur generellen Situation der Sammlungen und
deren Betreuung, zu Inhalten, Umfang und Erfassung [Inventarbücher,
-listen, Karteikarten, aber auch bereits EDV-Erfassung]
charakterisiert. Besonderheiten, wie Sammlungsschwerpunkte und
thematische Ausrichtungen sowie Personen bezogene Sammlungen werden
hervorgehoben, ebenso wie die Art der Aufstellung. Nicht zu vergessen
sind die Hinweise auf Defizite der Sammlungen: vorwiegend Raumnot und
Personalmangel. Ausdruck der allgemein defizitären Situation -
Personal- wie Finanzsituation - ist zweifellos die in seltensten
Fällen gegebene Internet-Verfügbarkeit der Sammlungen (nur 5,9%
erfasst; 78,2 % nicht erfasst, 16 % keine Angaben). Hier einen
Zusammenhang zwischen unvollständigen Angaben zum Bestand zu
übersehen, dürfte mehr als schwer fallen.
Eine wahre Fundgrube ist neben den Daten zu den Sammlungen das
Schriftenverzeichnis, finden sich doch hier viele hoch interessante
Publikationen zu den Sammlungen oder Teilen derselben, regional oder
international, zur Geologie und Paläontologie der betreffenden
Regionen bzw. überregionaler Gebiete, zur Stratigraphie und
Systematik, zur historischen Entwicklung der Sammlungen u. a. m., eine
Liste kleiner und großer "Raritäten".
Was ist nun Ziel und Zweck und wer sind die Zielgruppen, mit denen
dieser Band angesprochen werden soll? Die erste Frage wurde bereits
angeschnitten und beantwortet. Ziel und Zweck ist die Erfassung
unwiederbringlichen Kulturgutes [auch wenn dies immer wieder in Frage
gestellt wird: Fossilien werden zum Kulturgut dadurch, dass sich der
Mensch geistig mit ihnen auseinander setzt]. Darüber hinaus dient
diese Zusammenstellung auch der Erfassung der Diversität des Lebens
auf der Erde gemäß Systematics Agenda 2000. - Zu den Zielgruppen
zählen zweifellos und aus vielschichtigen Gründen in erster Linie die
Museen selbst, ebenso wie Forschungsinstitute, auch wenn in beiden
Fällen hinreichende Verknüpfungen bestehen. Als eine weitere wichtige
Zielgruppe sollten die zahlreichen ernst zu nehmenden Privat-Forscher
betrachtet werden. Diese tragen erheblich zum Forschritt
paläontologischer Forschung bei und sollten nicht unterschätzt
werden. Eingedenk der sinkenden Stellenzahl für hauptamtliche
Paläontologen können und werden sie in Zukunft nicht unerheblich an
der Forschung beteiligt sein. Und nicht zuletzt, eher vordringlich
richtet sich der Band an Verwaltungen und Politiker: Dazu sei hier
wörtlich zitiert:
".... Öffentliche Zuwendungsgeber sind dazu aufgerufen, der
unhaltbaren Situation vieler Standorte entgegenzuwirken. Die
Wissenschaftspolitik und die öffentlichen Zuwendungsgeber werden auch
dringend dazu aufgefordert, die Rolle von Museen, Forschungsinstituten
und universitären Einrichtungen im Hinblick auf die Betreuung und
Verfügungshaltungen von Sammlungen grundlegend zu überdenken und neu
zu strukturieren".
Finanzielle, technische und personelle Hilfen sind essentiell - oder
dient der Terminus "Weltkulturerbe" nur als Zierde auf dem politischen
Revers?
K. OEKENTORP
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II Jahrgang 2003 Heft 1-2