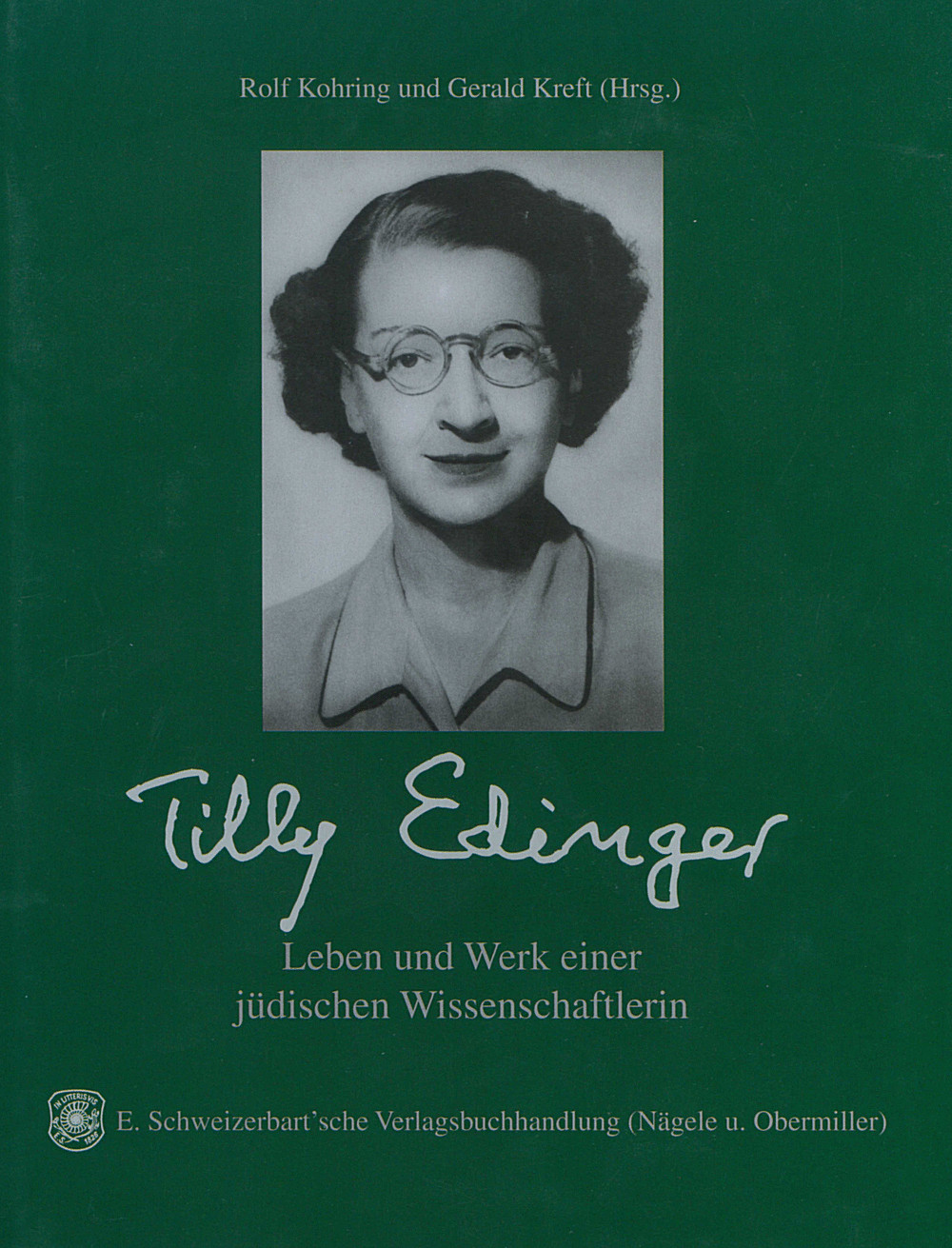ROLF KOHRING und GERALD KREFT legen als Herausgeber einen stattlichen,
sorgfältig erstellten Band als Senckenberg-Buch vor. Er ist der Person
und dem Lebenswerk der jüdischen Wissenschaftlerin TILLY EDINGER
gewidmet, einer der ersten studierten und promovierten deutschen
Paläontologinnen, zugleich auch profilierteste Erforscherin einer
neuen, durch sie wesentlich begründeten Disziplin der Paläontologie.
Das 70-jährige Leben TILLY EDINGERs ist in der Tat reich an
bemerkenswerten Ereignissen: Zu Beginn ein wissenschaftlicher
Entdeckungsweg, dessen frühe Neigungen und Prägungen durch die Person
des Vaters noch in die Zeit des deutschen Kaiserreiches führen, in der
an Jahren kurzen Phase der Weimarer Republik dann Tillys erster, schon
weit ausholender wissenschaftlicher Höhenflug, scheinbar unbeeinflusst
durch die politische Radikalisierung der Zeit. Die 1933 beginnende
massive Entrechtung und Ausgrenzung der jüdischen Bürger zwingt sie
zunächst zu einem würdelosen Dasein als versteckte
"Untergrund-Kuratorin". Der wachsenden Gefahr der Deportation und
Ermordung entgeht sie nur sehr knapp und in letzter Sekunde,
ausgeplündert und fast mittellos. Unter persönlichen Entbehrungen und
Hintanstellungen gelingt ihr aber in einer bemerkenswert
undogmatisch-kollegialen Atmosphäre einer freieren und kreativeren
Wissenschaftstradition in den Vereinigten Staaten von Amerika ein
bemerkenswerter Neustart, dem diesmal - anders als im alten Europa -
potente Förderer und Berater zur Seite stehen. Nach dem Krieg, der in
Europa alles in Schutt und Asche legte, beweist sie, die sich nur
schwer und wohl niemals ganz von ihren Ursprüngen lösen konnte, trotz
einer kleinlich-würdelosen Verzögerung ihres Wiedergutmachungsantrages
durch deutsche Behörden menschliche Größe in der Wegbahnung
deutsch-amerikanischer Wissenschaftskontakte.
Vier insgesamt kurze Geleitworte (von DIETRICH STARCK, HARRY
J. JERISON, STEPHEN JAY GOULD und REINER WIEHL) stehen vor einer
kurzen, fünfseitigen Einführung (R. KOHRING & G. KREFT). Von 5
Hauptkapiteln sind 3 in englischer Sprache. Am umfangreichsten sind
diejenigen von R. KOHRING ( Tilly Edinger - Stationen ihres Lebens)
sowie G. KREFT ( Tilly Edinger im Kontext ihrer deutsch-jüdischen
Familiengeschichte) mit 277 bzw. 223 Seiten, gefolgt von E. BUCHHOLTZ'
Darstellung ( Tilly Edinger: Scientific legacy) mit 59 Seiten,
H. LANGS Kapitel ( Tilly Edinger's Deafness) mit 13 Seiten sowie
E. BUCHHOLTZ' Beitrag ( Teaching Interlude: Tilly Edinger at Wellesley
College) mit 10 Seiten. Danach folgt noch ein Anhang von 17 Seiten
Umfang (tabellarischer Lebenslauf; Schriften von TILLY EDINGER;
Radiobeiträge; Gutachten über TILLY EDINGER). Ein Personenindex sowie
ein Index der wissenschaftlichen Namen stehen am Schluss des Buches.
R. KOHRING gelingt es, TILLY EDINGERs Lebensstationen unter
Zuhilfenahme eines bemerkenswert dichten, zusätzlich erläuternden und
erläuterten Briefbestandes (insbesondere ihren Briefwechsel im
Freundes- und Kollegenkreis) lebendig und anschaulich werden zu
lassen. Bei aller Ausführlichkeit ist dieser Text keineswegs
langatmig, im Gegenteil! Wer über TILLY EDINGERs Person hinaus etwas
erfahren möchte über die frühe, erst kurz zuvor in der
Paläontologischen Gesellschaft organisatorisch zusammengefasste
Paläontologie, ihre bis dahin fast ausschließlich männlichen Vertreter
und die Möglichkeiten einer Frau, hier zu bestehen, lasse sich
fesseln. Dabei begibt sich R. KOHRING gelegentlich - wie auch die
anderen Autoren - auf durchaus unterschiedlich, jedenfalls nicht immer
eindeutig interpretierbares Gebiet, gerade dann, wenn es um die
verheerende Einflussnahme einer gezielt destruktiven vor Ausgrenzung
und letztlich massenhaftem Mord nicht zurückschreckenden Politik geht
(1933- 1945). Deren Perspektiven und Folgen wurden in den Jahren
1933-1938 (der Zeit von TILLY EDINGERs Ausharren in Deutschland) zwar
zunehmend deutlich, waren jedoch den von ihr betroffenen Akteuren
dieser Biographie - und gerade auch TILLY EDINGER selbst - keineswegs
so einsichtig, wie uns das heute, aus großer zeitlicher Distanz
beurteilt, erscheinen mag. Wie problematisch Bewertungen sein können,
selbst dann, wenn sie viele Jahrzehnte nach dem Ableben der
beurteilten Personen erfolgen, zeigt exemplarisch gerade das nach der
Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in besondere Spannung
geratene Verhältnis RUDOLF RICHTER - TILLY EDINGER. KOHRING, der in
seiner Darstellung ¸ber die zeiteingebettete Darstellung hinaus in
einem speziellen Kapitel noch einmal auf dieses Verhältnis zu sprechen
kommt, zieht hier neben zeitgenössischen Äußerungen auch
nachträgliche, gleichwohl ausgewogene Urteile heran (zu R. RICHTER
z. B. KLAUSEWITZ, RIETSCHEL, STRUVE, ZIEGLER) und tut hier zweifellos
sein Bestes. Wo der Autor nicht eindeutig (ver)urteilen darf, ist doch
dem Leser eine Möglichkeit eingeräumt, dies nach Ansicht der
dargelegten Fakten und Meinungen zu tun.
KOHRINGs dichte, abschnittweise beklemmend deutliche Darstellung
zeigt, wie nach 1933 die noch zunächst schützenden Hände von der
Person TILLY EDINGER zunehmend abgezogen wurden, wie ihr Demütigungen
und Ausgrenzungen selbst im engsten Kreis ihrer paläontologischen
Kollegen wie auch der Paläontologischen Gesellschaft nicht erspart
blieben. Repressalien im äußeren Lebenskreis traten hinzu. Wer die
zunehmende Entrechtung der jüdischen Menschen im Deutschland der
dreißiger Jahre noch exemplarischer, noch drastischer nachvollziehen
möchte, als es durch TILLY EDINGERs Briefe und Stellungnahmen möglich
ist, möge zu VIKTOR KLEMPERERs bestürzend einsichtigem Jahrhundertwerk
(Ich will Zeugnis ablegen bis zum letz- ten. Tagebücher 1932-1945;
Berlin 1995) greifen. Zur zunehmenden Entrechtung trat, in den späten
dreißiger Jahren, die Gefahr für ihr Leben. Bereits 1934 bemerkt TILLY
EDINGER in einem Brief: (...) es ist doch nicht zu verwundern, wenn
unsereins etwas Verfolgungswahn hat (...) Etwas Verfolgungswahn!
Unwillkürlich wird der Leser hier an RUTH KLÜGERs Erinnerungen denken
( Weiter leben. Eine Jugend; Göttingen 1992; ein ähnliches "deutsch"
und amerikanisch geprägtes Lebensschicksal übrigens). Dort ist
gleichfalls von Verfolgungswahn die Rede, im Vernichtungslager
Auschwitz, und RUTH KLÜGER, die ihn bei ihrer mitdeportierten Mutter
feststellt, urteilt dahingehend, dass dieser und die damit verbundene
psychische Störung im Lager eher von Vorteil war, weil die neue
gesellschaftliche (Un)ordnung dergleichen Wahnvorstellungen eingeholt
hatte [Wie knapp TILLY EDINGER der Ermordung entging, zeigen die im
Beitrag von G. KREFT gestreiften grausamen Schicksale ihres Bruders
und ihrer Kusine]. Zur Ausgrenzung trat die Beraubung. Wenngleich
TILLY EDINGER der - bemerkenswerten und wohl richtigen - Auffassung
gewesen ist "So oder so werden mich (...) die fossilen Wirbeltiere
retten" bedurfte doch diese Rettung in letzter Sekunde eines ganz
ungewöhnlichen Einsatzes englischer und amerikanischer
Kollegen. KOHRING macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, wie
wenig man den Exodus der deutschsprachigen Paläontologen "danach",
nach ihrem Hinauswurf, später beachtete: Bekannte, große Namen sind
darunter, deren Weggang heute kaum erwähnt wird, wenn man vom
Bedeutungsverlust deutschsprachiger Paläontologie spricht.
KOHRING nennt die Verstrickung deutschsprachiger Paläontologen in das
nationalsozialistische System - so heikel und wenig einfach es nach
des Verfassers eigenen Worten auch ist, hier zu urteilen. Eine offene
Auseinandersetzung darüber gab es im Nachkriegsdeutschland jedenfalls
nicht. Insoweit reflektiert die deutsche Paläontologie der
Nachkriegs-Jahrzehnte bemerkenswert getreu die
gesamtgesellschaftliche, ganz überwiegend durch Verdrängung
gekennzeichnete Reaktion. So viel Rettendes, soviel Neuanfang und
Neuorientierung TILLY EDINGER in den USA auch erwartete: Die
Emigration hinterließ im Leben dieser so tief sozialisierten
Frankfurterin und der deutschen Paläontologie engstens verbundenen
Forscherin einen tiefen, nicht wieder verheilten Bruch. Erfreulich,
dass die Autoren an keiner Stelle des Buches versuchen, diese
Gegebenheit in der Darstellung zu schmälern. Zu "vereinnahmen" ist
TILLY EDINGER nicht mehr, so sehr auch einige wenige nach ihrem Tode
erschienene deutschsprachige Artikel und Nachrufe dies versucht haben.
Obwohl der vorliegende Band ein im wesentlichen biographisches Werk
ist, möchte der Rezensent dem mit TILLY EDINGERs Lebenshintergrund und
wissenschaftlichem Werk weniger vertrauten Leser das in der Mitte des
Buches liegende Kapitel von EMILY A. BUCHHOLTZ (TILLY EDINGER:
Scientific legacy) als "Einstieg" empfehlen. Es führt sehr rasch in
die Bedeutung TILLY EDINGERS als Paläontologin und Begründerin der
neuen Subdisziplin Paläoneurologie ein, beginnend mit der Prägung der
Tochter durch den Vater LUDWIG EDINGER bereits im Elternhaus,
überleitend zu EDINGERs Nothosaurus-Dissertation, deren Publikation
bereits zum Nukleus späterer, breiter und grundlegender Beschäftigung
mit dem paläoneurologischen Material wurde. Folgend werden dann die
wichtigen Stationen in ihrer in vieler Hinsicht bemerkenswerten
Karriere genannt. Sicher sehr zu Recht kennzeichnet BUCHHOLTZ TILLY
EDINGERs frühe wissenschaftliche Selbstfindung als einen Akt der
Selbsterziehung. Das liest sich gut, weil BUCHHOLTZ TILLY EDINGER wie
auch ihre wissenschaftlichen Kollegen in zahlreichen Kurzzitaten
selbst zu Wort kommen lässt. Durch das umfangreich dargebotene
biographische Material der vorangehenden und folgenden Beiträge
entfällt hier auch die Notwendigkeit zeitraubender einführender
Erläuterungen. BUCHHOLTZ würdigt TILLY EDINGERs erste zusammenfassende
Veröffentlichung ( Die fossilen Gehirne, 1929) als innovative und
kreative Synthese zweier Felder (Geologie/Neurologie).
Die Darstellung widmet sich den damaligen Problemfeldern der noch
jungen Paläoneurologie in historischer Rückschau und bereits
Kapitelüberschriften thematisieren, was auch TILLY EDINGER
beschäftigte:
Comparative anatomy versus palaeoneurology; Brain size and brain
"Progress"; Brain size and extinction. E. BUCHHOLTZ rekonstruiert
behutsam TILLY EDINGERs frühe Auffassungen des Evolutionsverlaufs
sowie der Beschaffenheit systematischer Großgruppen bei den fossilen
Wirbeltieren und schildert ihr Vorgehen. Zu zahlreichen Hindernissen,
evolutionäre bzw. auch hierarchische Serien der Gehirnentwicklung an
systematisch homogenen Material zu erhalten, traten Differenzen in den
Ergebnissen einerseits paläoneurologischer, andererseits
vergleichend-anatomischer Forschungen. Wie BUCHHOLTZ zeigt,
relativierte TILLY EDINGER ihre zunächst zu optimistischen Erwartungen
an rasche Forschungsfortschritte, blieb aber dicht an den Problemen.
Eines ihrer zuerst bei der Bearbeitung der Sirenen (1933) erreichten
Ziele war die Darstellung des Wandels eines Gehirn-Typs von den
ursprünglichen fossilen bis zu den rezenten Arten einer Gruppe. In
diesem Zusammenhang würdigt BUCHHOLTZ TILLY EDINGERs klassische
Pferde-Monographie (1948), die ein beeindruckendes sequentielles Bild
der Gehirn-Innovationen innerhalb einer einzigen Evolutionslinie
vorlegt, wobei sie nicht verschweigt, welche grundsätzlichen
Einsichten in die Evolution dieser und anderer Gruppen TILLY EDINGER
noch nicht zu Gebote standen. Auch EDINGERs Einsichten in ihrerzeit
kaum zutreffend beobachtetes Evolutionsgeschehen, etwa des non
correlated progress sowie der wiederholten Parallelentwicklung von
Furchungsmustern des Gehirns, Phänomene, die sie noch länger
beschäftigen sollten, werden besprochen. Sehr früh schon hatte sich
TILLY EDINGER auch die Frage gestellt, in welchem Ausmaß evolutionärer
Fortschritt und Größenzunahme des Gehirns identisch sind. Sie wurde
hier von Publikationen ihres Vaters wie auch solchen von O. C. MARSH
beeinflusst, wenn gleich sie gerade zu MARSH bald sehr gegensätzliche
Positionen einnehmen sollte. Kontinuierlichen evolutionären
Fortschritt der Gehirnentwicklung konnte TILLY EDINGER gerade bei den
von ihr früh untersuchten Säugetier-Großgruppen nicht feststellen. Es
nahmen aber auch, wie E. BUCHHOLTZ zeigt, zeitgenössische methodi-
sche Schwierigkeiten bei der Abschätzung der Gehirngröße von rezenten
und fossilen Wirbeltieren Einfluss auf TILLY EDINGERs
Forschungsansatz. Das demonstriert sehr eindringlich das Beispiel der
in TILLY EDINGERs späteren Jahren geführten Gehirngröße versus
Körpergröße- Debatte, zu deren vertiefter quantiativer Diskussion
TILLY EDINGER durch Nichtvertrautheit mit quantitativen Techniken
letztendlich nicht beitragen konnte.
Wenngleich die Beiträge von HARRY LANG über TILLY EDINGERs Taubheit
und von EMILY BUCHHOLTZ über TILLY EDINGERs Lehr-Zwischenspiel am
Wellesley College (1944/45) kurz sind, so geben sie doch
aufschlussreiche Einblicke in die Fähigkeit der Forscherin, mit einer
schweren körperlichen Behinderung umzugehen und trotz dieses auch im
Kreise der neuen amerikanischen Kollegen isolierenden "Handicaps" in
einem aus finanzieller Not eingegangenen Lehrverhältnisses
überraschend erfolgreich zu sein. LANG versucht auch auszuloten, ob
neben der zweifellos gegebenen Isolation durch das Gebrechen nicht
letztlich daraus auch positive Auswirkungen auf TILLY EDINGERs
Schaffensprozess abzuleiten sind. E. BUCHHOLTZ registriert, dass die
durchaus bemerkenswerten Fähigkeiten der bescheidenen und
selbstkritisch-humorvollen Lehrerin TILLY EDINGER gute Resonanz auf
zuvor nicht erprobtem Feld fanden. Insoweit kann die Schwerhörigkeit
nicht entscheidend hindernd gewirkt haben. Die starke Einbindung TILLY
EDINGERs in redaktionell-bibliographische wie auch eigene
Forschungsprojekte ließ es zu einer Fortsetzung des Lehrintermezzos
nicht mehr kommen.
G. KREFT berichtet, in geistes- bzw. sozialwissenschaftlicher
Tradition stehend, über TILLY EDINGER im Kontext ihrer
deutsch-jüdischen Familiengeschichte. Der umfangreiche Beitrag ergänzt
die Ergebnisse der anderen Autoren (und umgekehrt) und ist auch so
konzipiert, was heißt, dass inhaltliche Ü berschneidungen - wie die
Autoren selbst bemerken - sinnvollerweise nicht zu vermeiden waren,
aber durch den jeweils abweichenden Hintergrund der Fragestellung auch
nicht ermüden. Mam machte hier glücklicherweise nicht den Versuch,
unterschiedliche Interpretationen - zu denen ein reiches biografisches
Material recht unterschiedlicher Herkunft einlädt - einander
anzugleichen. Dadurch bleibt das beim Leser ankommende, aus zahllosen
Facetten zusammengesetzte Bild dieser keineswegs einfach zu fassenden,
komplexen Pers nlichkeit sehr differenziert.
Wie KREFT einleitend ausführt, kann es eine historisch unbelastete
Herangehensweise an das gewählte Thema kaum geben. So war auch hier
zunächst eine Klärung der Begriffe vorzunehmen, und in den erreichten
terminologischen Differenzierungen gelingt es ihm, TILLY EDINGER
sowohl in der Geschichte ihrer Familienbindungen unter vielfältiger
Rückspiegelung auf den kollektiven kulturellen "Erfahrungshorizontì
deutscher Juden darzustellen. Vielfältige Bezüge zur deutschen
Gesellschaftsgeschichte ergeben sich dabei von selbst. Der Autor
beleuchtet in seinem Beitrag das "rückblickend gebrochene"
Selbstverständnis der Emigrantin und leitet über zu einer Erörterung
des Einflusses ihrer Familiengeschichte auf ihre akademische
Ausbildung. Weitere umfangreiche Daten stellen "Informelles zur
Begrün- dung der Paläoneurologie". Folgerichtig deutet man TILLY
EDINGERs komplizierte Ablösung aus dem nationalsozialistischen
Deutschland als Ergebnis erfolgreicher Akkulturation, die so fast zur
Falle wurde. Abschließend und ergänzend bespricht der Verf. die
Bedingungen der erneuten amerikanischen Einkulturation TILLY
EDINGERs. Im Schwerpunkt der Darstellung erhellt der Verf., was nicht
zu verwundern ist, gravierende Unterschiede der deutschen und
amerikanischen Wissenschaftsgesellschaft immer wieder
streiflichtartig.
Der Verfasser machte sich die Arbeit zu diesem Kapitel alles andere
als leicht. Seine wie auch R. KOHRINGs Ergebnisse beruhen auf einer
Auswertung von annähernd 1.000 Briefen und Postkarten TILLY EDINGERs
aus dem Zeitraum 1916-1967, zu denen zahlreiche biographisch
auswertbare, gedruckte Beiträge der Forscherin kommen, abgesehen von
weiteren Quellen. Der Beitrag von KOHRING weist 968, der Beitrag von
KREFT 1.086 Querverweise auf! Erfreulicherweise widerstanden dabei die
genannten Verfasser der Versuchung, ihre Beiträge durch diesen
Anmerkungsapparat unleserlich zu machen (gemäß einer fragwürdigen
geisteswissenschaftlichen Maxime, wonach das Wichtigere generell in
den Anmerkungen stehe) - nein, das wichtigste steht hier, im ganzen
Buch, in den gut gegliederten, mit griffigen berschriften
ausgestatteten Texten; der rote Faden geht dem Leser trotz der
dargebotenen Fälle nicht verloren. Zahlreiche gut platzierte
Abbildungen fördern die Lust, nachzuschlagen.
Der interdisziplinäre Ansatz des Buches ist geglückt; Natur- wie auch
Kulturwissenschaftler und auch interessierte Laien werden sehr von
dieser Biographie profitieren, die mit der gewählten Themenkombination
fast konkurrenzlos dasteht. Aber es ist vor allem die großartige Frau
und Forscherin TILLY EDINGER, zu deren Weg, Schicksal und Leistung wir
jetzt breitesten Zugang besitzen.
T. KELLER
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II, Jg. 2005, H. 1-2, S. 185-190