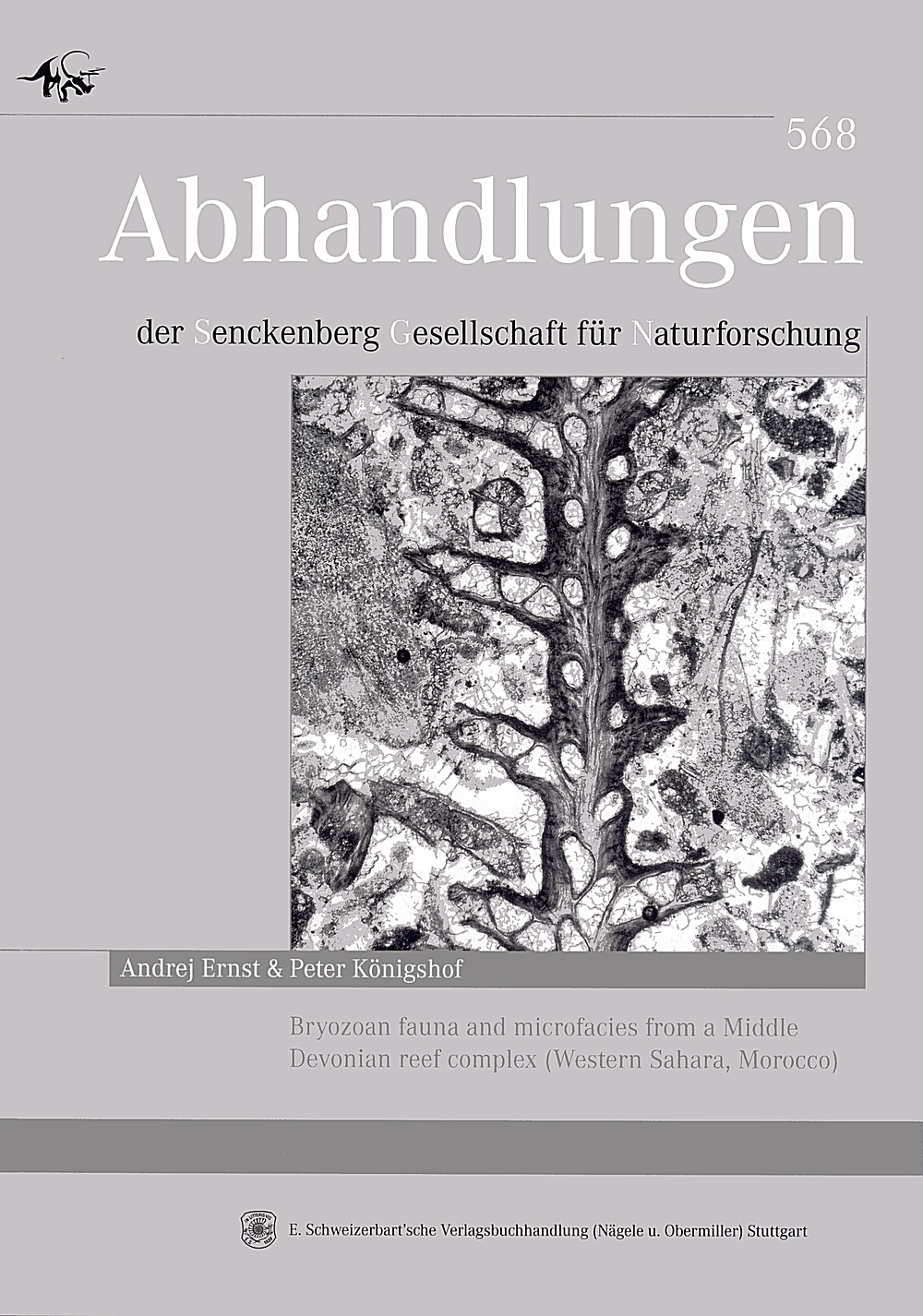Die Verf. beschreiben in der vorliegenden Arbeit die Bryozoen-Fauna
des mitteldevonischen Sabkhat-Lafayrina-Riffkomplexes in der von
Marokko besetzten West-Sahara. Bryozoen sind in verschiedenen Teilen
des Riffkomplexes sehr häufig. Sie fingen das Sediment ein und
stabilisierten es. Insgesamt sind 26 Bryozoen-Arten, darunter zwei
neue Genera (Lenapora n. gen., Dissotrypa n. gen.)
nachgewiesen. Die 17 neuen Arten sind Lenapora pulchra
n. gen. et n. sp. (Typusart), Dissotrypa sincera n. gen. et
n. sp. (Typusart), Fistuliphragma parva n. sp.,
Sulcoretepora moderata n. sp., Leioclema crassiparietum
n. sp., Eridotrypella minutiformis n. sp., E. modesta
n. sp., Atactotoechus gaetulus n. sp., Acanthostictoporella
angusta n. sp., Euspilopora spinigera n. sp.,
Acanthoclema triangularis n. sp., Rhombopora minutula
n. sp., Prolixicella lata n. sp., Rhombocladia striata
n. sp., Filites gaetulus n. sp., Anastomopora clara
n. sp. und A. recta n. sp.
Der Teil des Buches über die Bryozoen (die Kapitel „Taxonomic
descriptions“, „Systematic palaeontology“, „Appendix“ und die 27
Tafeln) ist vorbildlich: Alle Arten sind klar beschrieben und
vorzüglich abgebildet. Außerdem werden auf S. 7-8 die
paläobiogeographischen Beziehungen der Bryozoen-Fauna beschrieben. Es
ist etwas schade, dass man hier keine Vergleiche mit den publizierten
Daten zu anderen Riffbildner-Gruppen in der West-Sahara und Marokko
anstellte. Die Arbeiten von SCHRÖDER & KAZMIERCZAK (1999), PEDDER
(1999) und COENAUBERT (2005) über rugose Korallen und von MAY (2008)
über tabulate Korallen zeigen durchgängig enge Beziehungen zum
altweltlichen Faunenreich (insbesondere Europa, aber auch Asien) und
nur untergeordnete Beziehungen zum ostamerikanischen Faunenreich. Die
in der vorliegenden Arbeit beschriebene Bryozoen-Fauna zeigt genau
dieselben Verteilungsmuster.
Der große Wert der vorliegenden Arbeit ist nicht nur, dass es eine der
ersten Arbeiten über die devonischen Bryozoen Nord-Afrikas ist,
sondern auch, dass es ein sehr wichtiger Baustein in der aktuellen
Forschung von ANDREJ ERNST ist, der sich zum Ziel gesetzt hat, einen
der beschämendsten Weißen Flecken in der Paläontologie des Devon
anzugehen: die Bryozoen Europas und angrenzender Gebiete (ERNST
2008–2011, ERNST & BOHATÝ 2009, ERNST et al. 2011, ERNST & HERBIG
2010, ERNST & KÖNIGSHOF 2008, ERNST et al. 2009, ERNST & MAY 2009,
ERNST & MAY 2011, im Druck, ERNST & MOHAMMADI 2009, ERNST & RODRÍGUEZ
2010, ERNST & SCHRÖDER 2007, TOLOKONNIKOVA & ERNST 2010). Alle diese
Veröffentlichungen bilden zusammen eine Art „Meta-Monographie“, denn
sie sind eng miteinander verwoben und von überregionaler Bedeutung,
wie z. B. die Arbeit von ERNST & RODRÍGUEZ (2010) dokumentiert, in der
sie aus Spanien eine Bryozoen-Fauna beschrieben, die verblüffend enge
Beziehungen zur vorliegenden Fauna der West-Sahara besitzt.
Demgegenüber ist der stratigraphisch-fazielle Teil des Buches (die
Kapitel „Geological setting“ und „Microfacies analysis“) nicht so
herausragend: Von einer Mikrofazies-Analyse erwartet der Rez. mehr,
als hier geboten wird: Obwohl die Autoren mehrere hundert Dünnschliffe
erstellen (S. 4), beschreiben sie weder die Mikrofazies-Typen
systematisch, noch bilden sie sie umfassend ab (nur die 5 Farbfotos
der Fig. 3a–3d und Fig. 4 sind der Mikrofazies gewidmet). Die
Beschreibung der (stratigraphischen) Abfolge der Mikrofazies-Typen und
die mikrofazielle Interpretation (S. 7) gehen über einige generelle
Ausführungen nicht hinaus. Man unternimmt auch nicht den geringste
Versuch, diesen Riffkomplex mit zeitgleichen Riffkomplexen in anderen
Teilen der Welt zu vergleichen. So kommt es, dass einige Fragen, die
dem kundigen Leser auf der Zunge brennen, weder gestellt, geschweige
denn beantwortet werden. Ein Beispiel ist die Frage, warum in diesem
Riffkomplex Bryozoen eine derartig herausragende Rolle spielen,
während in den meisten givetisch-frasnischen Riffkomplexen Bryozoen
mehr oder weniger selten sind. Zum Beispiel sind im
givetisch-frasnischen Massenkalk des Sauerlandes Bryozoen sehr selten
(MAY 1988: 180–181). Eine andere interessante Frage ist, welches
Riff-Modell den Sabkhat-Lafayrina-Riffkomplex angemessen beschreibt:
das „klassische“ Modell, in dem der „Riffkern“ eine echte Barriere
darstellt, oder das von MAY (1987: 71; 1997: 131–133, Abb. 2; 2003:
62–63, Abb. 4) für den Massenkalk des Sauerlandes entwickelte Modell,
in dem der „Riffkern“ keine Barriere ist, sondern nur den obersten
Teil des beckenwärts gerichteten Abhanges der Karbonat-Plattform
bildet.
Noch enttäuschender sind die Angaben zur Stratigraphie: Zwar
unterscheiden sie in Fig. 2 vier lithostratigraphische Einheiten (Part
A-D) und markieren zwei bryozoenreiche Horizonte, aber bei der
biostratigraphischen Einstufung und der Beschreibung der Bryozoen
nehmen sie keinerlei Bezug mehr auf diese lithostratigraphischen
Einheiten und Horizonte. Deshalb weiß der Leser weder, ob es
irgendwelche Unterschiede in der (stratigraphischen) Verteilung der
Bryozoen gibt, noch ob die untersuchte Karbonatsequenz vielleicht
verschiedene chronostratigraphische Einheiten enthält.
Die in der vorliegenden Arbeit präsentierten Daten zur
Biostratigraphie dokumentieren anschaulich die fatalen Konsequenzen
einer Praxis, die sich ausschließlich auf Conodonten beschränkt und
die Makrofossilien ignoriert. Wie üblich für devonische Riffkomplexe,
ist die Conodonten-Fauna sehr arm und wenig aussagekräftig (S. 4). Aus
den Conodonten leiten sie ohne detaillierte Begründung ein
Givetium-Alter ab. Als einziges weiteres biostratigraphisches Datum
führen sie das Auftreten von Heliolites porosus an (S. 4, hier
fälschlich Heliolithes) und leiten daraus eine Einstufung als
„Late Givetian“ ab. Weder bilden sie den Heliolites porosus ab,
noch geben sie diagnostisch relevante Informationen über ihr Material
oder eine Referenz auf eine publizierte Beschreibung dieser Art, die
für ihre Bestimmung maßgeblich gewesen wäre. Deshalb ist es nicht
gesichert, dass sie einen echten Heliolites porosus (GOLDFUSS,
1826) gesehen haben. Des weiteren ist nicht klar, wie sie dazu kommen,
dieser Art Leitwert für das Ober-Givetium zuzuschreiben, da sie keinen
Literaturhinweis anführen. IVEN (1980: 163–172) und BIRENHEIDE (1985:
40–42) geben übereinstimmend als stratigraphische Reichweite von
Heliolites porosus tota species das gesamte Mittel-Devon an. Während
BIRENHEIDE (1985: 41) die Nominatsubspezies auf das Ober-Givetium
beschränkt, fand IVEN (1980: 167–168) Heliolites porosus
porosus (GOLDFUSS, 1826) im Ober-Eifelium!
Nach Ansicht des Rez. wäre es ein Leichtes gewesen, unter Benutzung
der Arbeiten von SCHRÖDER & KAZMIERCZAK (1999), PEDDER (1999),
COENAUBERT (2005) und MAY (2008) aus den Korallen mehr
biostratigraphisch relevante Informationen herauszuholen. Darüber
hinaus hätte KÖNIGSHOF auf die von BIRENHEIDE und STRUVE am selben
Forschungsinstitut Senckenberg zusammengetragenen Informationen über
Korallen und Brachiopoden zurückgreifen können. Da in der vorliegenden
Arbeit keine rugosen Korallen abgebildet sind, kann der Rez. nur auf
folgende Angaben (S. 3-5) zurückgreifen: Neben häufiger
Phillipsastrea kommen Heliolites und Mesophyllum
vor. Diese Kombination spricht in der Tat für Ober-Givetium, da
Heliolites und Mesophyllum am Ende des Givetium
verschwinden und Phillipsastrea vor dem Ober-Givetium nur
vereinzelt auftritt (siehe BIRENHEIDE 1978, 1985; MCLEAN 1993). Trotz
der Schwächen des stratigraphisch-faziellen Teiles ist das Buch eine
herausragende Arbeit, und Generationen von Bryozoen-Experten werden
den Autoren dafür dankbar sein.
ANDREAS MAY, Madrid
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II, 2011, Heft 3-4