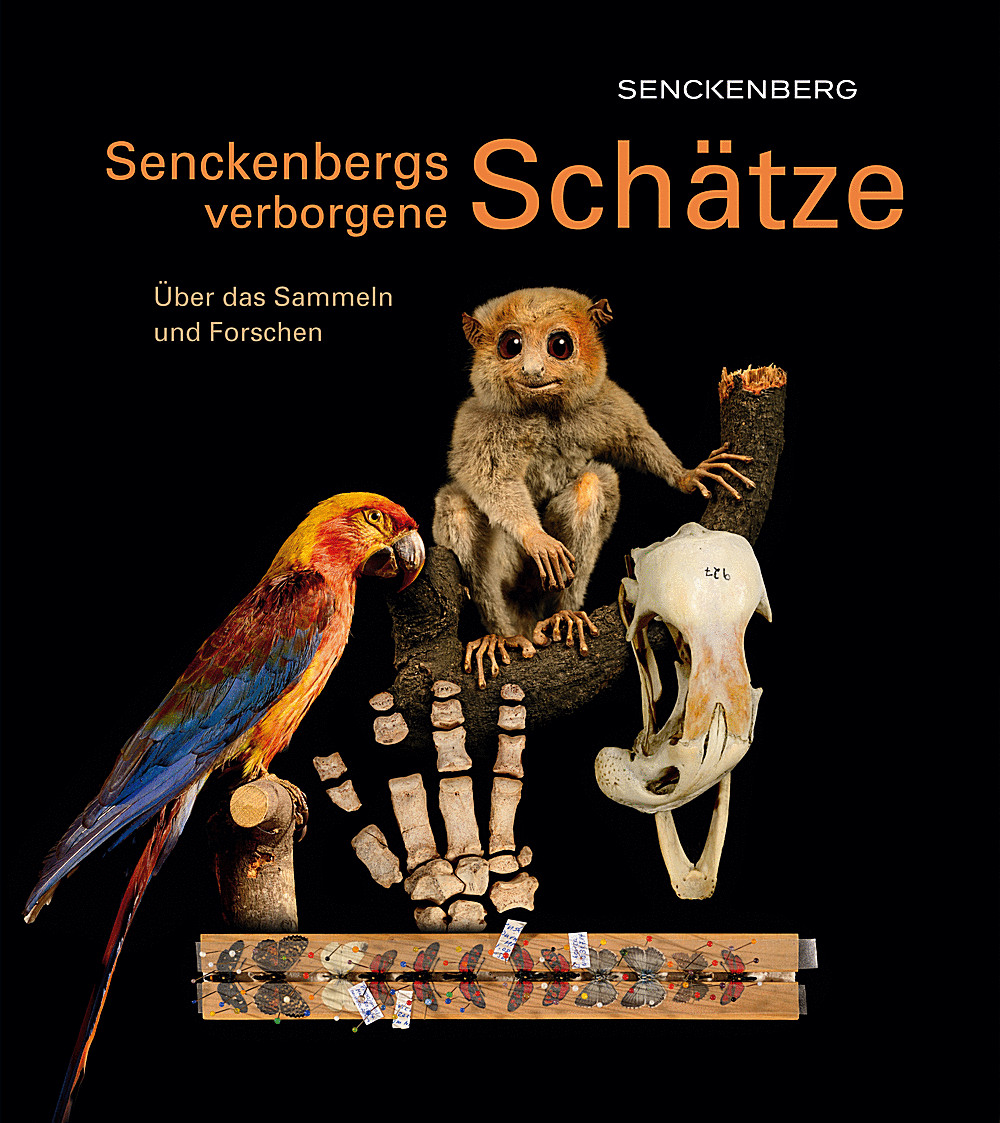
Senckenbergs verborgene Schätze
Über das Sammeln und Forschen
Hrsg.: Sabine Mahr; Thorolf Müller; Birgit Walker
2015. 136 Seiten, 1 Abbildung, 101 Fotos, durchgehend farbig, 22x20cm, 610 g
Language: Deutsch
(Kleine Senckenberg-Reihe, Band 56)
ISBN 978-3-510-61405-9, brosch., price: 14.90 €
in stock and ready to ship
Keywords
Museum • Wissenschaftliche Sammlung • Entwicklungsgeschichte • Artenvielfalt
Contents
- ↓ Inhaltsbeschreibung
- ↓ Bespr.: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2
- ↓ Inhaltsverzeichnis
Bespr.: Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2 top ↑
Im vorliegenden Band geht es gleich ein zweites Mal um die
„Verborgenen Schätze der Museen“. Auch der Katalog zu den Münchner
Mineralientagen 2016 nahm sich des Themas an (Keilmann et al. 2016,
Ref. 009). Weil Museen in neuester Zeit häufig für ihre Träger zu
teuer oder einfach lästig werden, schloss man manche von
ihnen. Beispiele sind das Fuhlrott-Museum in Wuppertal, das
Mineralogische Museum und das Geologische Museum der Universität
Münster in Westfalen seit 2007, wobei man das letztere zwar seit
Jahren wiedereröffnen will, aber wann, ist bis heute nicht
ersichtlich. Seitdem (2007) wird um die Finanzierung gestritten.
Deshalb stehen die meisten Museen unter großem Rechtfertigungsdruck
für ihr Dasein und müssen diesem Druck u. a. durch entsprechende
(Werbe)Schriften für die Öffentlichkeit entgegenwirken (z. B. das
Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart mit seinem alljährlichen
Rechenschaftsbericht; Kovar-Eder & Schmid 2016, Ref. 027). Bei der
Senckenberg Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main liegt
der Fall anders: Sie übernahm z. T. große und bekannte
Museumssammlungen von solchen Museen als „Zweigstellen“ in ihre
Betreuung, die ihren Trägern lästig/zu teuer wurden und die man
ansonsten vermutlich aufgelöst hätte (Dresden, Tübingen, Görlitz,
Müncheberg und Weimar). Darauf kommt der Direktor der Gesellschaft im
Vorwort vorliegenden Werkes gleich zu sprechen, und im letzten Kapitel
sind die Außenstellen daher vorgestellt. Dieser Band entstand
anlässlich der Ausstellung „Senckenbergs verborgene Schätze“ (2016) im
Senckenberg-Museum in Frankfurt am Main als Ausstellungskatalog, ohne
dass aber irgendwo (Impressum, Titelseite) darauf hingewiesen wird.
Das Senckenberg-Museum eröffnete bereits 1821 und erhielt als umfangreichen Grundstock seiner Sammlungen die naturwissenschaftlichen
Bestände von Wilhelm Peter Eduard Rüffell (1794–1884), wie man in Von
Sammlern und Sammlungen erfährt. Mit Sammeln bei Senckenberg setzt man
den Leser weiterhin in Kenntnis über das Warum, wie und was wird
gesammelt. Selbstverständlich gibt es dazu 17 Geschichten vom Sammeln
zu einzelnen, besonderen, ausgewählten Objekten aus historischer Zeit,
darunter auch drei fossile. In Wissenschaft und Sammlungen geht man
auf die Maßstäbe, Präparation, das DNS-Labor (hier fälschlich
DNA-Labor genannt), die kleinste Senckenberg-Sammlung
(Dinoflagellaten), die botanische Präparation und die geologische
Präparation und deren jeweiligem Personal ein, bei der Präparation
auch auf die Außenstelle Dresden. Die Zukunft der Sammlungen ist
wichtig, um zu wissen, was mit den 38.600.000 Objekten des Senckenberg
(Deutschland: etwa 100.000.000!) derzeit und in der Zukunft
geschieht, so beispielsweise die Datenerfassung/EDV-
Verwaltung. Großes Thema bei den meisten naturwissenschaftlichen
Museen ist heute meist das Schlagwort der Biodiversität (fossil und
rezent), unter dem sich Nichtfachleute nichts vorstellen können. Dann
stellt man Die sammelnden Standorte Senckenbergs vor, die natürlich
nicht selbst sammeln, sondern die darin beschäftigten Museumsleute,
die sich an den Standorten Frankfurt am Main (Senckenberg Naturmuseum
und Forschungsinstitut), Dresden (Senckenberg Naturhistorische
Sammlungen), Görlitz (Senckenberg Museum für Naturkunde), Müncheberg
(Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut), Weimar (Senckenberg
Forschungsstation für Quartärpaläontologie) und dem hier noch nicht
erwähnten Tübingen (Geologisch-paläontologische Sammlungen der
Universität) vier Aufgaben widmen sollen: der 1) Biodiversität und
zoologisch-botanischen Systematik, 2) Biodiversität und Ökosystemen,
3) Biodiversität und Klima, 4) Biodiversität und „Erdsystem-Dynamik“
(gemeint ist damit die Plattentektonik und die Erdgeschichte). Der
Begriff der Biodiversität erscheint dem Leser hier bei Punkt 2)–4)
etwas übertrieben und entbehrlich. Eine Begriffserklärung (Glossar),
Dank und Impressum schließen den Bildband ab.
So erfreulich es für manchen Museumsträger derzeit erscheint, wenn die
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung von der Schließung
bedrohte Naturkundemuseen übernahm, gibt es auch Bedenken, wenn sie
alle von einem Träger abhängen, der selbst eines Tages finanziellen
Kürzungen und deshalb schmerzhaften Sparzwängen unterliegen
könnte. Was jedem Wissenschaftler Bauchschmerzen bereiten muss, ist
die Bildung eines Museums- und Forschungsmonopols, was vielen
Regional- und Universitätsmuseen gar nicht recht sein kann, denn
Senckenberg steht auch für gewisse Vorstellungen, die nicht jedes
andere Museum mittragen kann oder möchte – das ist der Wermutstropfen
an der Sache, den der vorliegende Ausstellungskatalog leider nicht
diskutiert. Denn so ist – wenn die Entwicklung mit Museumschließungen
derart weitergeht – die Vielfalt der deutschen Museumslandschaft und
Forschung zumindest ernsthaft bedroht. Die Vereinigung in einer Hand
kann daher keine Allgemein- oder Dauerlösung sein. Zudem ist das
Senckenberg von seiner Herkunft her eher ein zoologisch- botanisches
Museum, das sich bei den Fossilien nur speziellen Themen wie Messel
oder Urmenschen eingehender widmet, d. h. vor allem den
Wirbeltieren. Das ist auch dem vorliegenden Katalog zu entnehmen, in
dem die Messelgrabungen des Museums zum Bedauern jedes Paläontologen
nicht berücksichtig sind. Messel hätte jedoch ein eigenes Kapitel
verdient gehabt.
Insgesamt stellt das preiswerte und gutgestaltete Werk die Senckenberg
Naturforschende Gesellschaft in günstigem Licht anschaulich der
Öffentlichkeit vor. Allerdings ist in den meisten Kapiteln ein wenig
zu oft vom Sammeln die Rede und das vor allem in den Überschriften –
warum kommt die Forschung hier zu kurz? Ein
Universitätswissenschaftler wie der Rez., der selbst 12 Jahre in drei
verschiedenen Museen arbeitete und durch seine Berufstätigkeit diverse
Museen erlebte, liest die vorliegende Broschüre nämlich durchaus mit
etwas gemischten Gefühlen (siehe Absatz vorher). In einer eventuell
notwendigen zweiten Auflage wäre zudem der Standort Tübingen zu
ergänzen.
Wolfgang Riegraf, Münster in Westf.
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie II, 2017 Heft 1-2
Inhaltsverzeichnis top ↑
19 Sammeln bei Senckenberg
33 Geschichten vom Sammeln
73 Wissenschaft und Sammlungen
111 Die Zukunft der Sammlungen
115 Die sammelnden Standorte Senckenbergs
128 Begriffsammlung
134 Danksagung
136 Impressum