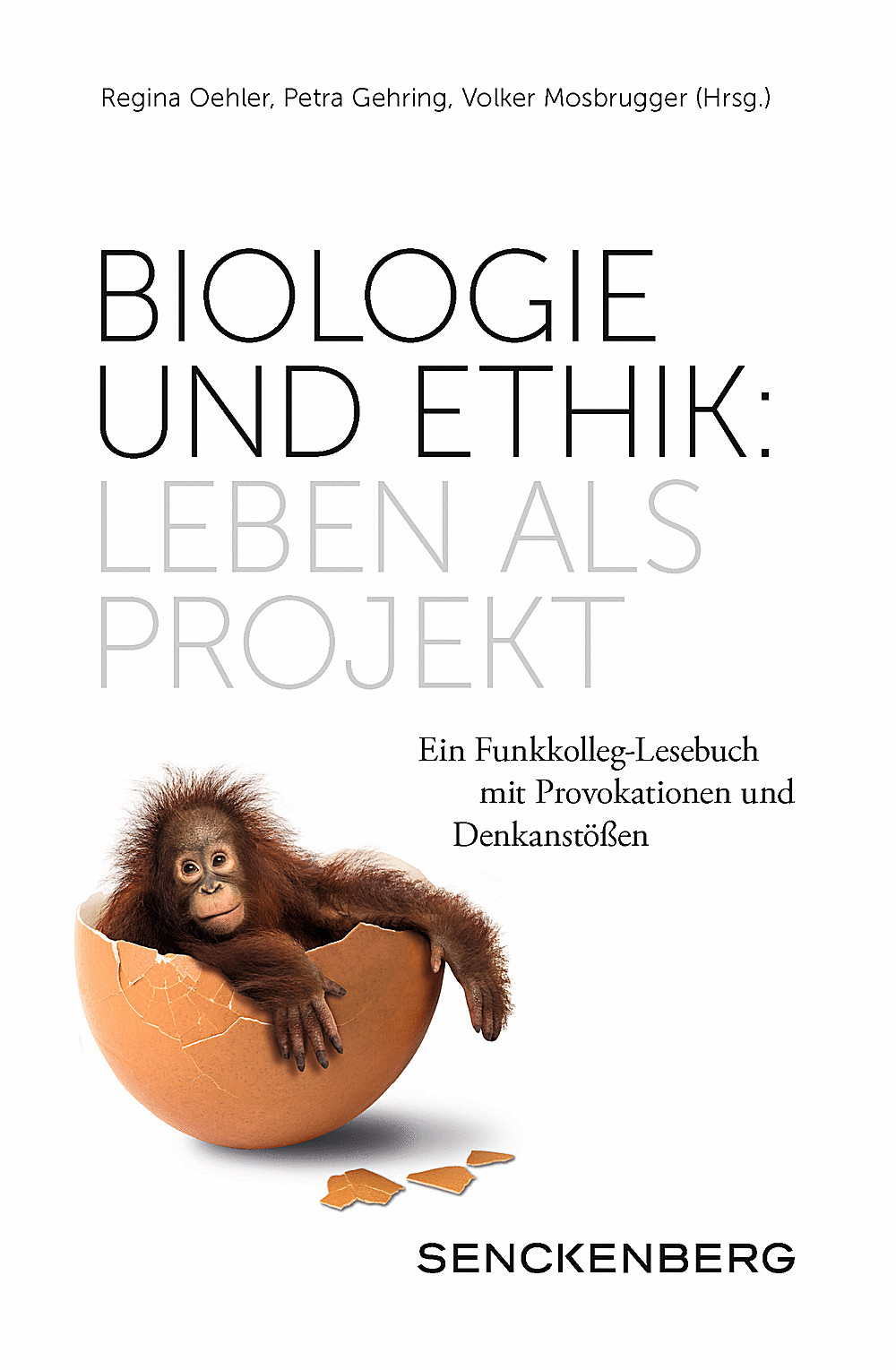Bereits Titel und Untertitel signalisieren, dass es sich hier um ein
Buch handelt, das die Handlungsoptionen der modernen Biologie und die
damit denkbar gewordenen Sichtweisen aufgreift. Leben als „Projekt"
aufzufassen, das bedeutet, die Gestaltungsmöglichkeiten in den
Vordergrund zu stellen und sich nicht dem Gegebenen zu
fügen. Unweigerlich wirft dies Fragen nach dem rechten Handeln auf,
gibt es doch – wie der Biologe Hubert Markl in dem Band hervorhebt –
eine unverkennbare „Neigung des Menschen für Ethik und Moral". Sie
liefert uns zwar keine Normen, hält uns aber dazu an, nach ihnen zu
suchen und unser Leben nach ihnen auszurichten. Die Frage nach dem
„Sollen" klingt denn auch mehr oder weniger explizit in allen
Beiträgen an. Wie die Lebenswissenschaften selbst, so sind die
Sichtweisen, die hier zur Sprache kommen, vielfältig. Neben Biologen
kommen auch Philosophen (u. a. Hans Jonas), Theologen und
Religionsvertreter (Wolfgang Huber, Papst Franziskus), eine
Musikwissenschaftlerin (Melanie Wald-Fuhrmann) und Journalisten
(u. a. Bettina Dyttrich, Florian Schwinn) zu Wort. Um dem polyphonen
Konzert eine Struktur zu geben, haben die Herausgeber des Bandes –
Regina Oehler, Neurobiologin und Wissenschaftsjournalistin, die das
Funkkolleg „Biologie und Ethik" des Hessischen Rundfunks konzipierte,
die Philosophin Petra Gehring von der TU Darmstadt und der Biologe
Volker Mosbrugger, Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für
Naturforschung – die Beiträge um vier Themenblöcke gruppiert: Woher
kommt der Mensch – Wohin geht der Mensch? – Was machen wir mit der
Natur? – Woher nehmen wir unsere Maßstäbe? Die fünf Beiträge des
ersten Themenblocks gehen auf eine interdisziplinäre Vortragsreihe
2016/17 im Senckenberg-Museum zurück, die übrigen wurden aus zum Teil
lange zurück liegenden Publikationen von insgesamt 28 Autoren
ausgewählt und wenn nötig gekürzt. Auch ein für die Öffentlichkeit
verfasstes „White Paper zu Tierversuchen in der
Max-Planck-Gesellschaft" findet sich darunter. Herausgekommen ist ein
echtes Lesebuch, in dem anregende, in sich geschlossene Äußerungen,
Kommentare, essayistische Abhandlungen und knappe Übersichten
versammelt sind, die einen dazu verleiten, zwischen den Texten hin-
und herspringen und Bezüge herzustellen. Stichworte wie Migration und
Mobilität in der Menschheitsgeschichte, Hautfarben und ihre Bedeutung,
Klonen, Genschere CRISPR/Cas, Anthropozän, „Diktat des Machbaren"
versus „Ethik der Besonnenheit", Bioethik in Deutschland,
Biodiversität und Globaler Wandel, Evolution in vier Dimensionen
(Genetik, Epigenetik Verhalten und Symbole), Naturschutz, Tierwohl,
„Naturalismus und Biologie" mögen eine Vorstellung von der Bandbreite
geben. Die Texte sind engagiert geschrieben und werden nicht nur eine
willkommene Ergänzung für die Hörer des Funkkollegs „Biologie und
Ethik" sein. Das Buch dürfte sich hervorragend auch für den
Schulunterricht eignen.
Naturwissenschaftliche Rundschau, 71. Jahrgang, Heft 3, 2018