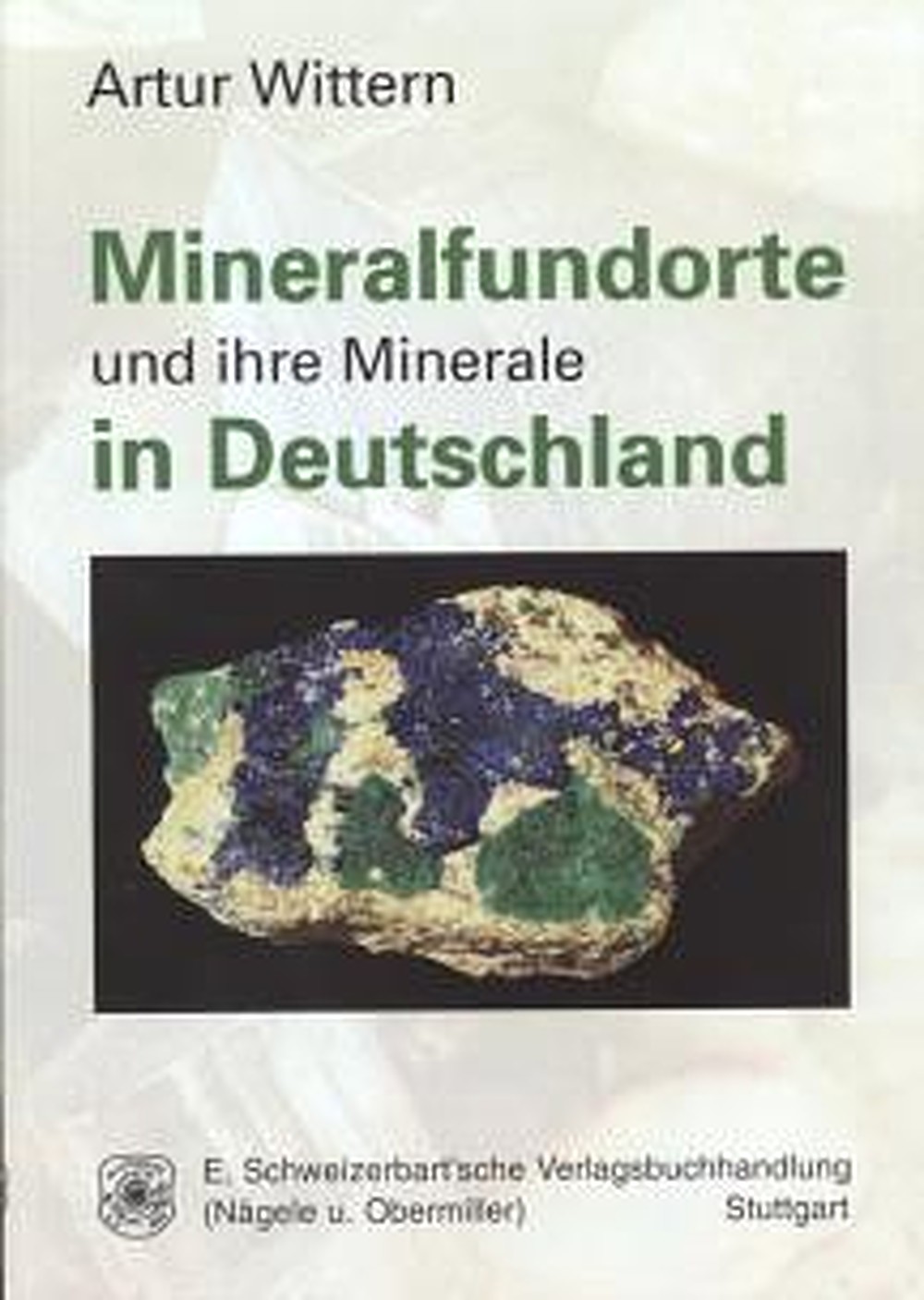Mineralfundorte rückten in den letzten Jahrzehnten auch in den
Blickpunkt von Paläontologen und unter ihnen vor allem der
Paläobotaniker. Unter Fachleuten hat sich längst herumgesprochen, daß
sich beispielsweise fossile Pilze in klaren Quarzen ("Bergkristallen")
bei Rösenbeck und in auffallend gehänderten Chalzedonen
("Eisenkiesel") von Warstein (Steinbruch Risse) in jüngeren
Spaltenfüllungen im mitteldevonischen Massenkalk des nördlichen
Sauerlandes fanden (vergl. M. KRETSCHMAR, Fazies, 7: 237-2G0, Erlangen
1982). Ferner werden solche fossilen Pilze, deren Alter etwa dem der
Mineralisationen entsprechen dürfte, in mit Chalzedon gefüllten
Spalten in unterpermischen Vulkaniten von Langenthal in
Rheinland-Pfalz gefunden. Solche Pilzvorkommen sind meist mit
bestimmten Eisenmineralen vergesellschaftet. Ebenso finden sich in den
Hohlräumen von Fossilien manchmal sehr schön ausgebildete Mineralien
wie Quarz, Pyrit, Markasit, Eisenglanz, Baryt, Coelestin, Strontianit,
Calcit oder Araponit. Auf diese Weise sind Mineralfundstellen häufig
auch Fossilfundpunkte oder umgekehrt.
Der Verf. richtet sich in seinem Buch vor allem an Mineraliensammler,
die eine Spezialsammlung "Minerale in Deutschland" anstreben. Er hat
damit sein im Jahre 1990 erschienenes Taschenbuch "Die
Mineralfundstellen Mitteleuropas, Deutschland Teil 1", das nur
westdeutsche Fundstellen anführt, auf das gesamte Bundesgebiet
ausgedehnt. Bisher existierte kein Nachschlagewerk, das die
wichtigsten Mineralfundorte Deutschlands und die dort vorkommenden
Minerale nennt, einschließlich der Raritäten und der neu beschriebenen
Minerale. Diese Lücke schließt der Verf., indem er knapp, manchmal
aber auch allzu kurz zu fast jeder heute noch zugänglichen
Mineralfundstelle das Wesentliche über Geologie, Bergbaugeschichte und
Mineralisation aufzählt.
Da die Grenzen der einzelnen Bundesländer nur selten mit den
geographisch oder geologisch vorgegebenen Regionen übereinstimmen,
folgt seine Gliederung Deutschlands teils unter politischen, teils
unter geographischen und geologischen Gesichtspunkten. Er teilt
Deutschland von Nord nach Süd und von West nach Ost in 20 Regionen
ein: 1 ) Schleswig-Holstein und Hamburg, 2) Niedersachsen, 3) Harz, 4)
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, 5) Ruhrgebiet und
Bergisches Land, (Öl) Sauerland, Münsterland und Nordhessen, 7)
Sachsen-Anhalt und die angrenzende Oberlausitz, 8) Aachener Revier,
Nordeifel und Vulkaneifel, 9) Siebengebirge und Westerwald, 10)
Siegerland und Lahn-Dill-Gebiet, 11) Thüringen und sächsisches
Vogtland, 12) Sächsisches Granulitgebirge und Erzgebirge, 13)
Hunsrück, Untere Lahn und Taunus, 14) Vogelsberg, Rhön, Spessart und
Franken, 15) Saarland und Pfalz, 16) Odenwald nebst Randgebieten, 17)
Fichtelgebirge und Oberpfalz, 18) Schwarzwald, 19) Kaiserstuhl und
Hegau, und 20) Bayerischer Wald. Durch die inkonsequente - mal
geographisch, mal politische Einteilung - wurden leider
zusammengehörige Gebiete wie z.B. das Saar-Nahe-Becken in mehrere
Kapitel (Kap.13 und 15) zerrissen.
Die einzelnen Kapitel werden nach Fundorten weiter untergliedert,
wobei die Unterkapitelziffern sich auch in den Übersichtszeichnungen
und Spezialzeichnungen der einzelnen Aufschlüsse
wiederfinden. Insgesamt werden 434 Fundorte, vor allem Steinbrüche,
Bergbauhalden, Ton- und Kiesgruben sowie Meeresstrände
beschrieben. Diese Schilderungen umfassen oft nur wenige Zeilen, ab
und zu auch eine ganze Seite. Der Text wird durch Lageskizzen und
Mineralzeichnungen aufgelockert. Die Fundorte lassen sich anhand der
sehr kurzen Wegbeschreibungen finden. Der Leser vermißt jedoch die
entsprechenden Blattkoordinaten (übliche Rechts- und Hochwerte), die
allein ein sicheres Auffinden gewährleisten würden. Rezensentin
bedauert die oberflächliche Abhandlung der Aufschloßverhältnisse im
Raum Idar-Oberstein; auf die Besucherbergwerke Steinkaulenberg und
Fischbach wird überhaupt nicht eingegangen. Im ehemaligen Steinbruch
Setz wird schon lange nicht mehr abgebaut, obgleich Sammler an den
aufgelassenen alten Steinbruchwänden noch eine Vielzahl von Mineralien
zutage fördern.
Auch das Münsterland wird in diesem Buch sehr stiefmütterlich
behandelt. Neben Mineralien wie Turmalin, Epidot, Quarz, Gold und
Bernstein in pleistozänen Geschieben finden sich auch in den großen
Zementsteinbrüchen des Beckumer Gebiets (Krs. Warendorf: Beckum,
Ahlen) oft schöne, sammelwürdige Calcit- und
Strontianitstufen. Zentimetergroße, idiomorphe Bergkristalle treten
öfters im Bereich der Baumberge westlich Münster (Krs. Coesfeld) in
Hohlräumen fossiler Seeigel auf.
Verf. beschreibt als Ausnahme auch einige Fossilfundstellen wie die
Grube Messel, wobei er aber nur die dort vorkommenden Minerale
erwähnt, oder die Saurierfundstelle in Brilon-Nehden (nördliches
Sauerland). Diese wurde aber nicht, wie der Autor schreibt, von der
Universität Münster unter Naturschutz gestellt, sondern vom dafür
zuständigen Amt für Bodendenkmalpflege des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe.
Betrachtet man den Buchumschlag, auf dem das Farbfoto einer Azurit-
und Malachitstufe aus Neubulach/Schwarzwald abgebildet ist, so
blättert man in Erwartung farbiger Mineral- und Aufschlußfotos zuerst
das Buch durch. Zunächst ist man etwas enttäuscht, denn man findet im
Text weder Mineral- noch Aufschlußfotos.
Diese Buch soll nach Ansicht des Verf. kein Bilderbuch sein, sondern
als Nachschlagewerk für die im Jahre 2000 noch zugänglichen
Mineralfundorte und ihre Mineralvergesellschaftungen dienen. Verf.
regt an, daß man zur Vertiefung der Kenntnisse das ausführliche
Literaturverzeichnis benutzen soll.
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II, Jg. 2002, Heft 3/4