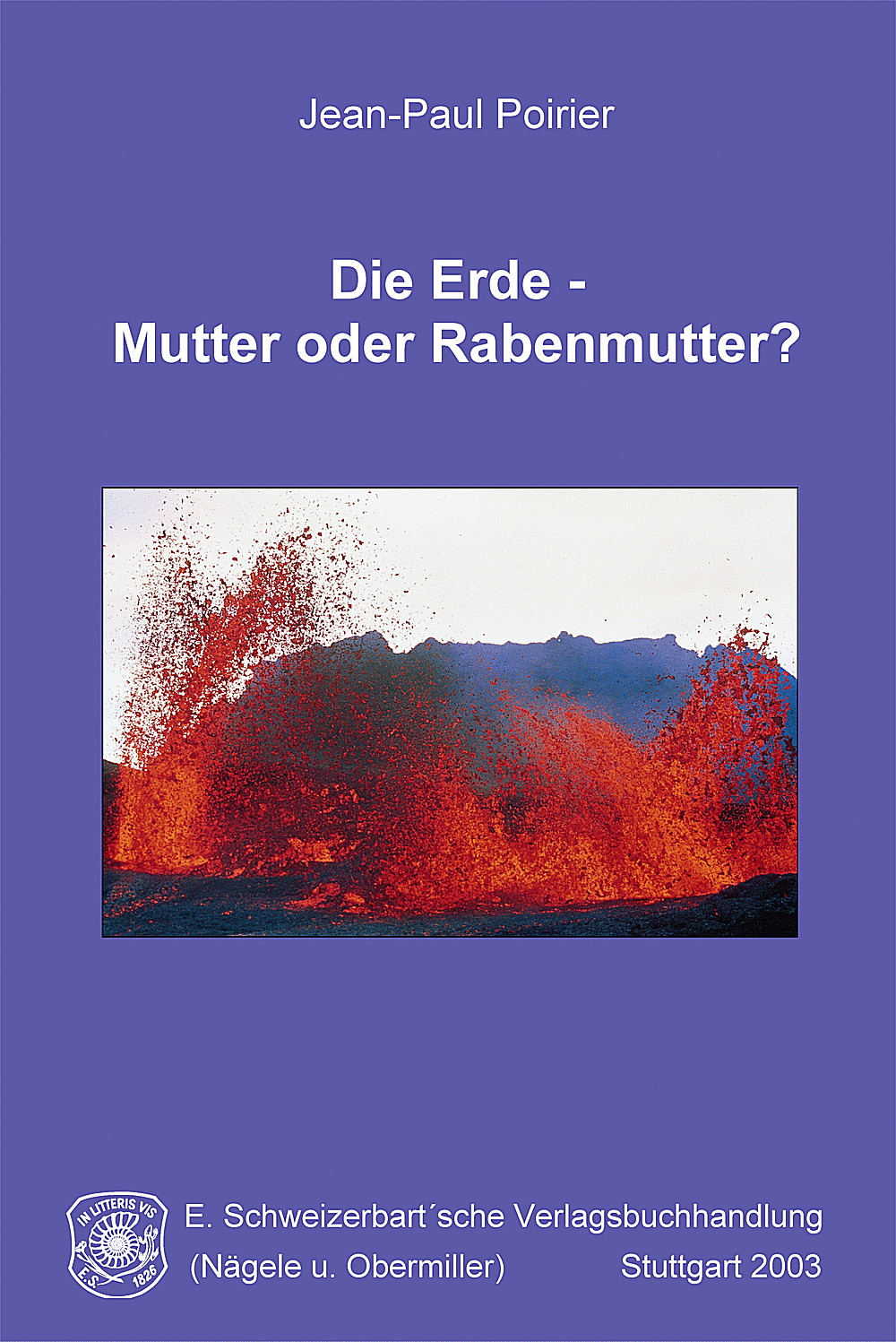"Die Menschheit und die Erde unterhalten eine dauernde und intensive
Wechselbeziehung: die Erde ist unsere Mutter. Sie versorgt uns mit
Wasser, ohne das kein Leben möglich ist. Aus ihrem Inneren holen wir
uns die Energierohstoffe, ohne die unser Leben recht schwierig
wäre. Die Energie der Erde äußert sich aber auch in gewaltigen
Wutanfällen, die Menschen morden: die Erde bebt; sie speit Feuer. Wäre
sie somit eine Rabenmutter für ihre Kinder? Ist nicht auch sie es, die
von Zeit zu Zeit Massensterben heraufbeschwört, vernichtet, was ihre
Oberfläche bewohnt? gerade über dieses Verhältnis zwischen der Erde
und den Menschen - und seine Folgen für die Menschheit - möchte ich
mich mit dem Leser unterhalten." So beschreibt der Geowissenschaftler
Jean-Paul Poirier im Vorwort seines nun ins Deutsche übersetzten
populärwissenschaftlichen Buches seine Absichten. Sein Stil kommt
tatsächlich einer Unterhaltung nahe, einer geologischen Plauderei, in
der der Autor die verschiedenen Aspekte seines Themenkatalogs immer
wieder neu beleuchtet, so als hätte er tatsächlich ein Gegenüber, das
Einwände erhebt und Fragen stellt. Auf diese Weise gelingt es Poirier,
auch komplizierte Sachverhalte so darzustellen, dass sie jedem und
jeder verständlich werden. Leider sind bei der Übersetzung ins
Deutsche gelegentlich mehr Fremdworte und Fachbegriffe hineingeraten,
als notwendig gewesen wären, und als offensichtlich in Poiriers
ursprünglicher Absicht gestanden hat. Dennoch ist das Bändchen ein
sehr gut verständliches Werk.
Anders als Poiriers Absichtserklärung es vermuten lässt, konzentriert
sich der Inhalt überwiegend auf dem Aspekt "Rabenmutter Erde", der
natürlich der reißerischere Teil der Geschichte von der
Wechselbeziehung Erde-Mensch ist. Dabei würfelt der Autor Themen
zweierlei Ursprungs zusammen: Einerseits geologisch verursachte
Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche oder
Massenaussterbeereignisse und andererseits Probleme unserer heutigen
Zivilisation, zu denen die Erde lediglich das Potential geliefert hat,
die aber ansonsten im wesentlichen von Menschen gemacht sind, wie die
Endlagerung radioaktiver Abfälle, der anthropogene Klimawandel,
Wasserknappheit und das Wohl und Wehe der Nutzung fossiler
Energieträger.
Gelegentlich finden sich kleine sachliche Fehler, im großen und ganzen
aber erhält der Leser oder die Leserin ordentlich recherchierte
Informationen darüber, beispielsweise, ob man Erdbeben vorhersagen
kann oder welche präventiven Maßnahmen man ergreifen kann, um
möglicherweise die eine oder andere Katastrophe zu minimieren.
Über manche Analyse lässt sich auch trefflich streiten, überall da, wo
die öffentliche Debatte mehr von Ideologien als von Sachargumenten
geprägt ist, wie beispielsweise bei der Problematik rund um die
Endlagerung von stark radioaktiven Abfällen. Der oben geschilderte
Schreibstil des Buches erleichtert allerdings auch hier - wie stets -
die eigene Meinungsbildung von Leser oder Leserin.
Damit legt der Autor auch seine eigentliche Absicht dar. Denn dass die
Begriffe "Mutter" oder "Rabenmutter" unseren Erdball, der ja keine
bewusste Absicht in Bezug auf seine Bewohner verfolgt, unangebracht
vermenschlichen, das weiß auch Poirier. Sei eigentliches Thema ist
denn auch weniger das zufällige Verhalten der Erde gegenüber uns
Menschen als vielmehr das von uns zu gestaltende Verhältnis der
menschlichen Zivilisation gegenüber den oft genug unangenehmen
Überraschungen der Natur.
Die Stichworte, die immer hierbei wieder kehren, sind Verantwortung
und Risiko(-bereitschaft): Poirier schreibt: "Unsere fortschrittlichen
Gesellschaften haben durch Ignoranz, Sorglosigkeit oder Egoismus
zugelassen, dass sich auf mehr oder weniger lange Sicht potentiell
gefährliche Situationen entwickeln. [...] Treibhauseffekt, Ozonloch,
radioaktive Abfälle, Erschöpfung der Wasserreserven - das sind Themen,
zu denen jeder eine Meinung hat... Und das ist in einer Demokratie
sehr gesund. Weniger gesund aber ist es, dass die Meinung im
allgemeinen auf unvollständigen, häufig unkorrekten und oft
tendenziösen Informationen gründet. Die Öffentlichkeit bangt mit Fug
und Recht, ob die Politiker die gebotenen Maßnahmen ergreifen, um die
Gefahr zu bannen. Auf der anderen Seite zögern die Verantwortlichen,
im Interesse zukünftiger Generationen Maßnahmen zu ergreifen, die im
Augenblick teuer sind, denen sich zudem verschiedene Interessengruppen
entgegenstellen. Das gilt um so mehr, als die Risiken nicht
unmissverständlich definiert sind, die gebotenen Maßnahmen aber noch
weniger. In einer solchen Situation schaut jeder auf die
Wissenschaftler und erwartet, dass sie die Risken [sic] präzisieren
und den Weg weisen, dem man folgen muss, um sie abzuwenden. Wohl
gemerkt, jedermann ignoriert oder tut so, als wisse er nicht, dass
eine solche Einstellung den wissenschaftlichen Spielregeln zutiefst
widerspricht. Diese verlangen, dass man im Falle einer unklaren
Antwort auf eine Frage nicht irgendeine Sicherheit zum Ausdruck bringt
... um so mehr, wenn man keine gute Frage formulieren kann, was oft
genug der Fall ist."
Das Buch lehnt also die Verantwortung für Vorsorge und Risikoabwägung
durch Wissenschaftler ab. Diese können nach Poirier nur eine
Beschreibung eines möglichen Risikos liefern und auch dies oft genug
nicht mit absoluter Sicherheit. Die Risikoabwägung und die daraus
folgende Verantwortung des Handeln oder Nichthandelns trägt nach
Poirier die Politik und die Gesellschaft (und damit wir alle)
gleichermaßen.
Poirier ist hier wohl vom Unwohlsein getrieben, das ihn befällt, wenn
er wie viele seiner Kollegen und Kolleginnen mit Fragen konfrontiert
werden, die im ureigensten Sinne unwissenschaftlich sind, die sie also
nicht qua Amtes als Wissenschaftler entscheiden können, und zu denen
sie nur eine persönliche Meinung äußern können, wie alle anderen eben
auch.
Poirier selbst scheint sich eher den Fatalismus des Geologen, der in
Jahrmillionen zu denken gelernt hat, zu eigen gemacht haben. Er kann
sich sehr gut eine Erde ohne Menschen vorstellen, weiß er doch, dass
sie die meiste Zeit sehr gut ohne uns ausgekommen ist. Wenn wir dem
Autor da nicht folgen wollen, so werden wir wohl - diesen Schluss legt
das Büchlein nahe - an unserer Beziehung zur Mutter Erde noch ganz
kräftig arbeiten müssen. Poiriers Büchlein ist sein Beitrag, seinen
Lesern und Leserinnen genügend Sachinformationen an die Hand zu geben,
um zu den oben genannten Problemfeldern einen eigenen, sachbezogenen
Standpunkt finden zu können.
M. Kölbl-Ebert
Archaeopteryx Bd. 21, Heft 1 (2003)