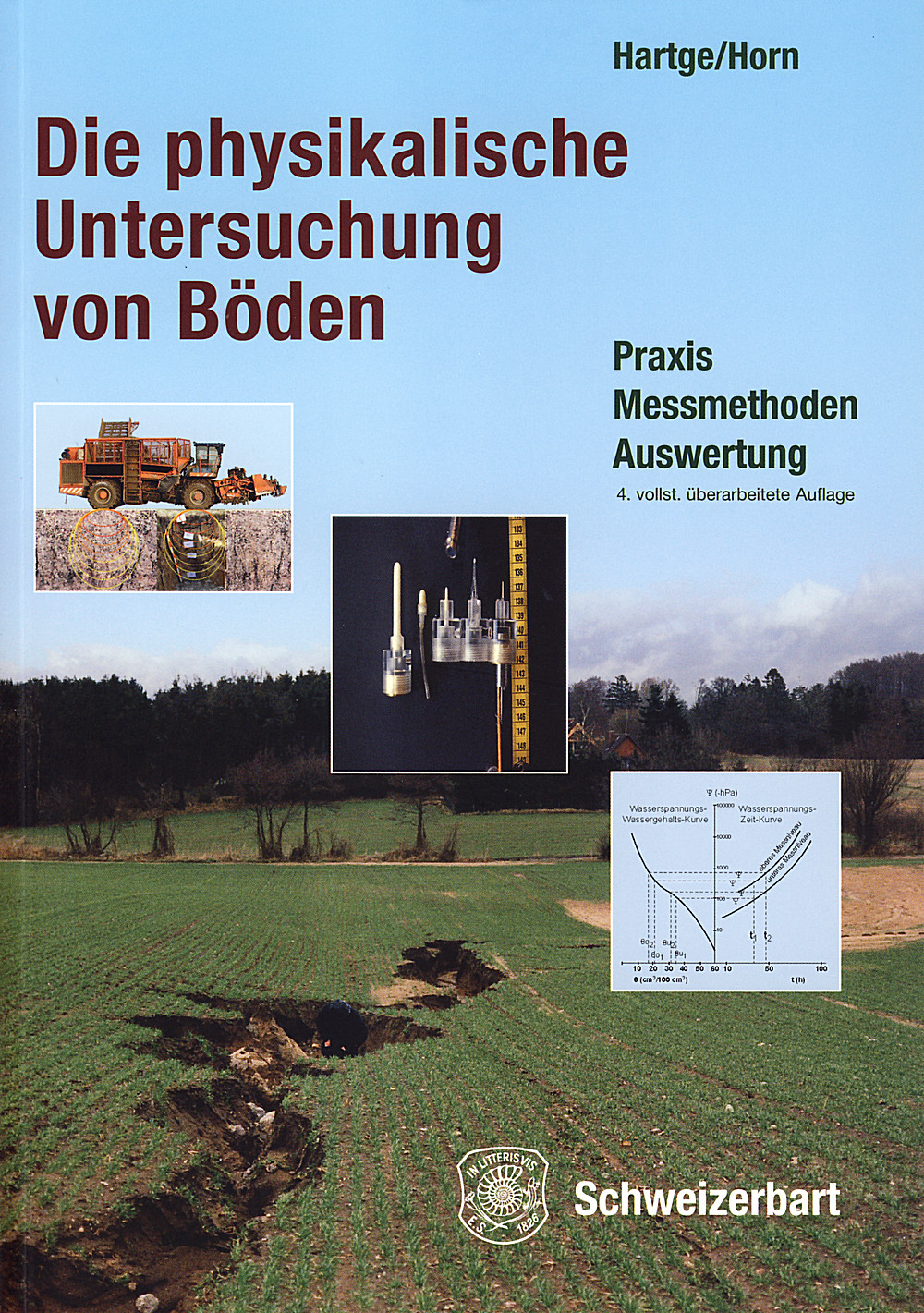Die überarbeitete Fassung des zuletzt in der 3. Auflage 1992 im
Enke-Verlag erschienenen Lehrbuches wurde inhaltlich erweitert, mit
digital nachgezeichneten Abbildungen versehen und insgesamt in ein
ansprechenderes Druckbild überführt.
An den Zielen der Autoren hat sich nichts geändert. Das Buch soll eine
Einführung in häufig angewandte bodenphysikalische Messmethoden geben,
die ohne großen Aufwand und mit einfachen Verfahren durchzuführen
sind. Dies scheint, nachdem der Aufbau bodenphysikalischer Labore in
Deutschland weitestgehend abgeschlossen ist, zwar nicht mehr ganz
zeitgemäß und stellt den Leser auch vor Probleme, wenn er in einem
modernen Labor beispielsweise nach einer einfachen Balkenwaage oder
Quecksilber-Manometern sucht. Die genaue Darstellung der
Versuchsaufbauten gewährt aber einen guten Einblick in die
Grundprinzipien der Messmethoden und deren Auswertung, so dass diese
leicht nachvollzogen werden können.
Wie bereits in der früheren Auflage werden zunächst grundsätzliche
Überlegungen zur Formulierung der Fragestellung, der
Probenahmestrategie und der Fehlerbetrachtung angestellt. Es folgt ein
Kapitel mit technischen Hinweisen zur Entnahme gestörter und
ungestörter Bodenproben. Die folgenden Kapitel stellen Messverfahren
zu folgenden physikalischen Bodeneigenschaften vor: Wassergehalt,
Korngrößenverteilung, Dichte des Bodens, Dichte der festen
Bodensubstanz, Porenraum, Drucksetzungsverhalten, Scherparameter,
Wasserspannungskurve, Aggregatstabilität, Wasserleitfähigkeit,
Matrixpotential und Eindringwiderstand. Diese Kapitel sind jeweils
gegliedert in a) eine kurze Einführung mit grundsätzlichen
Überlegungen zu Problemstellung und Prinzip der Methode, b) eine
genaue Beschreibung der Durchführung mit einer Liste der benötigten
Gerätschaften, c) Anleitungen zur Auswertung und d) Hinweisen zur
Bewertung der ermittelten Werte. Abschließend werden jeweils
alternative Verfahren benannt und die wichtigste Literatur
aufgelistet. In dem Kapitel 15 wird schließlich auf die Auswertung
örtlich zuordnungsfähiger Messwerte eingegangen.
Die Zielsetzung der Autoren bringt mit sich, dass die Darstellung
neuer bodenphysikalischer Messverfahren, wie z.B. die Messung des
Bodenwassergehaltes mit TDR-Sonden oder der Wasserspannung mit
Druckabnehmertensiometern sehr kurz kommt. Die Verweise auf
alternative Verfahren, z.B. zur Bestimmung der Scherparameter, sind
allerdings ausführlicher als in der 3. Auflage. Zudem wurden die
Literaturhinweise am Ende der Kapitel aktualisiert und erweitert, so
dass sich der Leser an anderer Stelle ein Bild über alternative
bodenphysikalische Messverfahren machen kann. Zu begrüßen sind die
neuen Anmerkungen zur Arbeitssicherheit im Umgang mit Quecksilber oder
Xylol. Eine wesentliche inhaltliche Erweiterung ist das neue Kapitel
16, in dem die Ableitung des Verdichtungszustandes aus
Lagerungsdichten oder Eindringwiderständen beschrieben wird. Vor einer
Neuauflage sollten hier allerdings einige orthografische Fehler
verbessert, mehrere sehr langen Sätze gekürzt und auf das
Wortungeheuer „umgebungsbedingungsabhängig“ ganz verzichtet
werden. Dies könnte das Verständnis der dargestellten Verfahren
erleichtern. Zuletzt stehen noch ein Anhang mit häufig benötigten
Umrechnungsfaktoren und ein ebenfalls recht nützliches
Stichwortverzeichnis.
Martin Kehl
Erdkunde 64/4 (2010)