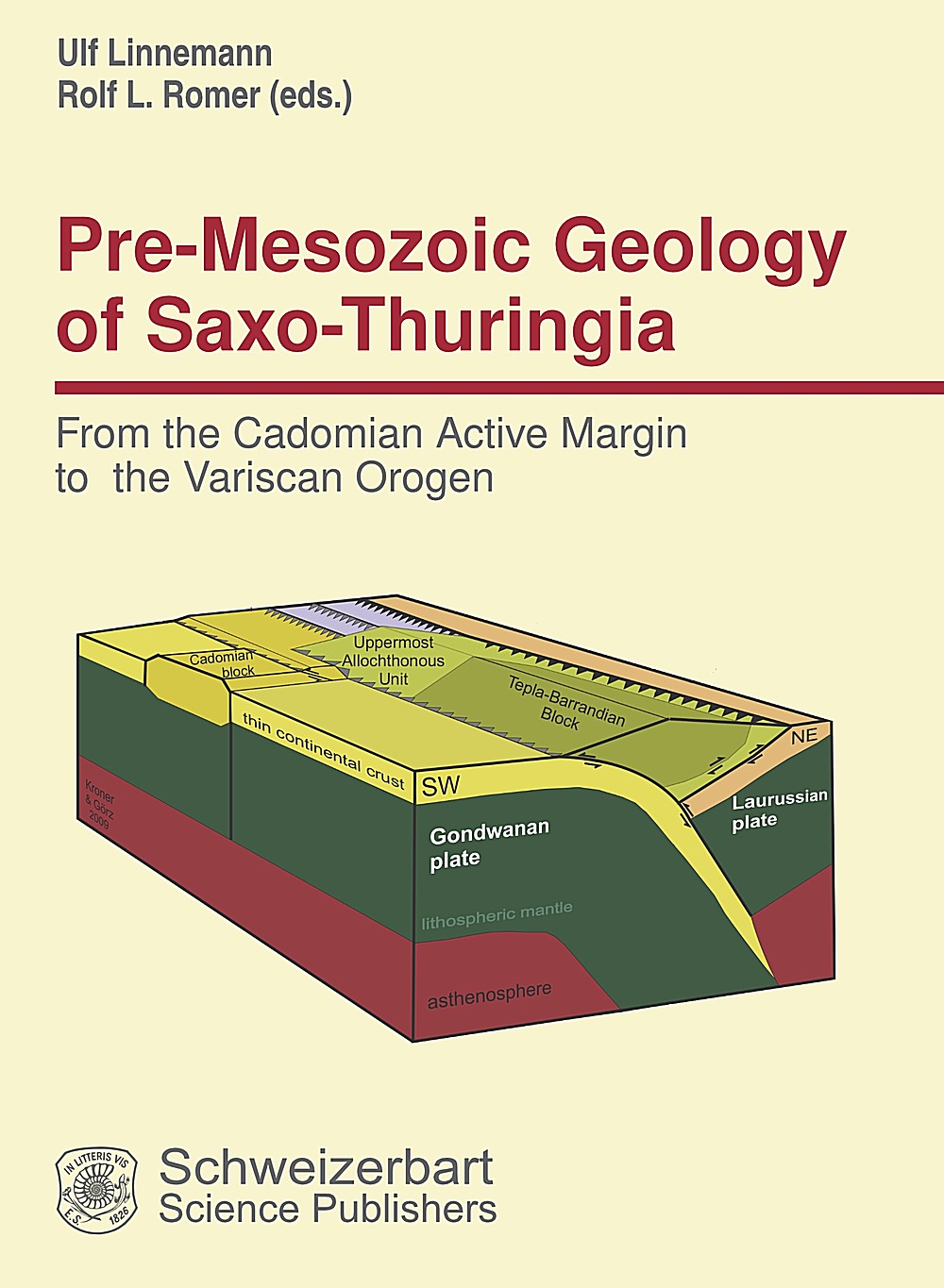Um es vorwegzunehmen: Dieser Band ist nicht – wie man zunächst
vermuten könnte – eine englische Fassung des Beitrags von LINNEMANN
(2008), sondern eine völlig eigenständige Publikation mit Elementen
der vorhergehenden. Das zeigt zum einen die ganz andere Zielsetzung:
Früher untersuchte man die geologische Geschichte des Saxothuringikums
unter Berücksichtigung der Variszischen Orogenese. Jetzt ist es unter
erheblicher Vergrößerung des Maßstabs eher umgekehrt: Es geht um
sedimentologische und plattentektonische Prozesse im Armorikanischen
Terran-Ensemble (Peri-Gondwana) am Nordrand Gondwanas im Zusammenhang
mit der Variszischen Orogenese am Brennpunkt
Gondwana/Laurussia. Dieser Abschnitt ist wesentlich für die Genese von
Pangaea. Schwerpunkt ist dabei das Saxothuringikum an der Spitze des
Kollisionssporns. Es geht also um nicht weniger als um das Verständnis
geodynamischer Prozesse einer Schlüsselregion der Variszischen
Orogenese. Zum anderen zeigt es sich auch in dem zwangsläufi g
erheblich breiteren und detaillierteren Ansatz. Zudem verbindet man
jetzt die drei wesentlichen Struktureinheiten des Saxothuringikums
konsequenter als zuvor mit dem Begriff der Domäne, deren ehemals als
parautochthon eingeschätzten Elemente man schon an anderer Stelle zu
autochthonen aufwertete.
Die Saxo-Thuringische Zone Deutschlands (das Saxothuringikum = STZ) am
Nordrand des Böhmischen Massivs ist eine bedeutende Struktur für das
Verständnis variszischer Prozesse in Mittel-Europa. An dieser Ecke
Gondwanas kollidierte seine Vorhut, das Armorikanische
Terran-Ensemble, mit Laurussia. Dies war der erste Schritt zur
Schließung des Rheischen Ozeans. Die STZ besteht aus drei Domänen, die
man jeweils in zwei Schub- und Blattverschiebungszonen sowie eine
autochthone und eine allochthone Domäne weiter unterteilt. Während
die Letztere von deutlichen variszischen Umwandlungsprozessen geprägt
ist – von mittelgradiger Metamorphose bis Ultrahochtemperatur-/
Ultrahochdruckmetamorphose –, blieben die Autochthone Domäne sowie
ihre genetisch verwandten zwei Zonen weitestgehend unverändert. In
diesen unterschiedlichen Überprägungen dokumentieren sich eine
prävariszische Heterogenität von Kruste und deren Dicke: Dünnere
Segmente erfasste die Subduktion, dickere dagegen nicht.
Die unterschiedliche Krustendicke geht auf das Rifting der vor 570–540
Ma gebildeten kadomischen Kruste während des Ordovizium (470–480 Ma)
am Rande Gondwanas zurück. Magmatische und sedimentäre Gesteine,
abgelagert auf der dünnen Kruste dieser Rifts, formen heute die
metamorphen Komplexe des sächsischen Granulit-Massivs und des
Erzgebirges. Unterschiedliches Verhalten verschieden dicker
Krustenabschnitte gegenüber variszischer Deformation und Metamorphose
ist kein spezifisches Phänomen der STZ, sondern typisch für die Kruste
der europäischen Varisziden.
35 Autoren verbinden in 18 Beiträgen neue Forschungsergebnisse mit
Kompilationen zu Details der 300 Ma dauernden Geschichte der STZ und
damit zur Variszischen Orogenese, also vorwiegend plattentektonischen
Prozessen. Grundlage sind vor allem erst seit 1990 frei zugängliche
Daten aus besonders zahlreichen Prospektionsbohrungen, aber auch aus
Neukartierungen bislang wenig beachteter Regionen. Der Band gliedert
sich in fünf einzelne, fortlaufend nummerierte Kapitel. Den Kapiteln
jedes Teils sind ihre Inhalte kurz vorangestellt. Manche enthalten am
Ende auch eine nützliche Zusammenfassung.
Teil I (Einführung): Kapitel 1 beschäftigt sich zunächst mit der Rolle
der Variszischen Orogenese bei der Bildung von Pangäa. Der nördlichen
Grenze des Böhmischen Massivs, der STZ, kommt dabei wegen ihrer
paläogeografi schen Lage im unmittelbaren Kollisionsbereich
Gondwana/Laurussia bzw. an der Grenze zwischen West- und Ost-Pangäa,
der Rheischen Sutur, besondere Bedeutung zu.
Kapitel 2 behandelt die Erforschungsgeschichte der STZ mit Schwerpunkt
auf Kartierarbeiten. Ein hoher Bedarf an Rohstoffen führte zwischen
1945 und 1990 bei der geologischen Exploration zu äußersten
Anstrengungen. Ein wichtiges zusammenfassendes Ergebnis dieser und
anderer Kartierungen – die geologische Karte 1:500.000 für das Gebiet
der DDR – ist dem Buch als Anhang beigefügt. Die beiliegende DVD
enthält zudem die erste geologische Karte Sachsens (1835– 1845).
Kapitel 3 referiert den geochemischen Charakter der Kruste der STZ.
Ihre lithologische Heterogenität hatte man zeitweilig auf das Wirken
sehr unterschiedlicher Prozesse zurückgeführt, die zudem auf
Materialien sehr verschiedener Herkunft einwirkten. Geochemische
Analysen und Isotopendaten zeigen nun jedoch, dass alle Domänen der
STZ eine gemeinsame prävariszische Geschichte am Nordrand von Gondwana
haben. Und ihre strukturellen Unterschiede sind allein davon abhängig,
in welchem Maße sie die tektonischen Prozesse der Variszischen
Orogenese betrafen. Den engen Zusammenhang zwischen den einzelnen
Domänen bzw. ihre genetische Unabhängigkeit von anderen Zonen des
Variszischen Orogens begründen die Autoren anhand von fünf
Schlüsselargumenten, darunter vor allem die Alter der magmatischen
Protolithe, Neodymisotopie und Endemismus bestimmer ordovizischer
Lithologien.
Teil II (Die Autochthone Domäne und die Schub- und
Blattverschiebungszone = low-strain-Segment) betrachtet zwei der
wesentlichen strukturellen Einheiten der STZ, ihre Inhalte und die
Entstehungsweisen (Kapitel 4). Im Unterschied zur Allochthonen Domäne
(= high-strain-Segment) sind es diejenigen Bereiche der STZ mit einer
mehr oder weniger geringen metamorphen Überprägung. Mit diesen
verschiedenen Metamorphosegraden ist auch eine Unterscheidung
möglich. Die Entstehung der Autochthonen Domäne ist eng mit der
Kadomischen Orogenese (spätes Präkambrium bis frühestes
Unter-Kambrium) und nachfolgender mariner Sedimentation verbunden.
Die paläozoische Übergangsphase zwischen der Kadomischen und der
Variszischen Orogenese beschreibt Kapitel 5. Schwerpunkt ist die
Entwicklung der sedimentären Abläufe für den Zeitraum zwischen
Kambrium und Unter- Karbon unter Berücksichtigung von magmatischen
Ereignissen, Liefergebieten der Sedimente und wechselnden tektonischen
und paläogeografi schen Umfeldern. Die Ereignisse sind wesentlich von
der Öffnung (im Ordovizium) und Schließung (Unter-Karbon) des
Rheischen Ozeans und der Variszischen Orogenese (Klimax im Ober-Devon
und Unter-Karbon) beeinflusst.
Kapitel 6 ist mit 72 Seiten das mit Abstand längste des Bandes und
behandelt die biostratigrafi schen Potenziale der STZ
bzw. schwerpunktmäßig der Autochthonen Domäne für den Zeitraum
Ediacarium (spätes Präkambrium) bis Unter-Karbon. Über die zum Teil
spektakulären Faunen und Floren der oberkarbonischen und permischen
Molassen erfährt man dagegen erst in Kapitel 15 näheres. Zu einem der
interessantesten Funde, einer Arthropleura aus frühpermischen Teilen
der Döhlen-Schichten, findet man leider nur Angaben im
Literaturverzeichnis. Die Faunen sind im Allgemeinen selten und
unregelmäßig in der Gesteinssäule verteilt. Dennoch erlauben manche
recht präzise biostratigrafische Korrelationen und vor allem
paläogeografi sche Aussagen. Wichtig ist besonders die Erkenntnis,
dass die STZ am Nordrand von Gondwana am südlichen Rand des Rheischen
Ozeans lag.
Im Vergleich zu LINNEMANN (2008) ist im vorliegenden Buch der
biostratigrafi sche Teil wesentlich ausführlicher. Praktisch alle
bedeutenden Fossilien sind zumindest erwähnt. Hervorzuheben sind die
Behandlung der präkambrischen Funde (Acritarchen), umfangreiche Listen
späterer Acritarchen, von Tentakuliten und Cephalopoden, Abbildungen
von Conodonten und Graptolithen (also relevanten Leitfossilgruppen)
sowie eine Übersicht über die Trilobiten (zum Teil mit bisher
unveröffentlichten Fotos). Bei den Abbildungen sind die
postkambrischen Trilobiten, vor allem die devonischen, leider etwas
unterrepräsentiert. Die wenigen silurischen Trilobiten sind namentlich
überhaupt nicht aufgeführt. Der Begriff „mid-cranidium“ (S. 162,
Erläuterungen zu Abb. 20) für ein Cranidium ist
gewöhnungsbedürftig. Kapitel 6 kann man als erste Orientierungshilfe
im Gelände auch Amateuren sehr empfehlen.
Mit der synorogenen Flyschsedimentation im Unter-Karbon der STZ
befasst sich Kapitel 7: Mächtige turbiditische Grauwacken und Ton- und
Siltsteine des saxothuringischen Beckens bilden den Abschluss der
marinen paläozoischen Sedimentation. Es sind die Erosionsprodukte des
herausgehobenen Orogens. Sie hängen unmittelbar mit der lateralen
Extrusion niedrig- bis hochmetamorpher Gesteine der Allochthonen
Domäne während der variszischen D2-Deformation zusammen. Ihren
Ablagerungsraum deutet man als marines Vorlandbecken. In der
südwestlichen Schub- und Blattverschiebungszone der Autochthonen
Domäne sind sie durch variszische Beanspruchung deformiert.
Teil III (Die Allochthone Domäne = high-strain-Segment): Dieser
bereits früher defi nierte Begriff bezeichnet die zu einem hohen Maße
von tektonometamorphen Prozessen der Variszischen Orogenese erfassten
Teile der STZ. Wie bei der Autochthonen Domäne handelt es sich um
Material aus der Kadomischen Orogenese und mariner
Sedimentation. Kapitel 8 untersucht die nördliche bis nordwestliche
Grenze der STZ, die Mitteldeutsche Kristallinzone. Sie ist die
Schnittstelle zwischen den Terran-Ensembles Ost-Avalonia und Armorika.
Neueste, noch unveröffentlichte Daten, so die Autoren, legen
allerdings eine andere Interpretation nahe. Schwerpunkt des Kapitels
ist die Analyse der strukturellen Einheiten dieser Zone vor allem
unter den Aspekten Lithologie, Tektonik, Metamorphose und absolute
Altersdatierungen. Ergebnis ist die Darstellung ihrer Evolution vom
späten Ordovizium bis zum Unter-Karbon.
Kapitel 9 beschreibt wesentliche Bestandteile der Allochthonen Domäne:
die allochthonen Kristallinkomplexe Münchberg, Frankenberg, Wildenfels
und das genetisch verwandte polnische Eulengebirge. Das Letztere
unterscheidet sich dabei durch sein abweichendes Streichen. Die
Ursachen für diese Sonderstellung sind gegenwärtig noch
unbekannt. Diese Domäne umfasst die höchsten tektonostratigrafi schen
Einheiten. Für alle Komplexe nahm man zunächst allochthonen Ursprung
an; später hielt man sie für herausgehobene Blöcke, also für
autochthon. Inzwischen neigt man dazu, sie als Krustenstapel oder
tektonische Klippen zu interpretieren, die während des Unter-Karbon
aus südöstlicher Richtung trans portiert wurden. Ähnliche tektonische
Sequenzen und lithologische Zusammensetzung belegen den gemeinsamen
Ursprung dieser Komplexe.
Das sächsische Granulitgebirge (die Typuslokalität für Granulit)
(Kapitel 10) und das Erzgebirge sind unter den Bedingungen von
ultrahohem Druck und ultrahoher Temperatur entstanden. Somit sind es
die am stärksten metamorphisierten Einheiten der STZ. Die adiabatische
Exhumierung des Granulitgebirges führte zu einer
Kontaktmetamorphose. Schwerpunkt dieses Kapitels ist der äußerst
komplexe strukturelle Aufbau des Granulitgebirges und daraus
abgeleitete Implikationen für seine Genese. Es mag sich vielleicht
nicht jedem Leser sofort erschließen, warum, wie der Titel sagt, das
Granulitgebirge ein Schlüsselgebiet für die geodynamische Entwicklung
der Varisziden Mitteleuropas darstellt.
Mit der Behandlung des Erzgebirges setzt Kapitel 11 die Darstellung
der Hochdruckeinheiten der STZ fort. Es ist ein Stapel aus
Ultrahochdruckbis Tiefdruck-Decken aus metamorphisierten Gesteinen des
Kadomischen Grundgebirges und seiner frühpaläozoischen
Sedimentdecke. Ähnlichkeiten mit der Autochthonen Domäne und den
Schub- und Blattverschiebungszonen deuten auf tektonischen Stapelbau
und verweisen für die Herkunft der prämetamorphen Gesteine auf den
Rand von Gondwana. Während der variszischen Kollision wurden
frühpaläozoische Gesteine mehr als 100 km tief versenkt.
Nach der Behandlung von Teilaspekten in den Kapiteln 9–11 versucht
Kapitel 12 konsequenterweise ein tektonisches Modell für die
Metamorphose der Decken in der Allochthonen Domäne. Das vorgestellte
Modell ist thermisch nachvollziehbar und erklärt die tektonische
Entwicklung des Gebiets für den Zeitraum zwischen 400 und 340 Ma, also
spätem Unter-Devon bis Unter-Karbon. Es berücksichtigt sowohl die
regionalen Unterschiede in den D1- und D2-Deformationen als auch das
Nebeneinander von sehr verschieden hochmetamorphen
Einheiten. Regionale D1- Strukturen hängen mit Subduktion und
Kollision zusammen. Darin dokumentieren sich Deformationen, die auf
die Bewegungen von Material während Progression und maximalen
metamorphen Bedingungen zurückgehen. Dagegen hängen D2- Strukturen mit
lateraler Extrusion zusammen. Sie entwickelten sich während
abklingender metamorpher Phasen. Darin spiegelt sich eine
Dehnungsdeformation während des Nebeneinanders von metamorphen
Gesteinen der Hochdruck- und der Ultrahochdruckphase in der oberen
Kruste wider.
Laterale Extrusion, tektonischer Stapelbau und Exhumierung in höheren
Krustenstockwerken vollzogen sich in wenigen Millionen Jahren und
endeten mit dem Eindringen von Graniten in großen Mengen in die obere
Kruste im Unter- Karbon (Kapitel 13). Sie sind in ihrer
Zusammensetzung ungewöhnlich divers und bestehen vorwiegend aus
aufgeschmolzener Kruste. Ihre Diversität und der ziemlich progressiv
wirkende Charakter der einfachsten dieser Granite weisen auf
bevorzugtes Aufschmelzen bestimmter Einheiten in einer Kruste mit
Deckenbau.
Teil IV (Späte und postvariszische Reaktivierung) behandelt die
Entwicklung der Molasse-Sedimentation, späte Deformationen und
hydrothermale Aktivitäten. Auf mehr als 1.000 m mächtige Turbidite
eines tiefmarinen Milieus folgen im mittleren Viseum (Unter-Karbon)
Sedimente flachmarinen bis terrestrischen Ursprungs, die „früh
variszischen Molassen“ der STZ (Kapitel 14). Diese auffallende
Änderung im Ablagerungsgefüge bezeichnet den Beginn des Zusammenbruchs
der Variszischen Orogenese und gleichzeitige Beckenbildung. Die
„Molassen“ zeigen entlang einer Süd-Nord gerichteten Achse, die im
Norden die Rhenoherzynische Zone der Variskiden erreicht, einen
graduellen Übergang von völlig terrestrischer nach fluviatiler,
paralischer und mariner Sedimentation. Die Relikte dieser
„Molassebecken“ finden sich heute im Delitzsch-, Doberlug- Torgau- und
Hainichen-Becken. Ihre detaillierte Beschreibung, vor allem unter
lithologischen, biostratigrafi schen (floristischen) und
radiometrischen Aspekten, ist Schwerpunkt dieses Kapitels. Die
Auswertung der sedimentologischen Befunde erlaubt Rekonstruktionen der
Ablagerungsbedingungen, besonders ausführlich für das
Delitzsch-Gebiet.
Während der syn- bis postorogenetischen Entwicklung des variszischen
Zentral-Europas entstanden zahlreiche spätvariszische Becken (Kapitel
15), in denen sich der Abtragungsschutt des Orogens ablagerte. Die
sedimentäre und vulkanische Füllung dokumentiert neben der Abtragung
des Orogens auch die Klimaänderung im Perm zugunsten mehr arider
Bedingungen sowie die tektonische und magmatische Aktivität im
Zusammenhang mit dem postvariszischen Wiederaufbau des
Spannungsfeldes, das im Perm zu Rifting und vielleicht zur Öffnung der
Tethys führte. Die Becken der STZ und angrenzender Gebiete änderten
sich systematisch von Nord nach Süd, vom variszischen Saumsenke-Becken
mit vorwiegend submarinen Turbiditen zu verschiedenartig
strukturierten Becken im Umfeld des Orogens, die Fächerdeltas mit
fluviatilem Sediment belieferten. Durch wiederholte tektonische
Aktivität änderten sie sich ständig. Die zeitliche Entwicklung dieser
Becken ist biostratigrafi sch zum Teil gut
nachzuvollziehen. Beschreibungen der wichtigsten dieser Becken, also
nicht nur der STZ, bestimmen den größten Teil dieses Kapitels. In der
Geschichte der Becken im Zeitraum zwischen dem Ober-Karbon und dem
Ober-Perm dokumentiert sich die Bildung von Pangäa und der
Variszischen Orokline. Der Wiederaufbau des Spannungsfeldes mit der
nach Westen fortschreitenden Schließung des Rheischen Ozeans und der
nachfolgenden Öffnung von Tethys und des Nord-Atlantiks reaktivierte
alte Schwächezonen in der kontinentalen Kruste. Dies führte zur
Bildung neuer Becken, abrupten Fazieswechseln in den vorhandenen
Becken und zu hydrothermaler Mineralausscheidung entlang der
Störungszonen, sowohl innerhalb der Becken als auch in angrenzenden
Strukturen. In Abb. 2 sind zur korrekten Darstellung der Korrelationen
die Spalten der genannten Becken um die Höhe der Zeile „Buntsandstein“
nach oben zu verschieben.
Kapitel 16 befasst sich hauptsächlich mit der Altersverteilung von
hydrothermalen Mineralablagerungen im Erzgebirge. Spitzenwerte bei der
hydrothermal gesteuerten Umschichtung von Metallionen aus älteren
Mineralisationen treten synchron mit Veränderungen im weiträumigen
Spannungsfeld, nämlich zwischen 270 Ma und 80-60 Ma, wiederholt auf
und entsprechen dem postvariszischen Wiederaufbau des Spannungsfeldes,
der Öffnung der Tethys und verschiedenen Phasen der Öffnung des
Nordatlantiks. Gleiche Chronologien fand man für Mineraladern
hydrothermalen Ursprungs anderer europäischer Vorkommen. Dabei tritt
weiter im Westen der postvariszische Spitzenwert jedoch etwas später
auf.
Teil V (Synthese): vereint die Ergebnisse der vorhergehenden Kapitel
in einem zusammenhängenden geotektonischen Modell, dargelegt vor allem
mit Kapitel 18. Sein Kern ist ein einfaches Zwei-Platten-Konzept, das
im Gegensatz zu manchen Multiple-Platten-Systemen steht. Es ergibt
sich zwingend aus paläomagnetischen Informationen, paläobiogeografi
schen Erwägungen und Daten zur Herkunft von Sedimenten. Das
Variszische Orogen ist nicht Folge der Aktivität von unabhängig
driftenden Krustenblöcken (Mikroplatten), die durch Ozeane getrennt
waren. Dies schließt man aus seinem komplexen Aufbau mit zahlreichen
Suturen, der unregelmäßigen Verteilung und Raumlage der metamorphen
Gürtel, dem engen Nebeneinander unterschiedlicher metamorpher
Szenarien und dem Auftreten von Blöcken, die nicht oder kaum
variszisch aufgearbeitet sind. Vielmehr dokumentieren diese Faktoren
eine Diversität in der Krustendicke und Lithologie im Vorfeld der
Kollisionsphase. Beides beeinfl usst das Verhalten von Kruste im
Zusammenhang vor und mit Subduktionsprozessen maßgeblich. Große
Krustenblöcke versperrten die Subduktionszone, unterbrachen vielleicht
sogar die Subduktion, und bedingten so eine neue Subduktionsfront
hinter der Blockade. Die dünnere Kruste und ihre Sedimentbedeckung
hingegen wurden zunächst subduziert und dann zwischen den großen
Krustenblöcken an der Oberfl äche herausgepresst. So bildeten sich
zwischen ihnen unregelmäßige metamorphe Gürtel. Frühere tektonische
Modelle forderten dagegen zahlreiche, weit verstreute Terrane
gondwanischen Ursprungs (Mikroplatten), die vor der Kollision
unabhängig voneinander drifteten. Sie basierten vorwiegend auf
paläomagnetischen Daten. Die alternative Interpretation verzichtet auf
derartige Terrane, ist stärker konform mit paläontologischen Daten und
auch hinsichtlich der Liefergebiete der Sedimente schlüssiger.
Auch neue isotopengeochemische Daten (Kapitel 17) liefern Szenarien,
die ohne große Ozeane auskommen. Untersucht sind Sr- und
Nd-Isotopengemische aus baltischer Kruste aufl agernden paläozoischen
Schiefern der Bohrung G14 (50 km nordöstlich von Rügen), also Baltica
im Grenzbereich zu Avalonia während des Ober-Perms. Die vorgefundenen
systematischen Zeitmuster erlauben Aussagen über Entfernungen zwischen
Liefergebieten, das Tempo geodynamischer Prozesse und vor allem
Veränderungen der Liefergebiete für Sedimente. Die Ergebnisse deuten
auf eine kontinuierliche Verlagerung des Liefergebiets der Sedimente
von Baltica (vor mehr als 530 Ma) nach vorwiegend Ost-Avalonia
(490–465 Ma) und Gondwana (weniger als 450 Ma). Sedimente aus
Bohrungen in der Kruste Rügens (Ost-Avalonia) bezeugen einen Wechsel
der Lithologie von avalonisch nach gondwanisch, wobei das Letztere
hier lagebedingt deutlich früher erscheint als bei G14. Die
Isotopenverhäältnisse von G14 und Rügen weisen auf eine frühere
Annäherung von Ost-Avalonia und Gondwana an Baltica, als
paläontologische und strukturelle Daten bisher nahe legten. Dies
könnte auf ausgeprägte strike-slip-Bewegungen (Blattverschiebungen)
vor der Kollision hinweisen.
Kapitel 18 vereinigt die Daten vorhergehender Kapitel in einer
tektonischen Synthese, die die Bildung der Varisziden auf
kontinuierliche plattentektonische Prozesse zurückführt. Sie haben
ihren Ausgang in der Kadomischen Orogenese und der nachfolgenden
Abtrennung von Avalonia sowie Dehnung des Randes von Gondwana und
enden mit der vollständigen Schließung des Rheischen Ozeans und der
Öffnung der Paläo-Tethys. Weit ausgreifendes Rifting des
Gondwanarandes bedingte vielleicht seine Dehnung, die Abtrennung von
Avalonia und die Entwicklung des Rheischen Ozeans. Die Ausweitung des
Randes von Gondwana folgte größtenteils kadomischen Strukturen:
Infolge umfangreicher kadomischer Intrusionen einzementierte Blöcke
blieben in situ, die Abschnitte vorzugsweise vulkanischer und
sedimentärer Gesteine findet man dagegen weit verbreitet. Die
kadomischen Blöcke des Armorikanischen Terran-Ensembles wie Teplá-
Barrandium, Böhmisches Massiv, Autochthone Domäne der STZ, Armorika,
Protoalpen, französisches Zentralmassiv und Iberia bildeten einen mit
Gondwana verbundenen Sporn. Beim Andocken dieses Sporns an Laurussia
während der Variszischen Orogenese führten die Folgen
unterschiedlicher Mechanik dicker und dünner Kruste zu sehr
verschiedenen tektonischen Szenarien. So erklärt man die komplexe
Geometrie des Variszischen Orogens und das enge räumliche
Nebeneinander von niedrig- und hochgradig metamorphen
Einheiten. Dieses Modell stimmt auch mit der Seltenheit von
Ophiolitgürteln im Variszischen Orogen überein. Während des Andockens
veränderten Elemente des Sporns ihre Zugehörigkeit von der Unter- zur
Oberplatte. Die zunehmende Annäherung von Gondwana und Laurussia
führte zu Deformation und Ausdünnung des Sporns und eventuell zum
Zusammenstoß von Gondwana und Laurussia. Die endgültige Schließung des
Rheischen Ozeans, die die strike-slip-Verformung von Gondwana am
Südrand des variszisch überprägten Segments voraussetzte, führte zur
Bildung von zunehmend jüngeren Orogenen im Westen und hing zusammen
mit der Öffnung der Neotethys im Osten.
Das Buch schließt mit einem sehr umfangreichen Literaturverzeichnis
(berücksichtigt Schriften bis 2008), einem Index, Farbtafeln sowie
einer englischen Fassung der Legende zur beiliegenden Geologischen
Karte 1:500.000 der DDR.
In der Besprechung des Beitrags von LINNEMANN (2008) wies der
Rez. (BASSE 2010) auf die zum Teil sehr komplexen Abbildungen
hin. Dieses Problem stellt sich zwangsläufig auch für den vorliegenden
Band (zum Beispiel Seite 95, Abb. 26, Seite 177, Abb. 4). Allerdings
lassen sich manche dieser komplexen Zusammenhänge mit einfachen
Mitteln tatsächlich nur schwer wiedergeben. Ursprünglich farbige
Abbildungen sind jetzt oft in Grautönen dargestellt, wodurch der Band
gegenüber dem älteren nach Ansicht des Rez. erheblich gewinnt. Die
Konzeption des Buches bringt gelegentlich inhaltliche Überlappungen
und Wiederholungen mit sich. Das ist allerdings eher vorteilhaft, weil
es dem weniger mit der Materie vertrauten Konsumenten das Lesen
erleichtert.
Den Autoren gelang mit der Breite des Ansatzes, der ungemein
detaillierten Durchdringung der Materie durch Berücksichtigung von
zahlreichen Einzelergebnissen sowie in der Prägnanz der Darstellung
ein überragendes Werk. Seine Aufmachung ist hervorragend, der
Verkaufspreis akzeptabel. Zielgruppe sind zwar eindeutig
Geowissenschaftler, doch auch Fossiliensammler finden in dem
geländetauglichen Buch Lesenswertes (Kapitel 6). Inzwischen
erschienene Publikationen zum Thema (WWW) zeigen: Die Forschungen sind
noch längst nicht abgeschlossen.
Martin Basse, Bochum
Zentralblatt für Geologie und Paläontologie Teil II, 2011, Heft 3-4