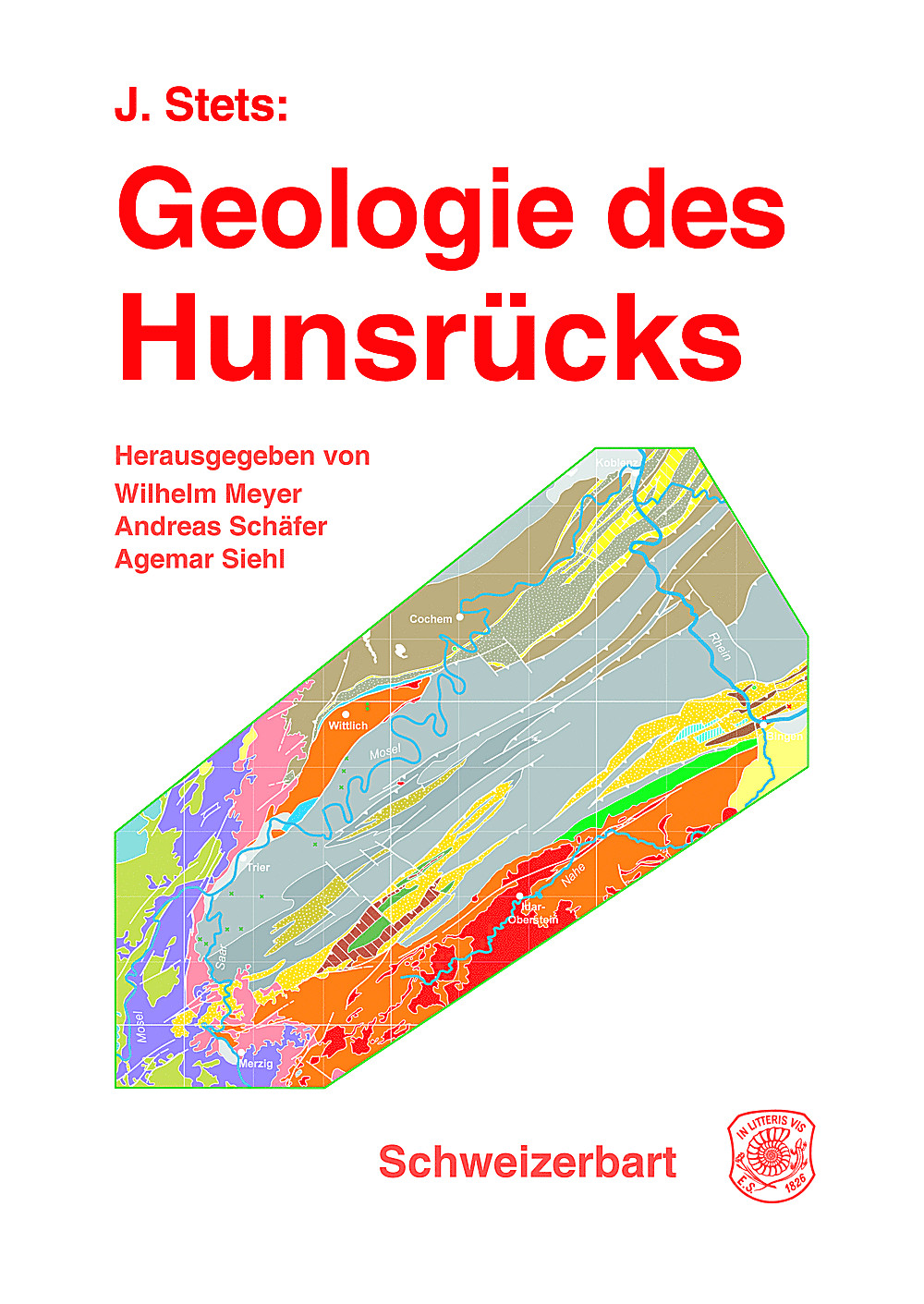Das vorliegende Buch basiert auf einem Manuskript, das sein
Verfasser Prof. Dr. Johannes Stets als Monographie über die Geologie
des Hunsrücks gedacht hatte. Nach seinem Tod im November 2015 haben
Freunde und Kollegen das fast abgeschlossene Manuskript u. a. gekürzt, unter Verzicht auf die moderne stratigraphische Nomenklatur fachliche Aktualisierungen vorgenommen und herausgegeben.
Der Verfasser hat die Ergebnisse der in den vergangenen 170 Jahren
erfolgten geologischen Erforschung des Hunsrücks und seine eigenen
Erkenntnisse ausgewertet und zusammengefasst. Abgesehen vom
einleitenden Teil, in dem im Wesentlichen ein knapper Überblick über
den geologischen Werdegang des Hunsrücks und seine geotektonischen
Einheiten gegeben wird, spiegeln die folgenden Teile 2 bis 6
umfassend den aktuellen Stand der Wissenschaft wider. Der Fokus liegt auf
der Lithologie und Stratigraphie der paläozoischen Schichtglieder,
neue Daten zur Schichtenfolge wurden in die plattentektonischen
Vorstellungen eingepasst.
Im fast 250 Seiten umfassenden Teil 2 wird die erdgeschichtliche Entwicklung des Hunsrücks im Zeitraum Devon bis Unterkarbon ausführlich beschrieben, auch auf die im südöstlichen Hunsrück in den jüngeren Gesteinsverband eingeschuppten „Aufbrüche“ aus dem frühkambrischen oder noch älteren kristallinen Untergrund wird eingegangen. Der Schwerpunkt der Beschreibung der Geologie des Hunsrücks liegt auf dem tektonischen Baustil dieses Gebirges, den Schichtfolgen des Devons und Unterkarbons, ihrer statigraphischen Stellung, ihrer faziell differenzierten Lithologie, ihres
Fossilinhaltes, auf Erzlagerstätten sowie auf dem teilweise metamorph
überprägten devonischen und unterkarbonischen Magmatismus mit seinen
unterschiedlich alten basischen bis intermediär/sauren Vulka-
niten. Außerdem stellt der Autor Gesteinskomplexe vor, die zeitlich
nicht genau eingestuft werden können wie u. a. die Metamorphe Zone am Südostrand des Hunsrücks, deren Gesteine im Gegensatz zum gleichnamigen Schichtenkomplex am Südrand des Taunus mit ihren primär silurischen und ordovizischen Serien vom Verfasser ins Devon datiert werden.
Der ähnlich umfangreiche Teil 3 geht näher auf die variszische Tektogenese ein. Dabei liegt der Fokus auf der Beantwortung der Frage, ob neben Schuppentektonik auch alpinotyper Deckenbau mit tief im Gebirge
liegenden Scherbahnen vorliegt. Nach Analyse des tektonischen Kleingefüges, des internen Baus der tektonischen Großstrukturen des Hunsrücks, der abgeleiteten Druck-/Temperaturbedingungen in den deformierten Schichtfolgen und des Ablaufs tektonischer Großereignisse im Hunsrück im Kontext mit der Plattentektonik schließt der Verfasser im Gegensatz zu anderen Geologen Deckentektonik aus. Auf tektonische Ereignisse gehen auch die zahlreichen variszischen und z. T. auch postvariszischen Erz- und Quarzgänge im Hunsrück zurück, deren Typus, Entstehung, Vorkommen und frühere wirtschaftliche Bedeutung beleuchtet werden.
Teil 4 informiert über die spätvariszischen Vorgänge im
Oberkarbon und Rotliegend im Hunsrück, der nach seiner Heraushebung
aus dem jetzt geschlossenen Rheinischen Ozean im orographischen Sinne
zu einem Gebirge geworden war. Die angefallenden Schuttmassen wurden
in neu entstandenen intramontanen Senken abgelagert. Während vermutlich oberkarbonische Schichten nur bei Düppenweiler/Saarland nachgewiesen worden sind, streichen Rotliegend-Schichten hauptsächlich in der sich seit dem Oberkarbon abzeichenden Saar-Nahe-Senke am Südrand des Hunsrücks aus, mit wesentlich geringerer Mächtigkeit auch an seinem Westrand und in der Wittlicher Senke. Die Formationen der Glan-Subgruppe (Unterrotliegend), die nur in der Saar-Nahe-Senke vorkommt, und Nahe-Subgruppe (Oberrotliegend) werden ausführlich beschrieben und ebenso der zu Beginn des Oberrotliegend speziell in der Saar-Nahe-Senke aufgetretene basische, intermediäre und saure Magmatismus mit unterschiedlicher Mineralisation und Erzlagerstätten. Die Vorkommen dieser Tiefen- und Ergussgesteine, ihre Genese und ihr Chemismus werden detailliert vorgestellt und ebenso die tektonischen Prozesse, die im ausgehenden Paläozoikum die geologische Entwicklung des Hunsrücks und seiner Umgebung steuerten.
In Teil 5 liegt der Fokus zunächst auf der Beschreibung der Schichtfolgen der Trias und des Unteren Jura. Damals war der eingerumpfte Hunsrück ein Hochgebiet und wurde nur an seinem Westrand überflutet. In den etwa 200 Millionen Jahren als „Rheinische Insel“ entwickelte sich aus den devonischen Schichten in einem warm-humiden Klima eine z. T. mehr als 100 m mächtige, heute nur noch teilweise erhaltene Verwitterungsdecke. Im Saprolit an seiner Basis kam es zu Bildung der „Hunsrückerze“, nicht zu verwechseln mit den im Unteroligozän gebildeten „Soonwald-Erzen“. Da der Hunsrück zu dieser Zeit nur knapp über dem Meeresspiegel lag, kam es über tektonisch vorgegebene schmale Senken zeitweise zu Meeresingressionen. An seinem Südostrand haben alttertiäre Sedimente dagegen eine größere Verbreitung und leiten in die gut untersuchten Serien am Nordrand des Mainzer Beckens über. Eine weitere marine Transgression erreicht im Untermiozän den Südost-Rand des Hunsrücks, es handelt sich um die fossilienreichen Karbonatgesteine der Mainz-Gruppe.
Der letzte Teil 6 befasst sich mit
der geologischen Geschichte des Hunsrücks ab dem Jungtertiär. Seit dem
Obermiozän wird das Gebirge herausgehoben, es gab aber immer wieder
tektonische Stillstandsphasen. Das Ergebnis ist eine alters- und
höhenmäßig mehrgliedrige Terrassenlandschaft in den Tälern der den
Hunsrück umrandenden Flüsse und der ihnen tributären Fließgewässer. Der Verfasser geht detailliert auf die Niveaus von Trogtal mit Relikten von alten Talböden aus dem Obermiozän bis Pliozän, tieferliegendem Plateautal mit den alt- bis mittel-pleistozänen Hauptterrassen und seit etwa 800.000 Jahren bestehendem cañonartigem Engtal mit den aus dem Mittel- bis Spätpleistozän stammenden Mittel- und Niederterrassen ein. Außerdem werden
Ablagerungen von Löss bzw. Lösslehm und periglaziale Deckschichten
beschrieben, die ebenso wie Blockmeere und Schuttströme während der
pleistozänen Kaltphasen des Pleiszäns gebildet wurden. Moore und
Hochflutlehme in den Talauen entstanden im Holozän.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beschreibung und Deutung der postvarizischen Tektonik, zumal diese im Hinblick auf die Entstehung der heutigen Landschaft eine maßgebende Rolle spielt. Beleuchtet werden die
zahlreichen tektonischen Gräben und Horste sowie die Aktivierung alter und Entstehung neuer Störungen. Besondere Aufmerksamkeit erfährt die Taunus-Südrand-Verwerfung. Die jungen tektonischen Verstellungen der Erdkruste steuern auch die Prozesse der Mineralisierung und Bildung von Gangerzen und das Auftreten von in der Regel kalten Mineralwässern. Deren Vorkommen, Genese sowie physikalische und chemische Eigenschaften werden dargestellt.
Nach den fachlichen Ausführungen in den Teilen 1 bis 6 folgen ein 50 Seiten und fast 2250 Quellenangaben umfassendes Literaturverzeichnis, in dem sich die Ergebnisse der Mitte des 19. Jh. einsetzenden geologischen Erforschung des Hunsrücks widerspiegeln, eine Fossilienliste, ein Sach- und ein Ortregister.
Dieses moderne Standardwerk zur Geologie des Hunsrücks
kostet im Handel fast 80 Euro. Da es den neuesten Stand der Wissenschaft präsentiert, hierzu eine Fülle von Informationen liefert und der Werdegang des geologisch kompliziert aufgebauten Hunsrücks seit den vergangenen rd. 550 Millionen Jahren fachlich überzeugend dargestellt wird, ist diese regionale Monographie über die Geologie dieses deutschen Mittelgebirges seinen Preis wert. Gemessen an anderen Fachbüchern schwächelt dieses Buch im Hinblick auf modernes Textdesign und graphischer Ausgestaltung allerdings etwas, viele Fakten-Wiederholungen könnten den Leser ermüden, mehr Abbildungen wären wünschenswert gewesen. Insgesamt wird der Kauf dieses Buches empfohlen, es ist für Geowissenschaftler eine Schatzgrube an
wertvollen Erkenntnissen, die für die eigene Arbeit nützlich sind.
Benedikt Toussaint