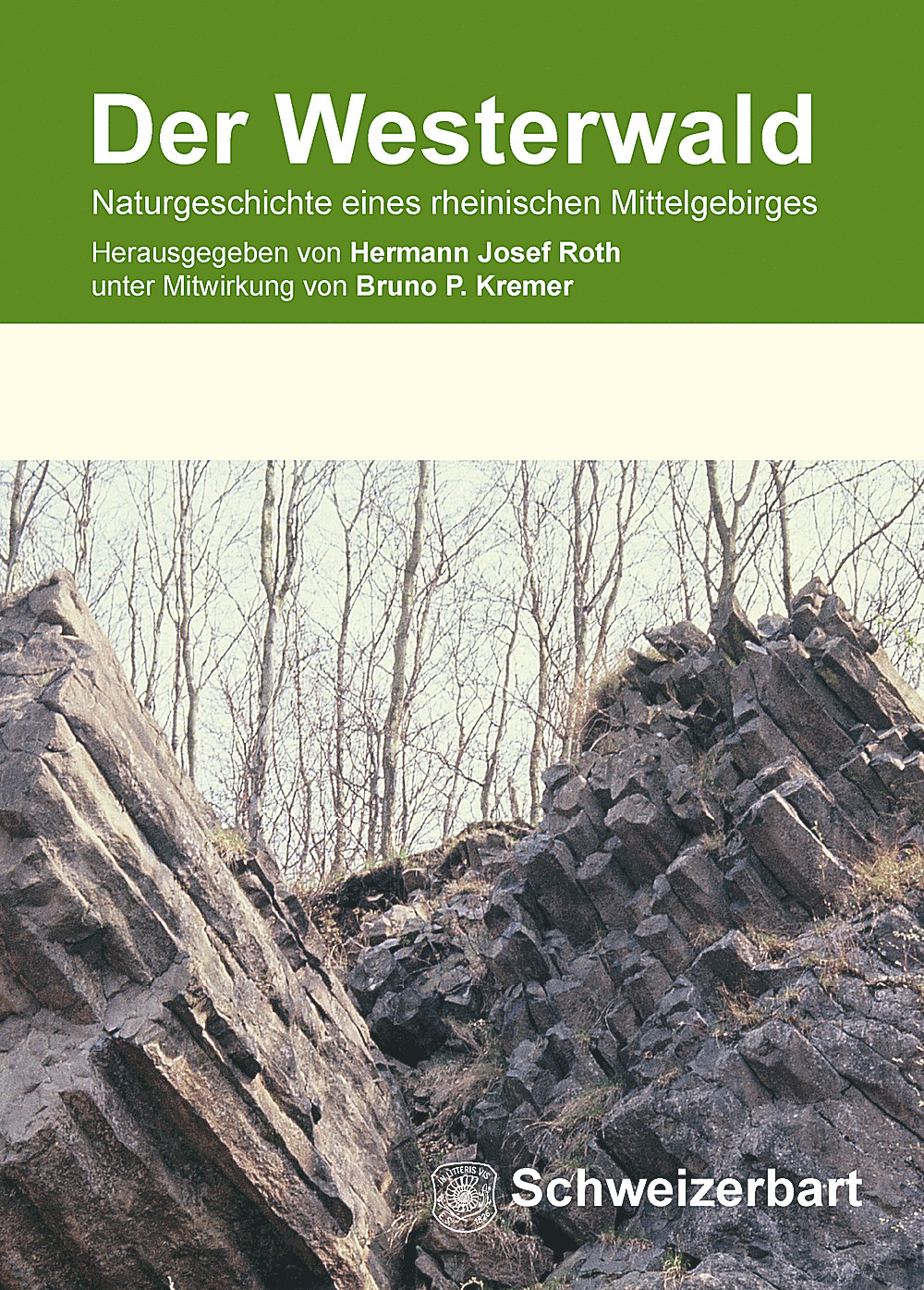Herausgegeben wurde das Grundlagenwerk von dem profunden
Westerwaldkenner Hermann Joseph Roth unter Mitwirkung von Bruno
P. Kremer aus Linz und weiteren Fachleuten. Der Sammelband darf sich
rühmen, die erste das Gesamtgebiet des Westerwaldes umfassende
„Naturgeschichte“ zu sein. Die Autoren hoffen jedoch auf daran
anschließende Forschungen.
Roth und Kremer sprechen bewusst von „Naturgeschichte“ oder
„Naturkunde“ und stellen der üblichen Spezialisierung einen
interdisziplinären Ansatz entgegen. Dabei haben sie die herkömmliche
Sammelbezeichnung eingeengt auf Lebens- (Botanik, Zoologie) und
Erdwissenschaften (Geologie, Paläontologie), samt Hinweisen auf
mineralogische und klimatische Erscheinungen sowie ökologische
Zusammenhänge.
Eine Karte aus dem 11. Jahrhundert bezeichnet mit „Westerwald“ ein
paar Länder westlich des Königshofes von Herborn. Seit mehr als
hundert Jahren wird der Westerwald als Schiefergebirgsflügel zwischen
den Flüssen Rhein, Sieg, Lahn und Dill kartiert. Der westliche oder
„Rheinwesterwald“ ist ein rund 40 Kilometer langes Talterrassenband
des Rheins sowie sein angrenzendes Hinterland vom Siebengebirge bis
zum Rheintal. Der Vorderwesterwald schließt das wellige Hochland
zwischen dem Rheinwesterwald im Westen, dem Siegtal im Norden, dem
Oberwesterwald im Osten und dem Montabaurer Westerwald im Süden
ein. Zum südlichen oder Unterwesterwald gehört auch das rund 120
Quadratkilometer große, bedeutende Kannenbäckerland.
Ton, das „Weiße Gold“ verlieh der Region zwischen Höhr-Grenzhausen und
Staudt ihren Namen. Die Tone sind aus der Verwitterungsrinde des
Unterdevons hervorgegangen. Die devonischen Ablagerungen hat den
Westerwald zu einem der klassischen Gebiete für die geologische
Devonforschung werden lassen, reiche Fossilfunde wie die berühmte
„Stöffelmaus“, das „Kohlenschwein“ oder Nashornteile ergeben ein
lebendiges Bild. Zudem hatte die Region mineralische Lagerstätten wie
die Siegerländer Spateisensteine, die abgebaut wurden. Von der A3 aus
gut sichtbar ist noch der Förderturm der Grube Georg bei Willroth.
Bei der Betrachtung der Klimadaten spricht Roth mit Blick auf das
ständig zitierte Marschlied vom kalten Wind von „meteorologischem
Rufmord“, da der Westerwald im Vergleich zu anderen mittelrheinischen
Gebirgen gut abschneidet. Auch bioklimatisch wird der größte Teil als
reizmild bis schonend gesehen, nur die höchsten Teile gelten als
reizstark, die Tallandschaften von Rhein und Lahn als teils
belastend. Der Klimawandel hat auch den Westerwald erfasst, man
rechnet mit einer Erhöhung der durchschnittlichen
Jahresmitteltemperaturen von 1,5 bis 5,0 Grad bis Ende des
Jahrhunderts. Flora und Vegetation haben in den letzten zehn Jahren
dramatische Veränderungen erfahren, intensive Land- und
Forstwirtschaft ließen viele Pflanzen und nachfolgend auch Tiere
verschwinden. Buchenwald stellt die wichtigste Waldgesellschaft dar.
Sämtliche Gewässer streben dem Rhein zu, die Wied ist mit 102
Kilometern vom Quellgebiet auf der Westerwälder Seenplatte bis zur
Mündung in Neuwied der längste Wasserlauf. Die von Menschen angelegten
Fischteiche der Westerwälder Seenplatte bieten feuchteliebenden
Pflanzen- und Tiergesellschaften Lebensraum. Insbesondere eine
reichhaltige Vogelwelt ist zu sehen. Floristische Besonderheiten wie
das Alpen-Hexenkraut, der Französische Streifenfarn, der Lungenenzian
oder das atlantische Torfmoos erfreuen Botaniker.
Der Westerwald zeichnet sich durch eine kulturhistorisch bedingte
Vielfalt der Grünlandgesellschaften aus, die in Eifel und Hunsrück
nicht erreicht wird. „Die Arnika besitzt an der Fuchskaute ihre
größten Vorkommen im gesamten Rheinischen Schiefergebirge.“
Besonderheiten wie das Katzenpfötchen oder die Sparrige Binse sind
allerdings als Folge der Forstwirtschaft verschwunden. Wärmeliebende,
submediterrane Pflanzen findet man insbesondere im Mittelrheintal,
Lahntal und den Seitentälern: zum Beispiel Elsbeere, Franzosenahorn,
Bocks-Riemenzunge und Helmknabenkraut.
Die Westerwälder Wirbeltierfauna ist durch die vorhandene Pflanzenwelt
infolge der Böden und des Klimas bestimmt. In den artenreichen
Mischwäldern leben Fledermausarten, Wildkatze, Baummarder und
Siebenschläfer. Die wärmebegünstigten Flusstäler, Tongruben und
Steinbrüchen bieten Zaun-, Mauereidechse und Schlingnatter
Lebensraum. Für den Westerwald sind mindestens 455 Wirbeltierarten
belegt, davon sind 70 Prozent Vögel. Mehrere Wölfe, ein einzelner
Biber sowie eine Hufeisennase konnten nach etlichen Jahrzehnten
Abwesenheit wieder entdeckt werden. Der Westerwald wurde 2018 zum
ersten Wolfspräventionsgebiet für Rheinland-Pfalz ausgewiesen.
Naturkundliche Forschungen wurden durch die Landeshochschule der
Grafschaft Nassau-Dillenburg, die „Hohe Schule zu Herborn“ (1584-1817)
begünstigt. Roth portraitiert Otto Brunfels, Johann Jakob Dillenius,
Johann Daniel Leers, Catharina Helena Doerrien, Johann Philipp
Sandberger, Maximilian Prinz zu Wied und andere verdienstvolle
Forscher. Der Autor betont die Wichtigkeit der naturkundlichen
Vereinigungen für die Erforschung des Westerwaldes. Die Region war
wiederholt Namensgeber für Gesteine und Versteinerungen wie die
„Ems-Schichten“.
Ein naturkundliches Literaturverzeichnis, ein Register und eine
Vorstellung des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und
Westfalens (NHV) schließen das Werk ab.
Das 187-seitige, facettenreiche Buch enthält 130 Abbildungen und neun
Tabellen und gehört zwingend in die Hand jedes Natur- und
Westerwald-Freundes.
Helmi Tischler-Venter