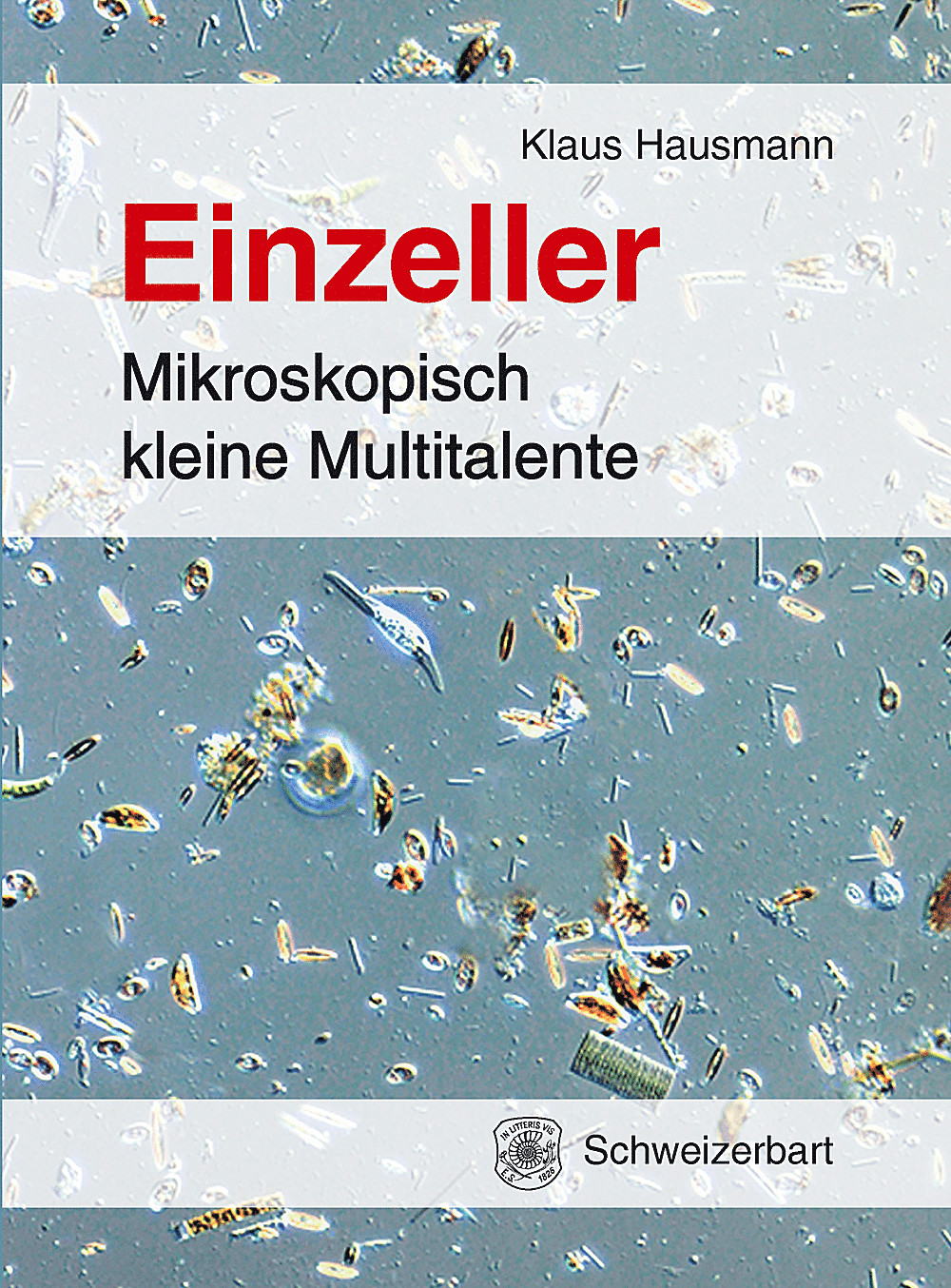Oft kommt es nicht vor, dass auf Deutsch ein neues Buch über
Einzeller erscheint. Doch jetzt hat der renommierte, fast 200 Jahre alte
Schweizerbart Verlag aus Stuttgart, der so bekannte Werke wie „Das
Phytoplankton des Süßwassers“ („Huber-Pestalozzi“) herausgebracht
hat, den Mut gehabt, eines auf den Markt zu bringen. Mut, weil der
potenzielle Leser- und Käuferkreis vermutlich nicht groß ist, zumal ein
deutscher Titel die anglophone Welt nicht erreicht. Aber vielleicht wird
das Buch ja später noch übersetzt.
Autor des Buches ist der bekannte Wissenschaftler Dr. Klaus Hausmann,
emeritierter Professor für Zoologie/Protozoologie der Freien Universität
Berlin. Hausmann veröffentlichte 1985 gemeinsam mit Maria Mulisch,
Wissenschaftlerin an der Universität Köln, auf Deutsch das Buch
„Protozoologie“ (Thieme-Verlag), das einige Jahre später auf Russisch
und Japanisch übersetzt wurde. 1996 folgte eine zweite überarbeitete englische Auflage unter dem Titel „Protozoology“, gemeinsam mit seinem Kollegen Norbert Hülsmann von der Freien Universität. Mit der 3. Auflage 2003 wurde das Werk erweitert zu „Protistology“, da es nicht mehr nur die Protozoen, sondern auch die
Protophyten behandelte. Als dritte Autorin kam Renate Radek, ebenfalls
Freie Universität Berlin, hinzu. Der Verlag wechselte von Thieme zu
Schweizerbart, wo das Buch noch erhältlich ist.
Nun also eine neue Veröffentlichung von Hausmann. Die Idee, ein populärwissenschaftliches Buch über Einzeller zu verfassen, kam ihm
in Ägypten auf einer mehrwöchigen Nil-Fahrt in Gesprächen mit einem
Mitreisenden und Tischnachbarn, bei denen er feststellte, wie wenig
andere Menschen über die Wunderwelt dieser kleinen Wesen wissen. Es
war eine gute Idee!
Hausmann hat verständlicherweise viele Abbildungen und Fakten
aus seinem Werk „Protistology“ übernommen, aber dennoch ist sein
neues Buch ein völlig anderes geworden, da es sich nicht an
Studierende und Wissenschaftler wendet, sondern an alle, die
etwas über diese Wunderwelt erfahren möchten. Deshalb gibt es Kapitel,
die in dem Lehrbuch nicht vorkommen. „Einzeller“ ist in einer gut
lesbaren Sprache geschrieben, da Hausmann das Talent hat –
und immer auch die Prise Humor –, die oft komplizierten
Sachverhalte verständlich darzulegen.
Das Buch ist in zwölf Kapitel gegliedert, die im Schnitt nur knapp 15
Seiten umfassen. Es kam Hausmann also nicht auf eine umfassende
Darstellung an, sondern auf einen prägnanten Überblick, weshalb das
Buch auch nur den halben Umfang seiner „Protistology“ hat.
Vorab wird erläutert, dass das Buch nur von freilebenden Protisten (Einzellern) handelt, also nicht von Prokaryoten (Bakterien und Archaeen). Allerdings tauchen ein paar Mal die Cyanobakterien auf, die die Fotosynthese erfunden haben. Das Buch behandelt nicht eukaryotische Krankheitserreger, von denen ich persönlich die Amöbenruhr verursachende Entamoeba histolytica aus meiner Afrika-Zeit in bitterer Erinnerung habe.
Hausmann erläutert, warum er nicht mehr die Begriffe Protozoen und Protophyten für die von ihm behandelten Einzeller verwendet, sondern Protisten. Er begründet es damit, dass eine Abgrenzung dieser beiden
Gruppen kaum mehr gelingt und somit nicht sinnvoll ist. Viele
Hobby-Mikroskopiker und Tümpler werden zustimmend nicken, wenn sie schon einmal auf farblose, sich heterotroph ernährende Euglenophyceen („Augentierchen“) gestoßen sind.
Nach einer Einführung in die Geschichte der Mikroskopie, bei der
der begnadete „Dilettant“ Antoni van Leeuwenhoek und der „Visionär“ Christian Gottfried Ehrenberg (Bezeichnungen von Hausmann)
natürlich nicht fehlen, und einem Überblick über die Mikroorganismen
folgen Kapitel über Lebensräume, Morphologie, Bewegung, Nahrungserwerb, Verdauung und Ausscheidung, Vermehrung, Orientierung in der Umwelt
und über die Verbreitung der Protisten. Abschließend wird auf die
Einzeller als Baumeister und Vorlagen für Bioniker und Künstler eingegangen sowie die Erschließung von Einzellern für breitere Volksschichten.
In diesem letzten Kapitel wird kurz auf Mikroskopische Vereinigungen, Internet-Foren und die Zeitschrift „Mikroskopie“ hingewiesen. Da hätte
ich mir ein paar konkrete Links und Adressen gewünscht.
Ich möchte im Folgenden auf einige spannende Fakten aus den eben genannten Kapiteln eingehen, um eine Idee zu dem Buch zu vermitteln und zum Lesen anzuregen.
Was Lebensräume angeht, ist über das Benthos, also die am Boden
lebenden Organismen, und das Plankton Vieles bekannt (Abb. 1).
Aber das Aeroplankton, also die in der Luft schwebenden Keime, sind
noch wenig erforscht. Genauso wenig weiß man zum Beispiel auch,
warum Pansen-Ciliaten oft so wehrhaft geformt sind. Eine biologische
Erklärung dafür gäbe es nicht, schreibt Hausmann. Ebenso wenig ist
darüber bekannt, Hausmann hat dafür nur ein Achselzucken, warum auf
der Oberfläche eines Flohkrebses, säuberlich getrennt, an verschiedenen
Stellen verschiedene Ciliatenarten siedeln. Mich erinnert das an
Kopf- und Filzläuse, die sich aus dem Wege gehen und die Haare der anderen
Art meiden, selbst wenn nicht beide Arten gleichzeitig auf einem Körper
leben. Für mich sind eigentlich Haare gleich Haare.
An dieser Stelle sei bereits gesagt, dass ich überrascht war, in quasi
jedem Kapitel mindestens einmal den Satz zu finden, dass diese oder
jene Tatsache nicht erforscht oder bekannt ist. Ich hätte das in der
Häufung nicht erwartet, zumal es bisweilen ganz simple Tatbestände sind,
die noch auf Erforschung warten. Einige Beispiele solch unerforschter
Sachverhalte werden im weiteren Textverlauf gegeben.
Hausmann teilt die Protisten gemäß ihrer Baupläne in vier Gruppen
ein: Amöben, Flagellaten, Ciliaten und Sporozoen. Letztere, da
ausschließlich Parasiten, werden nicht behandelt. Bei dieser Einteilung
stellt sich unmittelbar die Frage, ob unbegeißelte, einzellige Algen nicht
zu den Protisten gerechnet werden. Auf eine Rückfrage beim Autor
antwortete dieser: „Die ‚Mikroalgen‘ werden unter die Flagellaten
subsumiert, da bei diesen Protisten vielfach im Lebenszyklus begeißelte
Stadien auftreten, wie zum Beispiel bei Diatomeen.“ Das hätte im Buch
erläutert werden sollen, denn es erschließt sich nicht automatisch, dass
zum Beispiel Diatomeen zu den Flagellaten gerechnet werden.
Bei den Bauplänen wird ein kleiner Exkurs auf den von mir als
Entomologen sehr geschätzten Johann Rösel von Rosenhof gemacht, der
als erster Amoeba proteus beschrieb und in Band 3 der
„Insekten-Belustigung“ von 1755 auf einer Tafel abbildete (Abb. 2). Mir waren bis dato nur die Insektenabbildungen bekannt. Ebenso neu war mir,
dass die Panzer der Dinoflagellaten nicht auf dem Organismus liegen,
wie man meint, wenn man sie im Mikroskop betrachtet, sondern unter der Plasmamembran. Es ist also eine intrazelluläre Panzerung (Abb. 3).
Gleiches gilt für das Tonnentierchen Coleps hirtus.
Die Arten der Bewegung bei Amöben, einigen Eugleniden und bei
vielen Organismen durch Geißeln, Cilien und Cirren oder
Schleimabsonderung (Abb. 4) sind hochkomplex und – wie sollte es anders
sein – auch noch nicht in allen Aspekten verstanden. Welchen biologischen
Sinn die zufällig wirkenden Bewegungen bei Kieselalgen haben, fragt
sich die Wissenschaftsgemeinde auch. Hausmann betont an dieser
Stelle, dass bei Trompeten- und Glockentierchen vermieden werden
sollte, von Stielmuskeln zu sprechen, da diese Struktur keine Ähnlichkeit
mit der Funktionsweise von Muskeln hat. Er weist in diesem Kapitel und
anderen darauf hin, dass alle solch komplexen Eigenschaften,
Strukturen und Verhalten in einer einzigen Zelle verwirklicht sind.
Ebenso faszinierend wie die Fortbewegung ist der Nahrungserwerb.
Auch dieser ist wiederum in vielen Aspekten unverstanden. Wenn zum
Beispiel ein Pantoffeltier in die Nähe von Amoeba proteus kommt, bleibt es wie gelähmt liegen, die Amöbe kann es in Ruhe umfließen und
sich mit dem Verzehr Zeit lassen (Abb. 5). Erst wenn es zu spät ist,
setzen Fluchtbewegungen des Pantoffeltiers ein. Vermutlich wird von
der Amöbe eine toxische Substanz abgegeben, allerdings nur, wenn
es sich um eine potenzielle Beute handelt. Wie erkennt sie das?
Lähmung erfolgt nicht nur, wie bei der Amöbe, durch abgegebene toxische
Stoffe. Es werden von vielen Einzellern auch Pfeile ausgeschleudert,
Trichocysten, manche davon mit kalzifizierten und vielleicht
vergifteten Spitzen (Abb. 6). Sie gehören zur Gruppe der Extrusomen,
die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Sie können nach Gebrauch
schnell wieder nachgebildet werden. Bilder von Trichocysten-ausschleudernden
Organismen erinnern an mittelalterliche Schlachten mit Pfeil und Bogen.
Aber wie wird bei den Einzellern die Kraft entwickelt, um diese Pfeile
abzuschießen?
Dass so vieles noch nicht bekannt ist, liegt nach Hausmann an den sehr begrenzt zur Verfügung gestellten Forschungsmitteln, mit der Folge, dass es auch nicht mehr die entsprechenden Forscherinnen
und Forscher gibt. Selbst viele Biologen, die in den entsprechenden
Kommissionen zur Mittelvergabe sitzen, wüssten nichts von diesen
spannenden Dingen und meinen vermutlich, dass das alles wenig Relevanz
für den Menschen hat.
Nach dem Fressen kommt die Verdauung. Auch die ist komplizierter als gedacht, aber wenigstens bei Paramecium eingehend untersucht.
Und was vorne rein geht, muss auch hinten wieder raus, zumindest das,
was nicht verwertet werden kann. Dafür gibt es bei einer Reihe von
Ciliaten an einer bestimmten Stelle sogar eine Art After mit einer
Defäkationsvakuole.
Interessant sind auch die Arten des Nahrungserwerbs. Beuteorganismen
werden umschlossen, herangestrudelt, verschlungen, ausgesaugt. Aber
wie funktioniert Saugen, wenn die Zelle einen Innendruck hat?
Nach dem Essen, der Verdauung und Ausscheidung kommt nicht die
Moral, sondern die Vermehrung. Gemeinhin meint man, alles passiert
durch Zweiteilung. Das wäre auf Dauer genetisch nicht vorteilhaft.
Deswegen haben schon die Einzeller die Sexualität erfunden, entweder
durch Gameten und Gamonten oder den faszinierenden Vorgang der
Konjugation von zwei Organismen, die sich mit ihren Mundbereichen
aneinanderlegen und Micronuclei austauschen. In allen diesen Fällen gibt
es eine Reduktionsteilung (Meiose), die Voraussetzung für echte
Sexualität. Aber mit der Sexualität kam auch der Tod.
Wenn die koloniale Volvoxkugel (es ist kein Mehrzeller!) ihre
Tochterkugeln entlässt, stirbt sie. Volvox ist –
pathetisch gesagt – die Alge, die den Tod erfand (Abb. 7).
Was Bewegungsvorgänge betrifft, geht Hausmann auf Fototaxis,
Chemotaxis, Mechanotaxis, Gravitaxis (Schwerkraft), Thermoresponse
und Galvanotaxis ein, schreibt aber auch: „Man kann allerdings nicht
jedes Verhalten vom Einzeller als Antwort auf einen äußeren Reiz
interpretieren. Ciliaten sind in gewissen Grenzen durchaus zu spontanen
Verhaltensäußerungen befähigt.“
Das haben bestimmt schon viele Hobby-Mikroskopiker gedacht, wenn
sie Einzeller im Mikroskop beobachteten.
Was die Verbreitung der Protisten angeht, sind sie zwar einerseits
Kosmopoliten, andererseits ist es falsch anzunehmen, dass es alle Ar-
ten überall gibt. Und unter den Protisten kommen auch endemische
Arten vor. Bromelien haben zum Beispiel mit Wasser gefüllte
Blattachseln, in denen Arten zu finden sind, die es nur hier gibt.
Was Einzeller als Baumeister angeht, hat der berühmte Biologe und
Künstler Ernst Haeckel sie in seinen „Kunstformen der Natur“ verewigt.
Aber auch Bioniker, wie der kürzlich verstorbene Prof. Nachtigall, der in
dieser Zeitschrift viele spannende Artikel veröffentlicht hat, und
Künstler haben immer wieder ein Auge auf diese Wunderwerke geworfen.
Bioniker versuchen, sich von den technischen Lösungen der Einzeller
etwas abzuschauen und in die Menschenwelt zu übertragen, und sei es
auch nur eine Autofelge nach einer Diatomee (Abb. 8). Und das
monumentale Eingangstor zur Pariser Weltausstellung im Jahr 1900
wurde einer Radiolarie nachempfunden (Abb. 9). Künstler fertigen bis heute
Schmuckstücke nach Einzellern und Schriftstellerinnen schreiben
Kinderbücher mit Einzellern als Protagonisten (Abb. 10).
Zum Schluss noch einige Details zum Buch. Es ist auf sehr gutem
Papier gedruckt und durchgehend schwarz-weiß und farbig in
hervorragender Qualität bebildert. Es ist in einen festen Einband gebunden und hat sogar ein hellblaues Lesebändchen. Was mir noch auffiel, ist der
nahezu fehlerfreie Text. Da ich selbst schreibe, weiß ich aus leidvoller
Erfahrung, dass, auch wenn man einen Text immer wieder liest und andere
auch, sogar eine Lektorin oder ein Lektor, sich doch Fehler
einschleichen. Ich habe im ganzen Buch nur zwei Fehler entdeckt.
Selbst wenn es ein paar mehr sein sollten, ist das eine hervorragende
Quote. Das Buch verfügt über ein gut gemachtes Glossar und einen Index. Die Bildquellen sind in einem Anhang angegeben.
Man findet neben Hausmann, der sehr viele Abbildungen und Bilder
von Mikroorganismen beigesteuert hat, auch eine Reihe Namen von
Hobby-Mikroskopikern, die mit ihren Bildern in den entsprechenden
Foren oder durch ihre Webseiten bekannt sind. Etwas schmal mit einer Seite ist das Literaturverzeichnis ausgefallen. Hier hätte ich mir ein
paar mehr Hinweise auf Bücher gewünscht, die sich mit der Technik der
Mikroskopie und der Bestimmung von Mikroorganismen beschäftigen,
wie zum Beispiel die beiden Bücher von 2020 und 2022 „Faszination
Mikroskopie“ von W. Nachtigall, J. Piper und F. Fox aus dem
Hachinger-Verlag oder das, wenn auch teure, so doch umfassende und
aktuelle Buch „The Freshwater Algal Flora of the British Isles“ von David
M. John und Kollegen, das nicht nur für die Britischen
Inseln relevant ist.
Mein Fazit zu dem Buch von Hausmann: Kaufen, lesen, weiterempfehlen!
Dr. Stephan Krall
stephan.krall@t-online.de