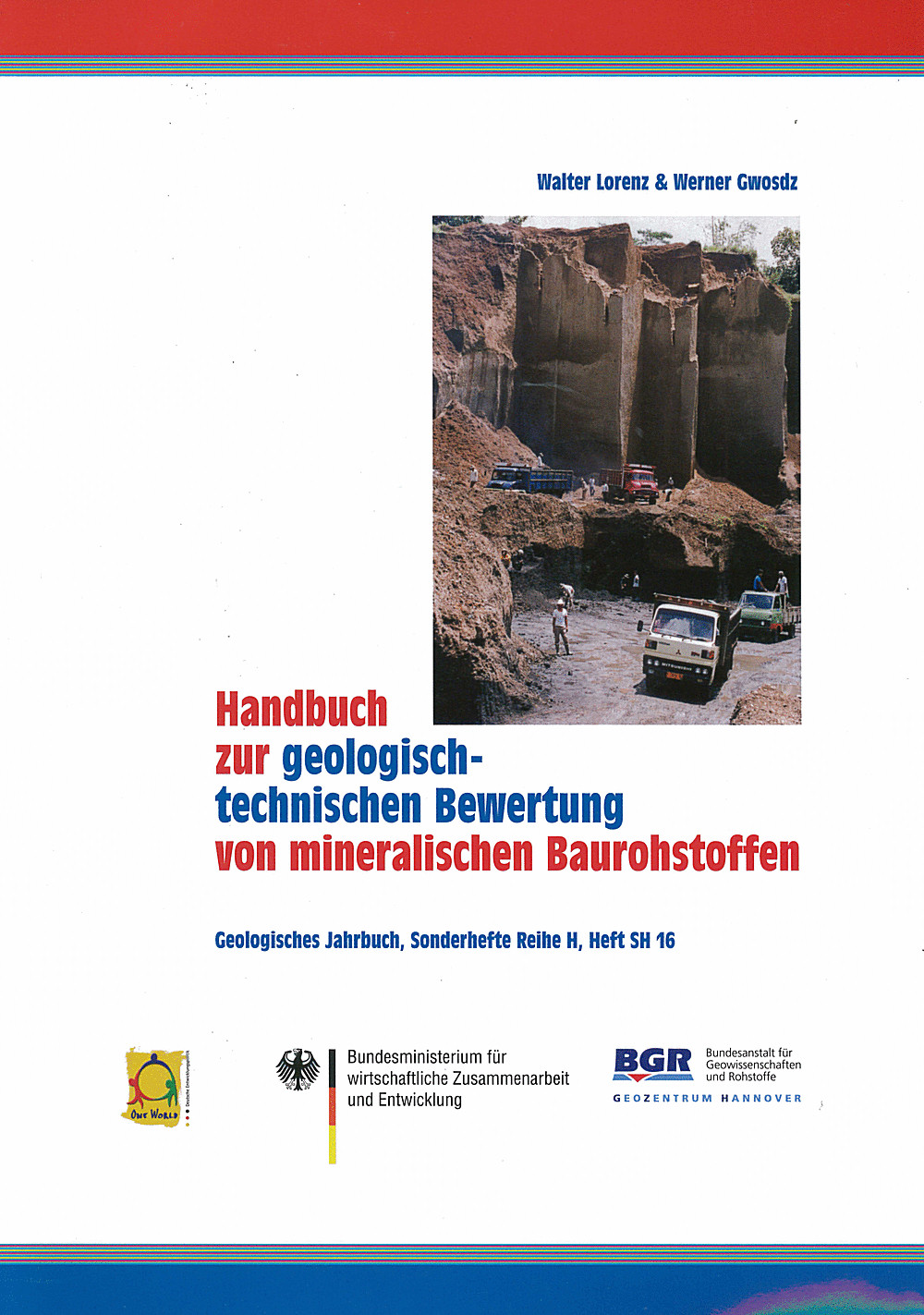Das Handbuch zur geologisch-technischen Bewertung von mineralischen
Baurohstoffen entstand im Rahmen des Sektorprojektes Systematische
Abdeckung von Know-how-Defiziten auf dem Geosektor mit
Entwicklungsländern, gefördert vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Da Baurohstoffe
zum Auf- und Ausbau der Infrastruktur eines Landes dringend
erforderlich sind, ist ihre Erkundung und Nutzbarmachung in modernen
Industrienationen und in Entwicklungsländern von großer Bedeutung. Je
nach Nutzung, z. B. für gemeinnützige Zwecke wie die Errichtung
bzw. Fortführung eines Verkehrsund Kommunikationswesens, die
Errichtung von Energieversorgungs-Anlagen, Kindergärten, Schulen,
Universitäten, Sportanlagen, Seniorenheimen und Krankenhäusern oder
für private Zwecke, benötigt man ziemlich unterschiedliche Baustoffe
aus ganz verschiedenartigen Baurohstoffen.
In Entwicklungs- und Schwellenländern fehlen häufig die
Voraussetzungen zur Nutzbarmachung heimischer Rohstoffe. Diese Aufgabe
fällt dann häufig in die Hände von Geologen, Bauingenieuren,
Regionalplanern aus dem Ausland. Dieses nutzerorientierte Sonderheft
soll dem genannten Personenkreis eine wichtige Entscheidungshilfe
sein. Da mineralische Rohstoffe überall auf der Welt in ganz
unterschiedlichen Mengen und Formen vorkommen und für ganz
unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, liefert dieses Sonderheft
Anforderungsprofile der wichtigsten Baurohstoffe. Hier werden
geologische und technische Bewertungskriterien für den jeweiligen
Gebrauch vorgestellt. Neben diesen Informationen ist ein fachlicher
Austausch zwischen den Geowissenschaftlern und den Ingenieuren zur
Lösung der Probleme vor Ort notwendig.
Aus diesem Grund liegt dieses Handbuch in deutscher Sprache als
Referenz- und Bezugswerk für deutschsprachiges Projektpersonal und in
englischer und spanischer Sprache zur größtmöglichen Verbreitung der
Informationen weltweit vor. Zur weltweiten Verbreitung wird das Heft
entsprechenden Institutionen in Entwicklungsund Schwellenländern zur
Verfügung gestellt, wie z. B. Geologischen Diensten, Universitäten,
technischen Untersuchungs- und Beratungsstellen, privaten
Kooperationen und Organisationen. Das Handbuch liefert, basierend auf
jahrzehntelangen Erfahrungen verschiedener Wirtschaftsgeologen der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in
Entwicklungsländern, auf folgende Fragen ausführliche und gut
verständliche Antworten: 1. Wie bilden sich spezifische Rohstoffe und
wo kommen sie vor? 2. Welche Rohstoffqualität muss vorliegen, um
entsprechende Produkte herstellen zu können? 3. Welche
Gewinnungsverfahren gibt es in Abhängigkeit von der
Rohstoffkonzentration und wie kann der Rohstoff veredelt werden?
4. Welche industriellen Anwendungsmöglichkeiten hat der Rohstoff,
abhängig von seinen qualitativen Eigenschaften?
Der Text ist wie folgt gegliedert: Vorwort, Einleitung,
1. Gesteinskörnungen (Kies, Sand und gebrochener Naturstein);
2. Vulkanische Gesteine und Leichtzuschläge [Bims; Bimsasche; Andere
vulkanische Aschen, Schlacken und Tuffgesteine; Perlit; Basalt; Andere
vulkanische Gesteine (Phonolith, Rhyolith, Ignimbrit)];
3. Naturwerksteine und Dachschiefer; 4. Carbonat- und Sulfatgesteine
(Kalkstein; Dolomitstein; Magnesit; Gips- und Anhydritstein; Baryt
(Schwerspat); 5. Tone [Kaolin und kaolinitische Tone; Feuerfeste Tone
(fire clays, flint clays); Halloysit; Allophan; Illit; Smektite
(Bentonit, Montmorillonit); Hormite; Ziegelton; Lehm]; Blähton,
Blähschiefer; 6. Quarzrohstoffe [(Quarz, Cristobalit und Opal;
Quarzsand und –kies), Quarzsandstein und Quarzit; Diatomit
(Kieselgur); Tripel (Tripoli) und Kieselkreide (Kieselerde); Hornstein
(Flint, Silex u. ä.)], und 7. Umweltschutz; Anhang 1-5.
Die Bewertungskriterien sind geologischer, mineralogischer,
chemisch-physikalischer, wirtschaftlicher und technischer Art. Angaben
zur Lagerstättenbildung, Informationen über mögliche Austauschstoffe
sowie die Darstellung vieler Informationen in Tabellenform wie
bestimmte Rohstoffanforderungen und die Definition bzw. Beschreibung
vieler geowissenschaftlicher und technischer Begriffe, z. T. auch
deren angelsächsische Namen vervollständigen das Handbuch. Die Autoren
fertigten pro Kapitel nicht nur Literaturverzeichnisse an, sondern
listen am Ende Lehrbücher, zusammenf. Darstellungen, Bibliographien
945 des jeweiligen Kapitels eine Auswahl gängiger Normen und Hinweise
auf technische Regelwerke auf. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
amerikanischen, britischen, deutschen und französischen Normen
bzw. technischen Regelwerken. Ein Glossar erklärt die wichtigsten
Begriffe aus dem Straßenbau.
Das letzte Kapitel ist dem Umweltschutz gewidmet. Es stellt die
Umweltschutz- Minerale vor. „Umweltschutz-Minerale sind diejenigen
behandelten oder unbehandelten mineralischen Materialien, durch deren
gezielten Einsatz positive Auswirkungen auf die Umwelt erreicht werden
können.“ Beispiele sind Bentonit, Dolomitstein, Kalkstein, Kreide,
Bims, Bimsasche und Lavaschlacke. Kalkstein spielt u. a. eine
wichtige Rolle bei der Rauchgasentschwefelung. Er bildet bei der
Rauchgaswäsche große Mengen an REA-Gips. Der ist so rein, dass er den
natürlichen Gips in der Bauwirtschaft großteils ersetzen kann.
Auf S. 74 wird die Eignung von Müllverbrennungsaschen (MVA) in der
Bauindustrie vorgestellt. Im Text ist angegeben, MVA könnte man als
Frostschutzschichten für den Straßenbau, als Tragschicht unter
Pflasterdecken und Plattenbelägen von Geh- und Radwegen
verwenden. Werden die Aschen als Frostschutzschicht eingebracht, muß
man bestimmte Parameter bezüglich Zusammensetzung unbedingt
einhalten. „MVA dürfen keine Bestandteile in schädlichen Mengen
enthalten, die quellen, zerfallen, sich lösen oder chemisch
zersetzen. Im übrigen muß der Metallgehalt kleiner gleich 5
Massenprozent und der Anteil an Unverbranntem kleiner gleich 0,5
Massenprozent sein.“ Diese Vorgaben sind nach eigenen Untersuchungen
der Rez. unzureichend. Die Rückstände aus der physikalischen und
chemischen Rauchgasreinigung von Müllverbrennungsanlagen variieren von
Anlage zu Anlage und von Monat zu Monat (STEFFES-TUN et
al. 1995). Neben umweltrelevanten Schadstoffen wie Schwermetallen und
unterschiedlichen Salzanteilen besitzen viele MVA hydraulische
und/oder latent hydraulische Eigenschaften und binden im Kontakt mit
Wasser mehr oder weniger gut ab (SCHMITT-RIEGRAF et al. 1997). Diese
„Stabilisate“ immobilisieren einen Großteil der Schwermetalle,
zerfallen aber im sauren pH-Bereich. Dabei gehen die kristallchemisch
gebundenen Schwermetalle wieder in Lösung. Damit ist eine Zerstörung
der Frostschutzschichten und/oder der Tragschichten unter
Straßenpflastern oder Gehwegen etc. möglich. Aus dem straßenbaulichen
wird damit gleichzeitig ein Umweltproblem.
Trotz der großen Erfahrung der Autoren ist das Handbuch nicht ganz
fehlerlos. Auf Seite 16 wird als Einheit für das spezifische Gewicht
g/cm3 genannt. Das ist die Einheit für die Dichte. Das spez. Gewicht
hat als Einheit N/cm3. Auf S. 193 definieren die Verfasser
Pyroklastite als lockere (oder verfestigte) Ablagerungen von
Pyroklasten. Das ist falsch! Lockere Ablagerungen von Pyroklasten
nennt man Pyroklastika, nur die verfestigten Pyroklasten heißen
Pyroklastite. Bims, vulkanische Asche und Lavaschlacke sind keine
vulkanischen Gesteine, sondern Pyroklasten (S. 198). Bims und
Lavaschlacke sind keine Pyroklastite (S. 202). Feldspäte und Biotit
sind in Tuffen zumeist primäre Bildungen und keine sekundären
(S. 212). Im AFM-Diagramm auf S. 234 ist der Parameter F falsch; F
bedeutet (Fe2O3 + FeO) und nicht (Fe2O2 + FeO). Basalte enthalten
normalerweise Plagioklas- und Olivineinsprenglinge, nicht
Sanidin-Einsprenglinge (S. 234). Die Begriffe Rhyolith und
Quarzporphyr sind nicht identisch (S. 238); Quarzporphyr ist ein
Paläo-Rhyolith, zumeist mit einem permischen Alter. Nicht alle
Ignimbrite sind intensiv verschweißt (S. 238). Es gibt auch solche mit
geringerem Verschweißungsgrad und kollabiertem Bimsstein. Zwei Absätze
weiter unten, auf S. 238, bezeichnen die Verfasser Ignimbrite als am
Boden geflossene, heiße Ströme (Glutlawinen), die ein altes Relief
einebnen können. Das ist wiederum falsch. Ignimbrite sind die Produkte
von Glutlawinen, nicht die Glutlawinen selbst. Eine Aufzählung aller
Fehler macht im Rahmen dieser Rezension wenig Sinn, zumal sie den Wert
des Handbuches nicht schmälern.
Die Texte enthalten manche interessanten „Schmankerl“, wie z. B. auf
S. 215: „Stradivari- und Amati-Geigen haben Puzzolane als Füllstoff in
der Leimfarbe; die dadurch bedingte Verkieselung des Holzes erhöht
seine Resonanzfähigkeit.“ Nicht uninteressant ist die Verwendung
verschiedener unbehandelter oder behandelter Minerale als
Tierfutterzusatz (z. B. kaustische Magnesia, Dolomitstein, Kalkstein,
Talk, kaolinitischer Ton, Bentonit, Perlit, Vermiculit,
Zeolithe). Jeansstoffe werden mit Bims gewaschen und erhalten dann das
Prädikat „stone-washed“. Im Kapitel über die Quarzrohstoffe findet
sich – wer hätte das gedacht – eine Tabelle mit den
Kurzcharakteristiken von SiO2-Schmucksteinvarietäten. Dass Quarzsande
(sog. Bremssande) bei Schienenfahrzeugen, besonders beim Bremsen und
Anfahren, zu einer Verbesserung der Haftung zwischen Schiene und Rad
führen, dürfte wenigen Geowissenschaftlern bekannt sein. Die Deutsche
Bahn AG hat für die passende Korngrößenverteilung des Quarzsandes
(sog. Bremssand) eine eigene Norm, die TL 918 224. Interessant ist
auch, dass Reisschalenasche (Asche von Reisspelzen) puzzolanische
Eigenschaften besitzt und man sie lokal zur Herstellung von
Puzzolanzement einsetzen kann.
Insgesamt gesehen liefert das Handbuch eine riesige Fülle an
Informationen über mineralische Baurohstoffe. Da fallen die relativ
wenigen (Flüchtigkeits-) Fehler kaum ins Gewicht. Das Heft eignet sich
neben der oben angeführten Zielgruppe auch für Studenten der
Mineralogie, für Angewandte Mineralogen, Lagerstättenkundler,
Architekten, Straßenbauer und Denkmalschützer. Möge das Handbuch eine
weite Verbreitung finden!
[Anmerkung: Zur geologisch-technischen Bewertung von mineralischen
Rohstoffen gibt es von den gleichen Autoren auch einige Hefte in der
Reihe H des Geologischen Jahrbuchs unter dem Titel
„Bewertungskriterien für Industrieminerale, Steine und Erden, Teil 1
bis Teil 6“. Heft 2 (1997) behandelt Tone, Heft 4 (1998) Karbonat- und
Sulfatgestein, Heft 6 (1999) Quarzrohstoffe, Heft 7 (2000) Vulkanische
Gesteine und Leichtzuschläge, Heft 8 (2002) Gesteinskörnungen (Kies,
Sand und gebrochener Naturstein) und Heft 9 (2003) Naturwerksteine und
Dachschiefer.]
C. SCHMITT-RIEGRAF
Zentralblatt Geol. Pal. T. II Jg. 2008 H. 576