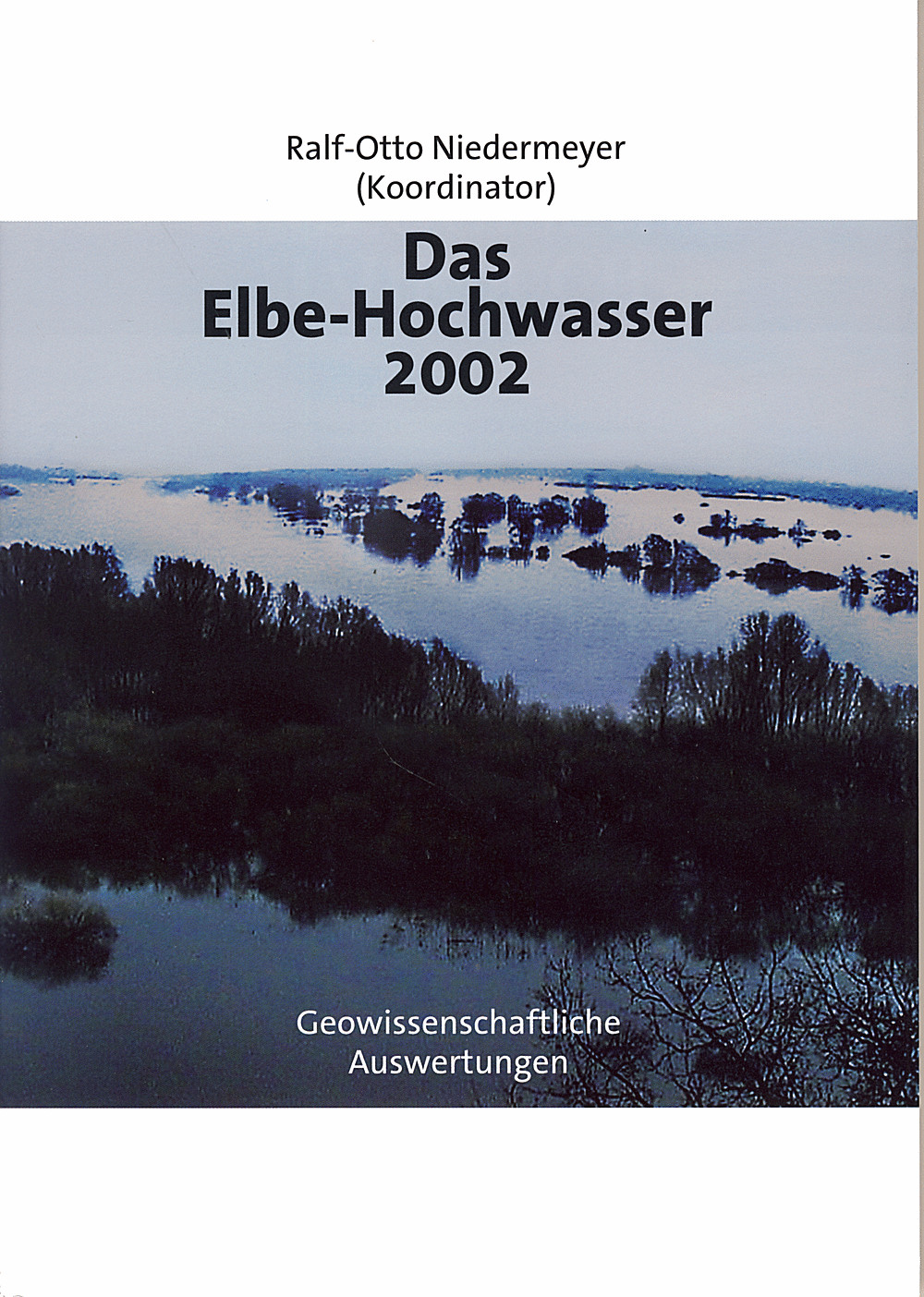Das katastrophale Elbe-Hochwasser vom Sommer 2002 forderte über 20
Todesopfer und verursachte einen Schaden von mehr als 25 Mrd. €. Die
Schwere dieser Naturkatastrophe hat im ganzen Land große Solidarität
ausgelöst, wodurch sehr schnell viele der tragischen Schäden gelindert
werden konnten. Gleichzeitig entstanden von vielen Seiten Forderungen
an Behörden, Staat und Gesellschaft, etwas zu tun, um solche
Katastrophen besser beherrschen zu lernen. Dabei wurden von der
Mehrheit der Bevölkerung direkte Maßnahmen zum Hochwasserschutz in den
Vordergrund gestellt. Der Beitrag der Geologie im weitesten Sinne aber
wird selbst für die nicht auf diesem Gebiet tätigen Geowissenschaftler
nur unvollkommen erschließbar sein. Anhand von 7 exemplarisch
ausgewählten Beiträgen bietet der vorliegende Band ein Spektrum
bedeutungsvoller Resultate, um sich mit den Sachverhalten vertraut zu
machen.
Im einleitenden Beitrag von R.-O. NIEDERMEYER: ``Das Elbe-Hochwasser
- Geowissenschaftliche Auswertungen'' wird das Risiko- und
Schadenspotential von Fluss-Fluten allgemein umrissen. Im Abschnitt
``Geowissenschaftliche Fakten und öffentliches Problembewusstsein''
weist der Autor sehr deutlich darauf hin, dass Flut-Katastrophen
natürliche Prozesse waren und bleiben werden, die zunehmend in den
Hintergrund der modernen öffentlichen Wahrnehmung getreten sind. Der
Autor stellt fest: ``Die relevanten geologischen Grundlagen, Fakten
und Kenntnisse sind über Jahrzehnte zusammengetragen, dokumentiert,
interpretiert und publiziert worden, aber davon wird nur in
unzureichendem Maße bei Planungs-, Bau- und anderen
Infrastrukturentscheidungen von den Verantwortlichen in Politik und
Wirtschaft Gebrauch gemacht. Die Auswirkungen von
Landnutzungsänderungen auf die Hochwasserentstehung werden besonders
deutlich bei den Abflussprozessen, die durch die geologischen und
bodenkundlichen Eigenschaften im Einzugsgebiet geprägt werden… Auch
die Bevölkerung muss im Hinblick auf die Gefahren und Risiken des
Wohnens am Strom verstärkt aufgeklärt werden.'' Von diesen
Grundgedanken ausgehend werden die neuesten staatlichen Aktivitäten
zum ``Gesetzlichen Hochwasserschutz'' und die ``Rolle der Staatlichen
Geologischen Dienste Deutschlands'' dargestellt. Wie die ``Staatlichen
Geologischen Dienste'' ihre Rolle wahrnehmen, demonstrieren die
folgenden Beiträge.
Die Autoren W. ALEKXOWSKY & F. HORNA belegen in ihrem Beitrag ``Der
geologische Untergrund von Dresden - Beziehungen zu den
Hochwasserereignissen 2002'' mit der Neukartierung von 4 Blätern der
Geologischen Karte 1 : 25 000, dass die Hochwasserereignisse
verdeutlicht haben, ``dass die holozänen Flussauen in ihrer gesamten
Breite auch heute noch wie seit 10 000 Jahren regelmäßige
Hochwasserüberflutungsgebiete in diesem Raum sind.'' Die Autoren
zeigen, dass der Auenlehm die typische Hochflutbildung darstellt, die
auch bei geringer Mächtigkeit sowohl das Weißerritz-Hochwasser
(12./13. August 2002) als auch das Elbe-Hochwasser (16.-19. August
2002) sehr genau mit den kartierten Grenzen der Flussauen
übereinstimmt. Damit sind künftig diese geologischen Karten wichtige
Planungshilfsmittel.
G. CASPERS, J. ELBRACHT und E. SCHNEIDER behandeln in ihrem Beitrag
die ``Hochwassergefährdungskarte von Niedersachsen - Ergebnis einer
methodischen Auswertung geologischer Fachdaten''. Ausgehend von der
Erkenntnis, dass ``die Verbreitung von Auelehm und Auesand das
Szenario des worst case bei Hochwasser liefert'', entwickeln die
Autoren des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung ``eine
Methode zur Auswertung von Flächeninformationen der Geologischen Karte
von Niedersachsen 1 : 50 000 (GK 50) zum Thema Hochwassergefährdung.
Dabei werden Auswertungskriterien und -regeln definiert, durch die
eine Beziehung zwischen Stratigraphie und Genese geologischer
Einheiten und einer möglichen Überflutungsgefährdung hergestellt wird.
In der Auswertungskarte Hochwassergefährdung ist jeder Fläche eine
Gefährdungsstufe zugeordnet. Die Karten werden vorgestellt, und mit
der Bearbeitung weiterer Kartenblätter wird das Regelwerk fortgesetzt.
``Die Auswertungskarte Hochwassergefährdung stellt kein Kartenwerk
dar, sondern ist das dynamisch generierte digitale Produkt einer
Auswertungsmethode in MeMaS.'' Die gegenwärtige Erprobung dieser
Methode mit Wasserwirtschaftlern und Planungsbüros im Großraum
Braunschweig eröffnet die Möglichkeit einer künftigen Anwendung.
Im Beitrag ``Untersuchungen zur Gewässergüte im mecklenburgischen
Flussabschnitt der Elbe und Abschätzung der Nährstoff- und
Schwermetallfrachten während des Sommerhochwassers 2002'' konnten die
Autoren A. BACHOR, ST. KLITZSCH, R. WIEMER und G. MANTHEY
zusammenfassend feststellen: ``Im mecklenburgischen Teil der Elbe war
Sauerstoffmangel das Hauptproblem… In den gefluteten Poldern trat
Fischsterben auf. Im Vergleich zu normalen Abflussverhältnissen wurden
am Pegel Dömitz von Mitte August bis Mitte September neunbis zehnfach
höhere Arsen-, Zink- Blei- und Aluminiumfrachten ermittelt. Die
Frachten von Cadmium und Nitrat waren … um das Fünffache erhöht.
Dabei sind die hohen Ammonium- und Nitratfrachten auf verstärkte
Einleitung von Abwässern in den Flussoberläufen infolge des
Hochwassers zurückzuführen. Für die Schwermetalle wurde ein schneller
Konzentrationsanstieg mit Eintreffen der Hochwasserwelle ermittelt,
was auf erhöhte niederschlagsbedingte diffuse Einträge,
Bergbaualtlasten im Einzugsgebiet der Mulde (As, Pb) und/oder
Umlagerung belasteter Sedimente zurückgeführt wird. Infolge der
Sedimentation der belasteten Schwebfracht in den Überflutungsbereichen
sind im Untersuchungsgebiet die Belastungen geringer als in den
Oberläufen der Flüsse.
Die Autoren G. RANK, K. KARDEL und H. WEIDENSDÖRFER fassen in ihrem
Beitrag ``Geochemische Untersuchungen an den Hochflutschlämmen in
Sachsen in Verbindung mit dem Hochwasserereignis 2002'' die
umfangreichen Untersuchungsergebnisse an Schlämmen und Aueböden
zusammen. Dabei wurde festgestellt, dass die Schlämme der Elbe,
Zschopau und Zwickauer Mulde hinsichtlich der mittleren As- und
Schwermetallgehalte ein vergleichbares Konzentrationsniveau aufwiesen
wie die Aueböden, also vorwiegend Umlagerungen erfolgten. Im
Einzugsgebiet der Freiberger Mulde dagegen erfolgte durch zusätzlichen
Eintrag von ca. 9 000 t Haldenmaterial eine Erhöhung der As-, Cd- und
Schwermetallbelastung. Die schon länger bekannte As- und Cd-Belastung
der Mulde-Aueböden rückte durch die Untersuchungen im Zusammenhang mit
dem Elbehochwasser stärker in den Mittelpunkt, und eine
Nutzungseinschränkung der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist
wahrscheinlich.
Die Entwicklung der Schwermetallbelastungen im Fluss wird durch den
Beitrag: ``Ergebnisse von Untersuchungen des Sondermessprogramms
``Elbe-Hochwasser 2002'' an Schlämmen, Böden und Weidegras im
mecklenburgischen Elbtal'' von den Autoren: P. SCHWETER, T. DANN und
F. IDLER vorgelegt und mit Ergebnissen aus den Jahren 1990 und 1998
verglichen. Für die meisten Schwermetalle und organischen Schadstoffe
liegen die Werte in den Schlämmen und Aueböden in vergleichbarer
Konzentration vor, was die Umlagerung der Altablagerungen anzeigt und
eine Zumischung stärker belasteten Materials nicht erkennen lässt. Mit
Ausnahme von Hg blieben die Werte unter den Maßnahmewerten der
BBodSchV. Im Weidegras-Aufwuchs variieren die Belastungen mit den
Schlammanhaftungen, die in einzelnen Bereichen erheblich waren.
Die Autoren T. HILGERT, M. LÜCKSTÄDT und E. SCHUBERT berichten in
ihrem Beitrag ``Das Grundwasser-Sondermessprogramm ¥Elbe-Hochwasser
2002'' in Mecklenburg- Vorpommern - Beitrag zur Gefährdungsbewertung
durch geohydraulische Modellierung'' über den hochwasserbedingten
Grundwasseranstieg im Hinterland, in Abhängigkeit vom
Hochwasserverlauf, den klimatischen Bedingungen sowie der
hydrogeologischen Standortsituation. Mit Hilfe der vorgenommenen
analytischen Berechnungsweise gelang es, ohne aufwendige numerische
Simulation entlang der Elbe die hochwasserbedingten
Grundwasseranstiege im Hinterland zu prognostizieren. Dazu wurde der
Elbelauf hinsichtlich geohydraulisch relevanter Modelltypen
charakterisiert, entsprechende analytische Simulationsmodelle gebildet
und an gemessenen Hochwasserreaktionen überprüft. Unter Einbeziehung
von Archivmaterial wird am Ende der Bearbeitung eine
Gefährdungsbewertung entlang des Elbelaufs vorgelegt, welche, bezogen
auf das Bemessungshochwasser, den dazugehörigen
Grundwasserscheitelwert sowie dessen Eintrittspunkt dokumentieren.
Damit wird eine prognostische Aussage zur Risiko- und
Schadensminimierung möglich.
Das Hochwasserereignis 2002 und seine Auswirkung im Raum Wörlitz und
auf die Wörlitzer Anlagen (UNESCO- Weltkulturerbe) werden im Beitrag
von I. RAPPSILBER und M. THOMAE untersucht. Im Raum Wörlitz ändert die
Elbe bedingt durch Endmoränenzüge ihre Fließrichtung von SE-NW in W.
Die Hochwasserausbreitung ist daher nur nach S in die weite Ebene
möglich, in der neben einer Reihe Ortschaften auch der 118 ha große,
1770 angelegte Wörlitzer Park gelegen ist. Wenige Tage nach der
Errichtung der ersten Gärten folgte ein verheerendes Hochwasser, das
die Anlagen vernichtete. Im Gefolge dieses Ereignisses wurden
seinerzeit umfangreiche Deiche von holländischen Deichbaumeistern
angelegt, die bis heute wirksamen Schutz bieten. Eine wesentliche
Erweiterung der Deichbauten erfolgte nach 1930, wobei die
Überflutungsflächen deutlich eingeengt und gleichzeitig, was die
Holländer vermieden hatten, Altwasserarme der Elbe überbaut wurden.
Das Hochwasser 2002 führte an solch einer Stelle zum Deichbruch. Mit
umfangreichen Untersuchungen während des Hochwassers 2002 und auch
historischer Überflutungen entstand ein digitales Monitoringsystem,
mit dem sehr genau Höhendaten erfasst und bearbeitet werden können.
Von Bedeutung ist, dass die dargestellten Isolinienintervalle frei
wählbar sind und mit den Wasserspiegelhöhen verschneidbar sind. So
können die potenziellen Überflutungsflächen und Wasserwege für
verschiedene Wassermengen und Wasserwege simuliert werden.
Die im vorliegenden Band ausgewählten Arbeiten demonstrieren, dass die
Geowissenschaften wirksame Beiträge im Sinne des Hochwasserschutzes
geleistet haben und damit wichtige Bausteine für die bessere
Beherrschung künftiger Hochwasserfluten liefern, wenn diese
entsprechend angewandt und eingesetzt werden. Die am Schluss des
Bandes beigefügten 15 Farbfotografien, die die Rekordflut
dokumentieren, tragen hoffentlich dazu bei, dass diese verheerenden
Katastrophen nicht so schnell verdrängt werden und das öffentliche
Problembewusstsein mehr entwickelt wird.
M. STÖRR, Usedom
Z. geol. Wiss. 34 (1-2) 2006