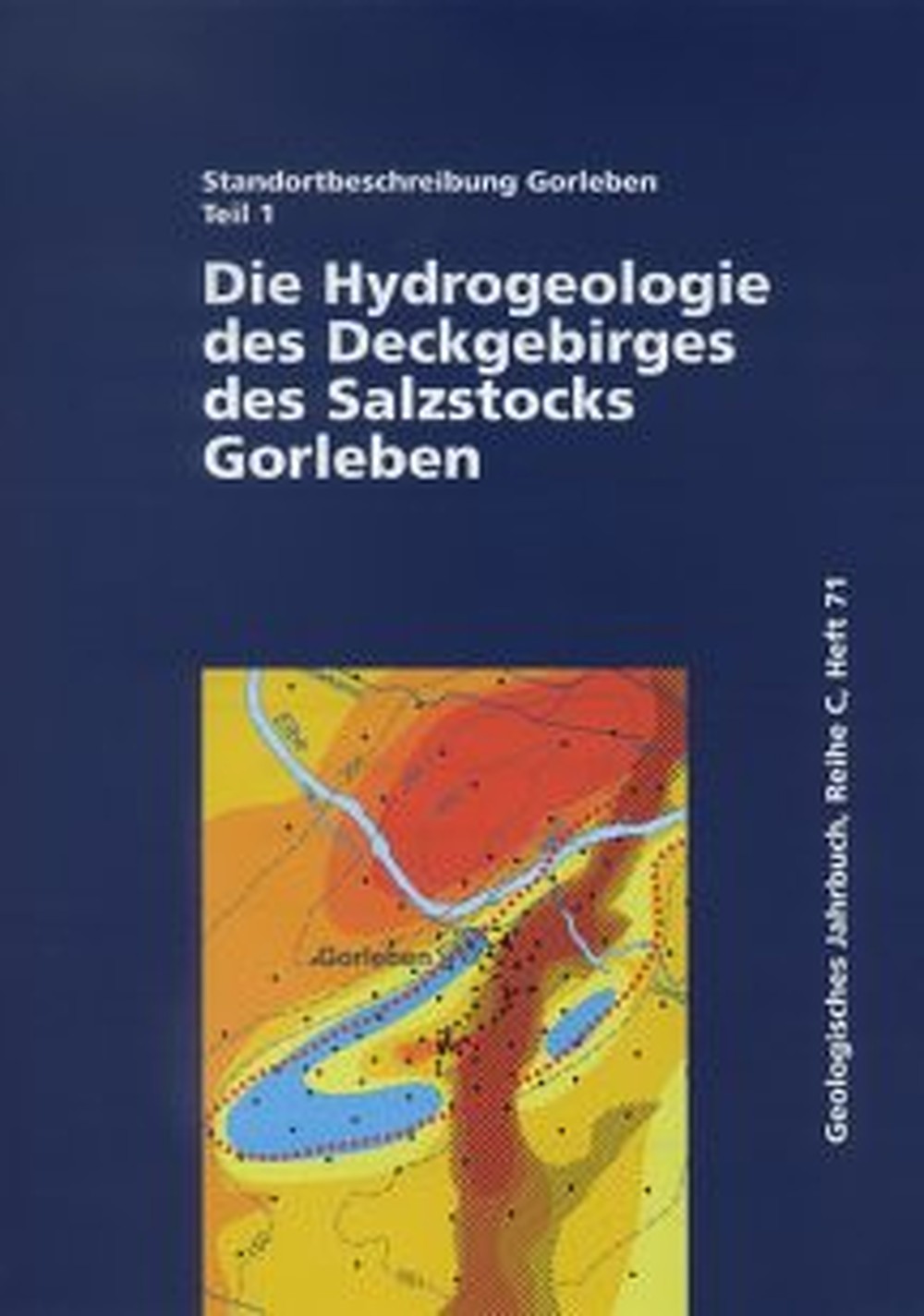„Der Salzstock Gorleben ist im Jahr 1977 von der Niedersächsischen
Landesregierung als möglicher Standort für ein Bergwerk zur
Endlagerung radioaktiver Abfälle vorgesehen worden“. So beginnt das
einleitende Kapitel der Standortbeschreibung Gorleben. Heute, so
erfährt der Leser im Vorwort, ruhen infolge der Vereinbarung zwischen
Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen aus dem Jahre
2000 die Arbeiten am Standort Gorleben. 30 Jahre also, in denen
Geowissenschaftler, unter ihnen Hydrogeologen, an der Erkundung und
Bewertung des Standortes gearbeitet haben, häufig auch kritisch beäugt
von der Öffentlichkeit. 30 Jahre, in denen sich die Diskussion um die
Energieversorgung sowie auch deren technischen Möglichkeiten gewandelt
haben, in denen es zum Reaktorunfall in Tschernobyl als auch zur
Öffnung der innerdeutschen Grenze kam, und in denen sich die
geologischen Erkundungsmethoden bedeutend weiter entwickelt haben. Da
wird es endlich Zeit, die umfangreichen Erkundungen in einen
Gesamtzusammenhang zu stellen. Dieser Aufgabe haben sich die Autoren
der 4 Teilbände gestellt und verbinden damit den Anspruch
(lt. Vorwort) „… die in der Öffentlichkeit und im politischen Raum
kontrovers geführte Diskussion um den Standort Gorleben zu
versachlichen.“
Teil 1 der Standortbeschreibung Gorleben beschränkt sich auf die
Hydrogeologie des Deckgebirges im Bereich des Salzstockes und kann
demzufolge auch nur als eine Teilbewertung im Hinblick auf einen
möglichen Schadstoffaustrag angesehen werden, wie die Autoren deutlich
machen. Die Autorengemeinschaft setzt sich aus anerkannten
Wissenschaftlern der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
in Hannover (BGR), der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit
(GRS) mbH in Braunschweig und der International „Atomic Energy Agency“
in Wien zusammen. Die dargelegten Befunde beziehen sich zusätzlich auf
Forschungsprogramme einer Vielzahl von Institutionen und
Universitätseinrichtungen aus 30 Jahren Untersuchungsdauer.
In insgesamt neun Kapiteln werden nun die einzelnen Arbeitspakete von
der geologisch- hydrostratigraphischen Erkundung, über die
Untersuchung der stofflichen Beschaffenheit der Grundwässer bis hin
zur Modellierung der Strömungs- und Transportbedingungen dargestellt.
Immer werden die verwendeten Methoden hinreichend erläutert und
schließlich die Ergebnisse, die in bis zu 30 Jahren erarbeitet wurden,
dargelegt und interpretiert. Die Datengrundlage wird nachvollziehbar
beschrieben, und jedes Kapitel wird kurz zusammenfassend
eingeleitet. Besonders positiv macht sich dabei bemerkbar, daß die
Autoren stets Bezug nehmen auf die mit anderen Methoden gewonnenen
Ergebnisse, z.B. die Bestätigung geologischer Erkundungen durch
geothermische Messungen oder isotopenhydrologische Befunde. Damit wird
der Bericht zu einem Musterbeispiel für gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Das abschließende Kapitel 10 bildet eine gut
verständliche Synopse aller Einzelbefunde.
Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt werden:
Hydrostratigraphische Untersuchungen ergeben das Bild eines oberen
saale-weichselzeitlichen Grundwasserleiters und eines tieferen
tertiären und elsterzeitlichen Grundwasserleiters, die i.d.R. durch
den gering durchlässigen elsterzeitlichen Lauenburer Ton getrennt
sind. Besonderes Strukturmerkmal ist die elsterzeitliche Gorlebener
Rinne, die im Bereich des Salzstockesunmittelbar dem Hutgestein des
Salzstockes auflagert.
Zwei Bewegungspfade des salinaren Wassers des tieferen
Grundwasserleiters werden identifiziert; zum einen der laterale
Austrag ausgehend vom Salzstock in die nordwestliche Randsenke und zum
anderen ein vertikaler Aufstieg oberhalb des Salstockes in den oberen
Grundwasserleiter bedingt durch lokal erhöhte hydraulische
Leitfähigkeiten.
Mittels numerischer Modelle werden Zeitspannen zwischen dem
Kontaktbereich in der Gorlebener Rinne bis zur Grundwasseroberfläche
angegeben, die bei konservativer Betrachtung einige tausend bis
zehntausend Jahre betragen, unter Berücksichtigung der erhöhten Dichte
des Salzwassers jedoch länger sein können. Entsprechend ergeben
Isotopenuntersuchungen, daß die Salzwässer z. T. pleistozän geprägt
sind, aber auch holozäne Beimischungen enthalten. Zusammenfassend wird
daraus eine geringe Salzwasserbewegung abgeleitet.
Besonders positiv wirkt sich die klare Sprache des Textes aus,
begleitet von kurzen, aber hinreichenden Methodenerläuterungen und
hervorragenden farbigen Abbildungen. Man möchte - und man kann sogar -
diesen absolut unprätentiös geschriebenen Bericht auch dem
hydrogeologischen Laien empfehlen. In diesem Sinne haben die Autoren
ihren Anspruch, nämlich die Grundlage für eine versachlichte
Diskussion in der Öffentlichkeit zu legen, vollständig erreicht.
Nur hier und da hat die Rezensentin doch kleine Kritiken
anzumerken. Warum z. B. wird nur zwischen Süß- (< 1g/L TDS) und
Salzwasser (> 1g/L TDS, s.a. Anlage „Hydrochemische
Vertikalschnitte“) unterschieden. Üblicherweise sprechen wir doch von
Brackwasser bei Salinitäten zwischen 1g/L und 10g/L. Auch ist es etwas
verwirrend, daß zumeist dieselben Vertikalschnitte besprochen werden,
diese aber im Textteil und im Anhang unterschiedliche Bezeichnungen
erhalten. Schließlich empfindet die Rezensentin die Abbildung der
Grundwasserneubildung (Abb. 4) in sofern als sehr unglücklich, da
mittels zweier verschiedener Farbkodierungen in nicht mehr
unterscheidbaren Grüntönen versucht wird, die Neubildungsraten für die
ehemals getrennten West- und Ostdeutschen Areale des
Untersuchungsraums flächenhaft darzustellen. Außerdem wäre eine etwas
breitere Darstellung der vielen verschiedenen hydraulischen Modelle
wünschenswert gewesen. Schließlich wurden hier über 30 Jahre hinweg
jeweils dem Stand der Technik entsprechende Modellwerkzeuge
eingesetzt; seien es konservative oder Dichte-berücksichtigende, 3D
oder 2D-Modelle, die jedes für sich einen immensen Arbeitsaufwand
bedeutet haben.
Was allerdings machen diese kleinen Unschönheiten
im Vergleich zu dem Gesamtwerk aus? Die Rezensentin hat die Lektüre
der 147 Seiten + Anhang sehr genossen und empfiehlt sie gerne Geologen
und Hydrogeologen, aber auch dem interessierten Laien.
MARIA-TH. SCHAFMEISTER, Greifswald
ZGW 35 (6) 2007